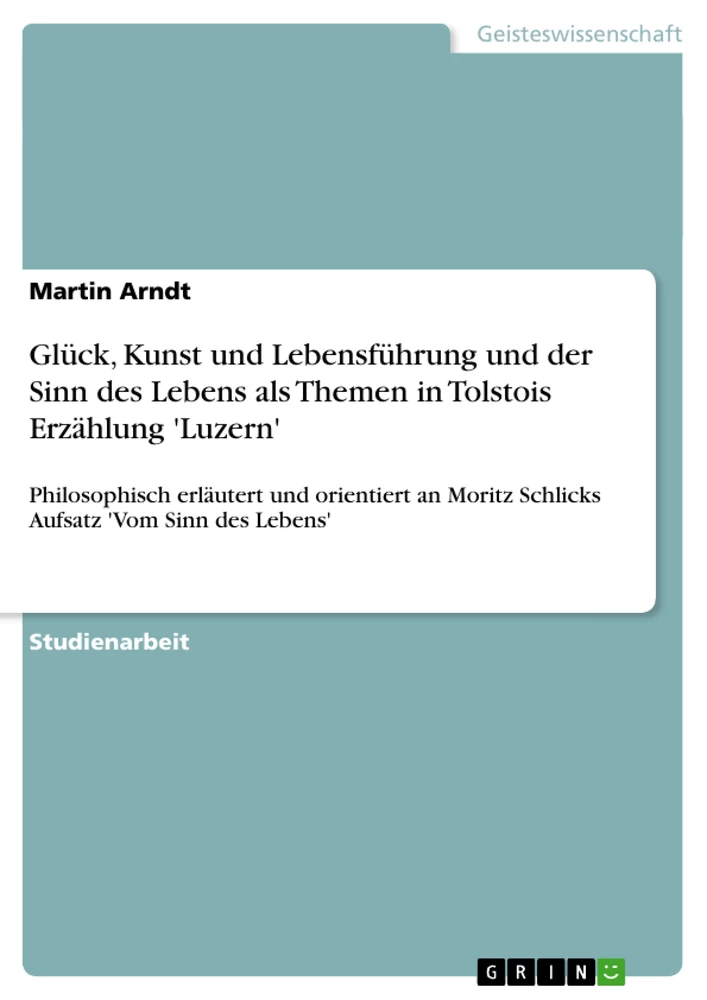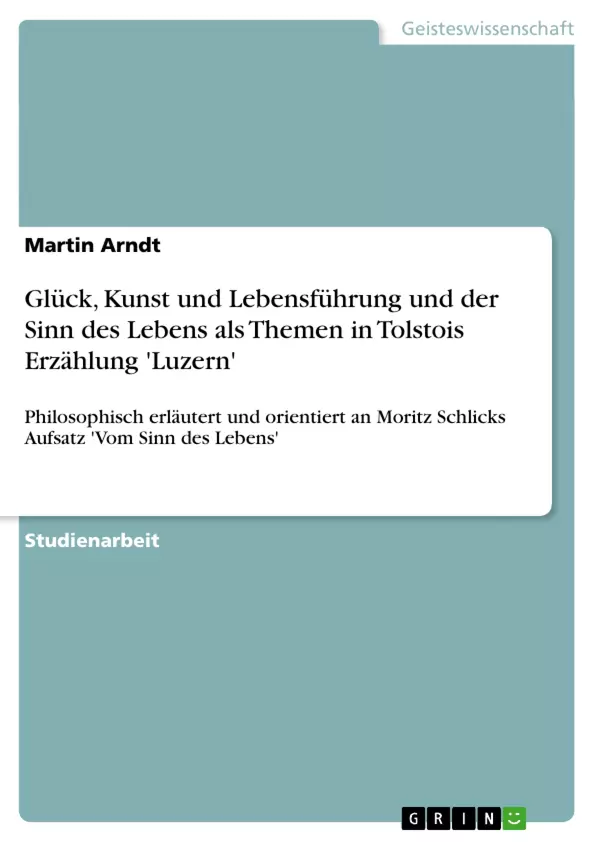Der Ich-Erzähler, erst seit knapp zwei Tagen in der altertümlichen Hauptstadt eines Schweizer Kantons namens Luzern, ist diesen Ortes schon fast überdrüssig. Die Ursache dessen ist vielschichtig, zum einen liegt sie in dem für die englischen Touristen und nach deren Geschmack neugebauten, steinernen, schnurgeraden Kai samt „prächtigen fünfstöckigen Häusern“ (Tolstoi: 5), der zusammen mit neugepflanzten Linden die Uferpromenade bildet und so gar nicht in die „eigenartig majestätische und zugleich unsagbar harmonisch und sanft wirkende Natur“ (Tolstoi: 6) hineinpasst, so dass der Protagonist sich erst mühe geben muss, sich so zu setzen, dass sein Blick nicht gestört wird. Zum anderen liegt es wohl an der feinen Gesellschaft bei Tische, die – es sind ja auch Engländer – nicht das Bedürfnis nach Annäherung empfindet, sich selbst genügt und „durch eine strenge, von den Anstandsregeln vorgeschriebenen Zurückhaltung“ (Tolstoi: 7) auszeichnet und somit in vollstem Kontrast zu der ihm so sympathischen Pariser Gesellschaft steht, die vor Heiterkeit, Geselligkeit und Zwischenmenschlichkeit fast aus den Nähten platzt. Der Ich-Erzähler preist den sozialen Umgang von Mensch zu Mensch als „einen der höchsten Genüsse des Lebens“ (Tolstoi: 9), um diesen bringt ihn die feine Gesellschaft in Luzern und so verlässt er schweren Herzens „in denkbar schlechter Stimmung“ noch vor Beendigung des Desserts den Speisesaal und schlendert in der Hoffnung auf Zerstreuung durch die Stadt. (Tolstoi: 10) Er läuft durch die engen, schmutzigen Straßen, bemerkt die Läden, die gerade schließen, begegnet betrunkenen Arbeitern, beobachtet Frauen, die gerade Wasser holen und andere Frauen, die, „sich dauernd umblickend, in koketten Hütchen“, an den Mauern entlang durch die Stadt huschen; all dies verstärkt seinen Missmut nur noch, er fühlt sich „vereinsamt und bedrückt, wie es mitunter ohne jeden ersichtlichen Grund geschieht, wenn man an einem neuen Ort angekommen ist“. (Tolstoi: 10)
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsangabe der Erzählung „Luzern“
- Der philosophische Dreh
- Nach dem Sinn des Lebens fragen
- Schopenhauer und der Sinn des Lebens
- Jenseits der Zwecke - Nietzsche
- Auf dem Wege zu Schiller
- Schiller und das Spiel
- Lebensführung im schillerschen Sinne?
- Die Jugend
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der philosophischen Interpretation von Leo Tolstois Erzählung „Luzern“. Dabei wird der Fokus auf die Themen Glück, Kunst und Lebensführung gelegt, um die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler, einem Tiroler Sänger und einer Gruppe von englischen Aristokraten zu untersuchen.
- Die Bedeutung von Kunst und Musik für das menschliche Glück
- Die Rolle der sozialen Klassen und ihres Einflusses auf die Wahrnehmung von Glück
- Die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Frage nach den wahren Werten
- Die philosophischen Positionen von Schopenhauer, Nietzsche und Schiller im Kontext der Erzählung
- Die Konfrontation mit der eigenen Lebensführung und der Suche nach Harmonie
Zusammenfassung der Kapitel
Inhaltsangabe der Erzählung „Luzern“
Die Erzählung „Luzern“ schildert die Begegnung des Ich-Erzählers mit einem wandernden Tiroler Sänger in der Schweizer Stadt Luzern. Der Erzähler schildert seine anfängliche Enttäuschung über die ihm fremde Umgebung und die ihm unsympathische Gesellschaft der englischen Aristokraten. Er findet Trost in der Musik des Sängers, doch die Reaktion der Aristokraten auf seine Kunst provoziert den Erzähler und lässt ihn über die Frage nach dem Glück und dem Sinn des Lebens nachdenken.
Der philosophische Dreh
Dieses Kapitel analysiert die philosophischen Aspekte der Erzählung, indem es die Frage nach Glück, Kunst und Lebensführung stellt. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Wahrnehmung von Glück und Kunst durch den Erzähler, den Sänger und die Aristokraten. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob Geld tatsächlich das Glück im Leben ausmacht, oder ob es andere, tiefere Werte gibt, die im Leben wichtiger sind.
Nach dem Sinn des Lebens fragen
Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen philosophischen Ansätze, die in Tolstois Erzählung zum Ausdruck kommen. Dabei wird die Frage nach dem Sinn des Lebens aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, indem die Positionen von Schopenhauer, Nietzsche und Schiller beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie Glück, Kunst, Lebensführung, soziale Klassen, Philosophie, Schopenhauer, Nietzsche, Schiller, Musik, Harmonie und dem Sinn des Lebens.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Tolstois Erzählung "Luzern"?
Die Erzählung schildert die Begegnung eines Ich-Erzählers mit einem Tiroler Sänger und kritisiert die Gefühlskälte der aristokratischen Gesellschaft gegenüber der Kunst.
Welche philosophischen Themen werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht die Konzepte von Glück, Kunst und Lebensführung unter Einbeziehung der Theorien von Schopenhauer, Nietzsche und Schiller.
Warum ist der Ich-Erzähler in Luzern bedrückt?
Er empfindet die künstliche Architektur und die strikte Zurückhaltung der englischen Touristen als Kontrast zur harmonischen Natur und zwischenmenschlichen Heiterkeit.
Welche Rolle spielt die Musik in der Erzählung?
Musik wird als höchster Genuss und Brücke zwischen Menschen dargestellt, die jedoch von der feinen Gesellschaft in Luzern nicht wertgeschätzt wird.
Was kritisiert Tolstoi an den sozialen Klassen seiner Zeit?
Er kritisiert die Arroganz und den Mangel an Empathie der wohlhabenden Aristokratie gegenüber einfachen Künstlern und dem wahren Sinn des Lebens.
- Citar trabajo
- Martin Arndt (Autor), 2002, Glück, Kunst und Lebensführung und der Sinn des Lebens als Themen in Tolstois Erzählung 'Luzern' , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29772