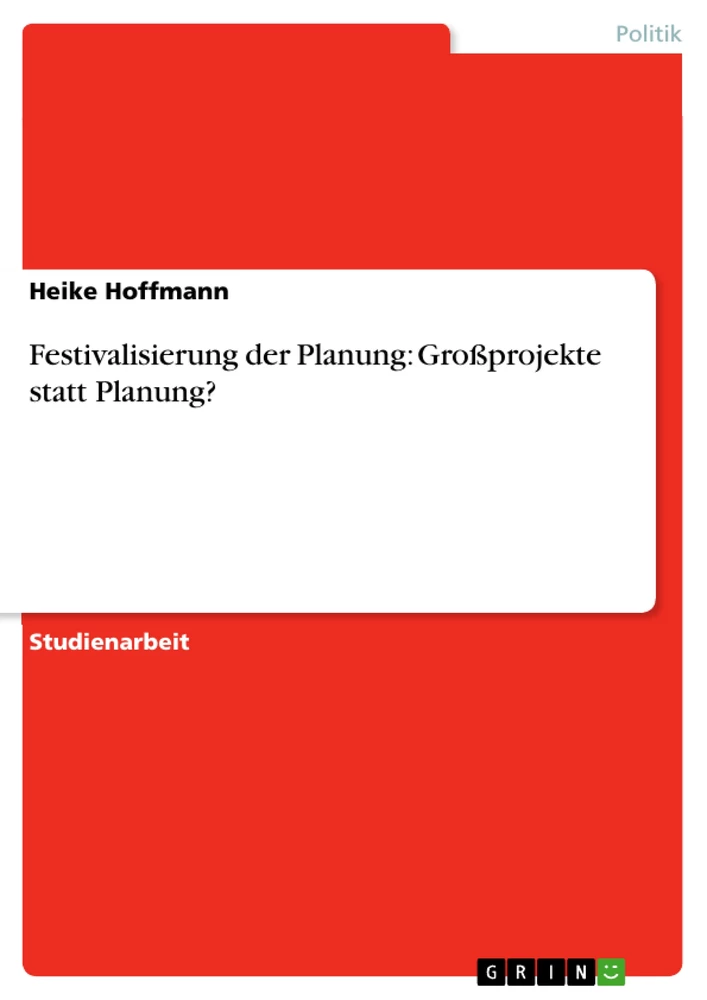Festivals können von der Politik für die Stadtentwicklung instrumentalisiert werden, was stadtsoziologisch als Politik der Festivalisierung bezeichnet wird. Umgekehrt wird unter Festivalisierung der Politik verstanden, dass Politik selbst nur noch als Inszenierung von Bedeutungsvollem funktioniere und seit Beginn der 1990er Jahre einen weit verbreiteten und praktizierten Typus der Stadtpolitik darstelle.
In Stadt und Region finden Feste, Festivals oder Großereignisse en mass statt: Weltausstellungen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Kultursommer, Theater-, Musik-, Filmfestspiele, Gartenschauen bedeuten für die Stadt oder Region die Ausrichtung eines Großprojektes der besonderen Art. Politisches Motiv dafür ist seit Beginn der Deindustrialisierung in den 1970er Jahren und in Zeiten kommunaler Finanzkrise, internationaler Städtekonkurrenz sowie postmodernem Lebenswandel der „Lokomotiveffekt“: Die Stadt oder Region würde bekannter; Touristen, einkommensstarke Bevölkerungsschichten und Investoren würden angezogen, die Wirtschaft angekurbelt, die Stadt um- und die Infrastruktur ausgebaut sowie die Politik wieder handlungsfähig, so die Hoffnung.
Großprojekte dieser Art beeinflussen somit die Entwicklung von Stadt und Region auf besondere Weise und sind demzufolge auch Gegenstand räumlicher Planung. So wird spätestens seit den 1990er Jahren „Planung durch Projekte“ en vogue: Planung konzentriert sich auf punktuelle Interventionen, die inhaltlich, räumlich und zeitlich auf ein Projekt begrenzt sind.
Im Buch wird aufgezeigt, welche stadtpolischen und gesellschaftlichen Mechanismen sich hinter diesem Typus von Stadtpolitik verbergen und inwiefern diese Art Stadtpolitik kritisch für die Stadtentwicklung bewertet werden muss, wenn doch zunächst davon ausgegangen wird, dass die Stadt grundsätzlich in Aufbruchstimmung versetzt wird, Kräfte mobilisiert und Ressourcen konzentriert werden können.
Fünf Punkte stehen dabei im Mittelpunkt: Wie charakterisiert sich dieser Typus der Stadtpolitik? Welche positiven und negativen Effekte können für die Stadtentwicklung bestehen? Warum gelten die Olympischen Spiele von Barcelona 1992 stadtentwicklungspolitisch betrachtet als gelungen? Welche Bedeutung hat die „Politik der großen Ereignisse“ für die Stadtentwicklung insgesamt? Und wodurch würde sich innovationsorientierte Planung im Umgang mit großen Ereignissen in Stadt und Region auszeichnen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „Außeralltäglichkeit“: Attraktivität des Festes durch Beschwörung von Charisma
- „Festivalisierung“: ein Charakterisierungsversuch
- Neue „Unsichtbarkeit“ der Städte: Der Rahmen für die Politik der Festivalisierung
- Was „verspricht“ das Großereignis? - politische Erwartungen durch die Festivalisierung der Politik
- Was „hält“ das Großereignis? - Effekte durch die Politik der Festivalisierung
- Reflexion: Kräfte mobilisieren, an Bekanntheit gewinnen
- Reflexion: Konzentration von Ressourcen
- Reflexion: Administrative Arbeitsweisen und Strukturen beleben
- Großereignis mit Erfolgscharakter - Olympische Spiele 1992 in Barcelona
- Stadtverträglichkeit?
- Zeitgemäßes Stadtentwicklungskonzept?
- Grundsatzfragen?
- Barcelonas „Geheimnis zum Erfolg“ Anfang der 1990er Jahre
- Bedeutung von Festivals als „neuer Typus“ der Stadtpolitik
- „Großereignisse“ in Konkurrenz zu „konventioneller“ Planung
- Status Quo
- Planerisches Ideal
- Großprojekte statt Planung?
- „Großereignisse“ in Konkurrenz zu „konventioneller“ Planung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Festivalisierung der Stadtpolitik“, ein Phänomen, das sich in der Konzentration von Ressourcen und Aktivitäten auf Großereignisse äußert. Die Zielsetzung besteht darin, die kritischen Aspekte dieser Politikform zu beleuchten und die zugrundeliegenden stadtpolitischen und gesellschaftlichen Mechanismen zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Bewertung der positiven und negativen Effekte solcher Großprojekte auf die Stadtentwicklung.
- Kritische Betrachtung der „Festivalisierung“ als Stadtpolitik
- Analyse der Effekte von Großereignissen auf Stadtentwicklung
- Untersuchung der Mechanismen hinter der „Politik der großen Ereignisse“
- Bewertung des Erfolgsmodells der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona
- Die Rolle von Großprojekten im Vergleich zu konventioneller Planung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „Planung durch Projekte“ und der „Festivalisierung der Stadtpolitik“ ein. Sie beschreibt den Wandel in der Stadtpolitik hin zu punktuellen Interventionen in Form von Großereignissen und beleuchtet die Ambivalenz dieser Strategie. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern die „Politik der großen Ereignisse“ kritisch zu betrachten ist, obwohl sie Aufbruchstimmung, Mobilisierung von Kräften und Ressourcenkonzentration bewirken kann. Die zentralen Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert.
Die „Außeralltäglichkeit“: Attraktivität des Festes durch Beschwörung von Charisma: Dieses Kapitel untersucht den grundlegenden Charakterzug von Festen – die Außeralltäglichkeit – als Quelle ihrer Attraktivität. Es wird der Begriff des „institutionellen Charismas“ eingeführt und erläutert, wie Festivals als Institutionen verstanden werden können, die Charisma erzeugen und Innovationen fördern. Die temporäre Aussetzung von Alltagsregeln ermöglicht ein Einlassen auf ungewöhnliche Lösungen und schwächt die Notwendigkeit der Legitimation von Sonderausgaben.
„Festivalisierung“: ein Charakterisierungsversuch: Dieses Kapitel charakterisiert die „Festivalisierung“ als einen neuen Typus der Stadtpolitik, der sich durch die Konzentration von Ressourcen auf klar umrissene, zeitlich befristete und publikumswirksame Großereignisse auszeichnet. Es wird der Ansatz von Siebel aufgegriffen, der die „Politik der großen Ereignisse“ als einen neuen Typus von Politik beschreibt, der Gelder, Menschen und Medien auf ein bestimmtes Ziel mobilisiert.
Neue „Unsichtbarkeit“ der Städte: Der Rahmen für die Politik der Festivalisierung: [Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext]
Was „verspricht“ das Großereignis? - politische Erwartungen durch die Festivalisierung der Politik: [Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext]
Was „hält“ das Großereignis? - Effekte durch die Politik der Festivalisierung: Dieses Kapitel analysiert die positiven und negativen Effekte einer „festivalisierten“ Politik für eine Stadt. Es beleuchtet die Mobilisierung von Kräften, die Konzentration von Ressourcen und die Belebung administrativer Arbeitsweisen und Strukturen. Die Ambivalenz dieser Strategie wird hervorgehoben, da das Verlassen auf den Erfolg eines Großprojektes ein hohes Risiko birgt.
Großereignis mit Erfolgscharakter - Olympische Spiele 1992 in Barcelona: Dieses Kapitel untersucht die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona als Beispiel für ein stadtentwicklungspolitisch gelungenes Großereignis. Es analysiert die Faktoren, die zum Erfolg Barcelonas beigetragen haben, und setzt diese in Relation zu allgemeinen Kriterien zur Beurteilung von Großprojekten.
Bedeutung von Festivals als „neuer Typus“ der Stadtpolitik: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Festivalisierung in der Stadtpolitik und Stadtentwicklung. Es setzt „Großereignisse“ in Konkurrenz zu „konventioneller“ Planung und analysiert den Status Quo, das planerische Ideal und den Aspekt „Großprojekte statt Planung“.
Schlüsselwörter
Festivalisierung, Stadtpolitik, Großereignisse, Großprojekte, Stadtentwicklung, Planung durch Projekte, Barcelona 1992, Ressourcenkonzentration, Charisma, Innovation, Ambivalenz, Risiken, konventionelle Planung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Festivalisierung der Stadtpolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die „Festivalisierung der Stadtpolitik“, ein Phänomen, das sich in der Konzentration von Ressourcen und Aktivitäten auf Großereignisse äußert. Sie analysiert die kritischen Aspekte dieser Politikform und die zugrundeliegenden stadtpolitischen und gesellschaftlichen Mechanismen, mit Fokus auf positiven und negativen Effekten solcher Großprojekte auf die Stadtentwicklung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit einer kritischen Betrachtung der „Festivalisierung“ als Stadtpolitik, der Analyse der Effekte von Großereignissen auf die Stadtentwicklung, der Untersuchung der Mechanismen hinter der „Politik der großen Ereignisse“, der Bewertung des Erfolgsmodells der Olympischen Spiele 1992 in Barcelona und der Rolle von Großprojekten im Vergleich zu konventioneller Planung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Attraktivität von Festen durch Charisma, zur Charakterisierung der Festivalisierung, zur „neuen Unsichtbarkeit“ der Städte im Kontext der Festivalisierung, zu den politischen Erwartungen und Effekten von Großereignissen, eine Fallstudie zu den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, ein Kapitel zur Bedeutung von Festivals als neuer Typus der Stadtpolitik und ein Fazit. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Festivalisierung und ihrer Auswirkungen.
Was versteht die Arbeit unter „Festivalisierung“?
„Festivalisierung“ wird als ein neuer Typus der Stadtpolitik charakterisiert, der sich durch die Konzentration von Ressourcen auf klar umrissene, zeitlich befristete und publikumswirksame Großereignisse auszeichnet. Es handelt sich um eine Politik der „großen Ereignisse“, die Gelder, Menschen und Medien auf ein bestimmtes Ziel mobilisiert.
Welche Rolle spielen die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona in der Arbeit?
Die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona dienen als Fallstudie für ein stadtentwicklungspolitisch als erfolgreich eingestuftes Großereignis. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die zum Erfolg Barcelonas beigetragen haben, und setzt diese in Relation zu allgemeinen Kriterien zur Beurteilung von Großprojekten.
Wie wird der Vergleich zwischen Großprojekten und konventioneller Planung dargestellt?
Die Arbeit setzt „Großereignisse“ in Konkurrenz zu „konventioneller“ Planung und analysiert den Status Quo, das planerische Ideal und den Aspekt „Großprojekte statt Planung“. Es wird untersucht, inwieweit Großprojekte die konventionelle Planung ersetzen oder ergänzen.
Welche zentralen Forschungsfragen werden gestellt?
Zentrale Fragen sind, inwieweit die „Politik der großen Ereignisse“ kritisch zu betrachten ist, trotz positiver Aspekte wie Aufbruchstimmung, Mobilisierung von Kräften und Ressourcenkonzentration, und wie die positiven und negativen Effekte der Festivalisierung auf die Stadtentwicklung im Detail aussehen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen des Fazits sind im gegebenen Textausschnitt nicht vollständig enthalten. Der Text deutet aber auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Ambivalenzen der Festivalisierung hin und eine Bewertung der Risiken und Chancen dieser Politikform.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind Festivalisierung, Stadtpolitik, Großereignisse, Großprojekte, Stadtentwicklung, Planung durch Projekte, Barcelona 1992, Ressourcenkonzentration, Charisma, Innovation, Ambivalenz, Risiken, konventionelle Planung.
- Quote paper
- Heike Hoffmann (Author), 2004, Festivalisierung der Planung: Großprojekte statt Planung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29603