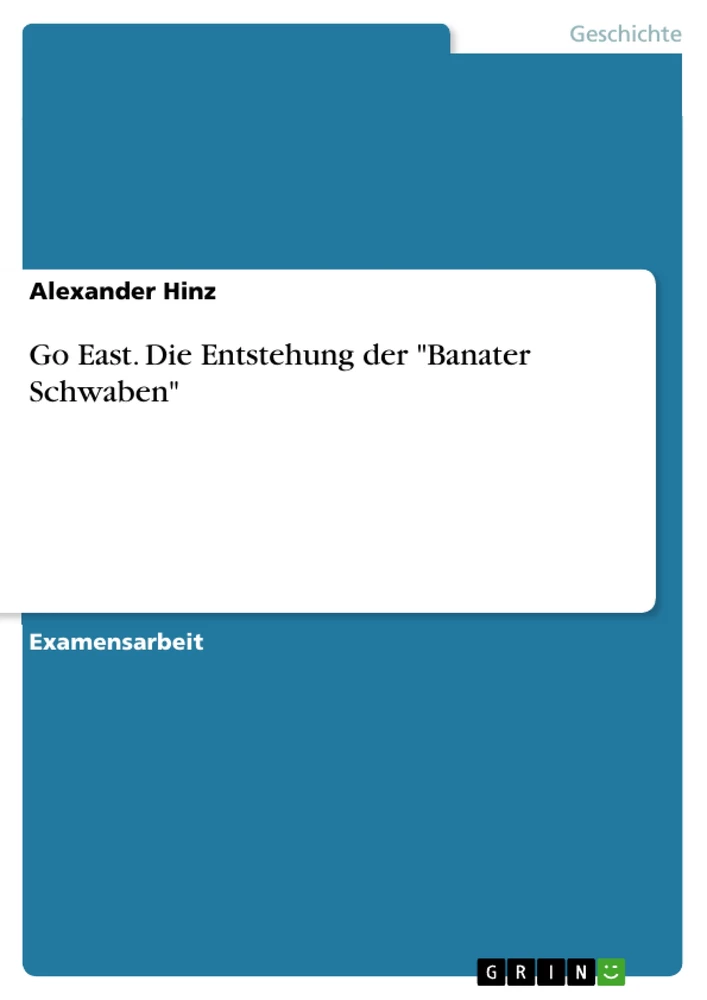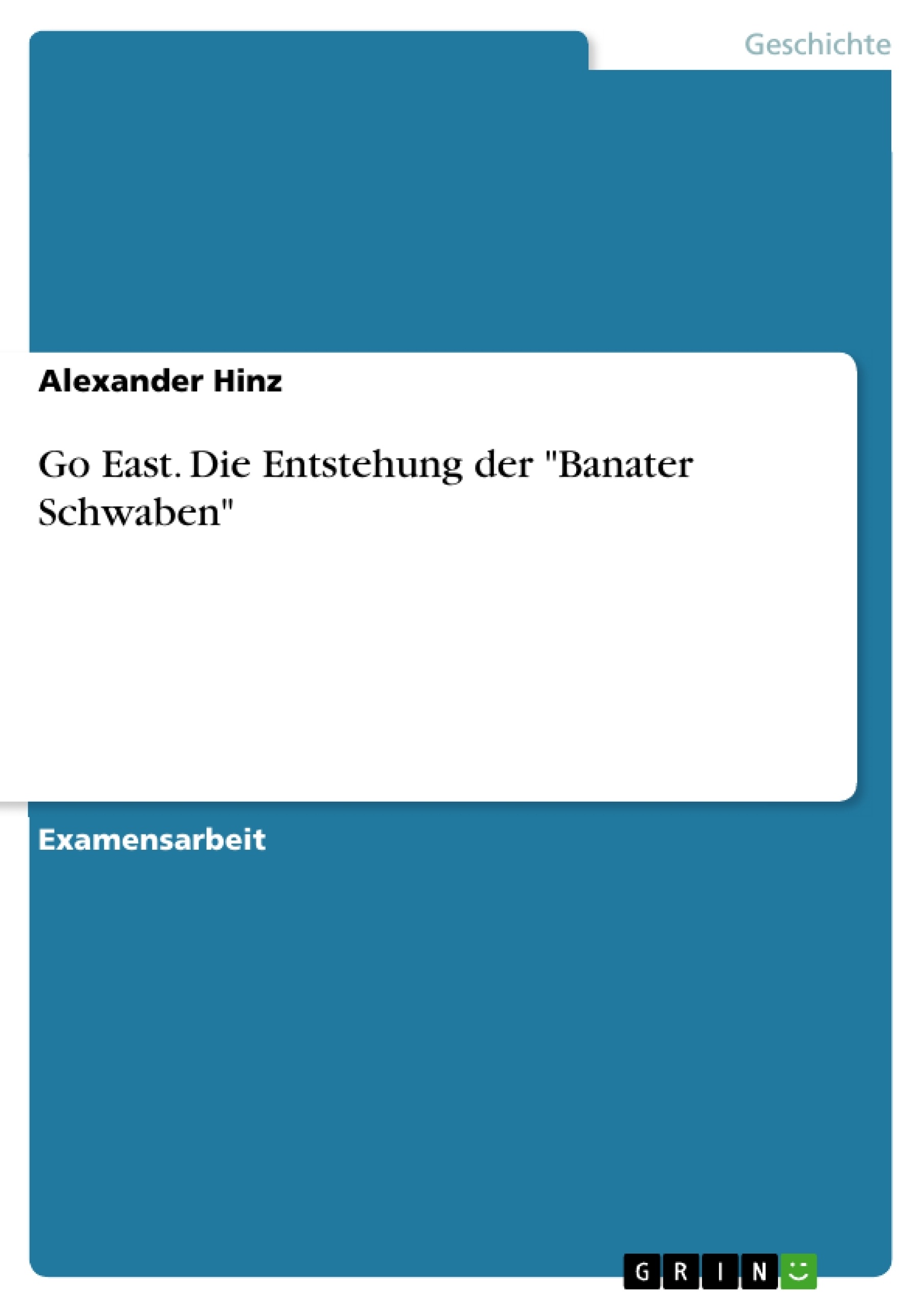Als am 23. August 1944 das mit Nazi-Deutschland verbündete Königreich Rumänien kapitulierte, begann der größte Exodus deutschstämmiger Bevölkerung aus Südost-Europa, der in der Geschichte der Neuzeit seines gleichen sucht. Mit dem Exodus der Donauschwaben aus Rumänien und Jugoslawien endete auch eine mehr als zweihundert Jahre dauernde Epoche der deutschsprachigen Besiedelung des Balkans. Auch wenn einige wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, so wurde das Donauschwabengebiet nie wieder das, was es zur Zeit der Donaumonarchie und während der Zeit des Königreichs Rumänien und des Königreiches Jugoslawien war.
Der Terminus der „Donauschwaben“ wurde 1922 zum ersten Mal von der deutschen Südosteuropaforschung als eine stammeskundliche und siedlungsgeografische, aber auch als eine ethnologische und vor allem als eine historische Gruppenbezeichnung eingeführt. Dieser Sammelbegriff steht genauso wie der Begriff „Siebenbürger Sachsen“ für ein Konglomerat an Menschen, die aus den verschiedensten Teilen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation stammten, wobei die meisten aus den deutschsprachigen Gebieten Oberdeutschland stammten; die Meisten davon aus Schwaben. Diese war die namensgebende Volksgruppe gewesen. Das Ziel dieser innerhabsburgischen Migration war die Bevölkerungszunahme als ein Element merkantilistischer Wirtschaftspolitik. Außerdem wurde das Banat als eine „Vormauer der Christenheit“ gegen die osmanische Gefahr auf dem Balkan angesehen.
In dieser Arbeit soll es vor allem um eine Teilgruppe der Volksgruppe der Donauschwaben gehen, den sog. „Banater Schwaben“. Hierbei werde ich vor allem der Frage nachgehen, was die Beweggründe für die Auswanderung von etlichen Familien aus ihren ursprünglichen Heimaten waren und was sie dazu veranlasste, den beschwerlichen Reiseweg in das Banat über die Donau auf sich zu nehmen, um anschließend in ein ödes Gebiet zu gelangen, dass mehr Arbeit erforderte als ihre heimatlichen Äcker.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Vorwort
- II. Die Quellenlage
- III. Methodik
- IV. Die Entstehung der Banater Schwaben
- 1.) Das Banat wird habsburgisches Kronland
- 2.) Die sogenannten Schwabenzüge
- a) Der,,Erste Schwabenzug“ unter Karl VI.
- b) „Der große Schwabenzug“ unter Maria Theresia
- c) Der „Dritte Schwabenzug“ unter Kaiser Joseph II.
- 3.) Zwischenfazit...
- V. Die Kolonisation des Banats als habsburgische Binnenkolonisation
- 1.) Der Begriff „Binnenkolonisation“
- 2.) Das Banat als Beispiel einer Binnenkolonie ..
- 3.) Zwischenfazit..
- VI. Der Umgang mit Minderheiten bei der Kolonisation des Banats
- 1.) Vorbemerkungen………...
- 2.) Der Umgang mit Minderheiten Anhand zweier Fallbeispielen
- a) Die Ansiedlung spanischer Pensionisten..
- b) Der sog. Temeswarer Wasserschub unter Maria Theresia …....
- 3.) Kurze Bemerkungen zu den anderen Deportationen in den Banat
- 4.) Zwischenfazit..
- VII. Gesamtfazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung der „Banater Schwaben“ und untersucht die Hintergründe und Motivationen für die Auswanderung deutschstämmiger Familien aus ihren ursprünglichen Heimen in das Banat. Sie befasst sich mit den Beweggründen der Habsburger Herrscher für die Kolonisation dieser Region sowie mit der Frage, ob die Kolonisation als Binnenkolonisation innerhalb des Habsburgerreiches betrachtet werden kann. Darüber hinaus befasst sich die Arbeit mit dem Umgang mit Minderheiten während der Kolonisation des Banats und analysiert zwei Fallbeispiele: die Ansiedlung spanischer Pensionisten und den sog. Temeswarer Wasserschub unter Maria Theresia.
- Motivationen für die Auswanderung deutschstämmiger Familien in das Banat
- Beweggründe der Habsburger Herrscher für die Kolonisation des Banats
- Die Kolonisation des Banats als Binnenkolonisation
- Umgang mit Minderheiten während der Kolonisation des Banats
- Analyse von Fallbeispielen: Ansiedlung spanischer Pensionisten und Temeswarer Wasserschub
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das Vorwort befasst sich mit dem Exodus der Donauschwaben aus Rumänien und Jugoslawien und der Geschichte der deutschsprachigen Besiedelung des Balkans. Das Kapitel „Die Quellenlage“ behandelt die verfügbaren Quellen zur Geschichte der Donauschwaben, insbesondere die Quellensammlung von Anton Tafferner. Die Arbeit beschäftigt sich außerdem mit den Herausforderungen bei der Recherche aufgrund der Zerstörung von Archiven im Zweiten Weltkrieg.
Das Kapitel „Die Entstehung der Banater Schwaben“ befasst sich mit den „Schwabenzügen“ unter Karl VI., Maria Theresia und Kaiser Joseph II. und beleuchtet die Motivationen der Migranten für die Reise in das Banat. Das Kapitel „Die Kolonisation des Banats als habsburgische Binnenkolonisation“ behandelt den Begriff der Binnenkolonisation und untersucht, ob die Kolonisation des Banats als Beispiel einer Binnenkolonie betrachtet werden kann.
Im Kapitel „Der Umgang mit Minderheiten bei der Kolonisation des Banats“ werden zwei Fallbeispiele analysiert: die Ansiedlung spanischer Pensionisten und der sog. Temeswarer Wasserschub unter Maria Theresia. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob es sich bei den Deportationen um Maßnahmen der Bevölkerungspolitik oder um militärische Verstärkungen der Grenzregion handelte.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie der Entstehung der „Banater Schwaben“, der Binnenkolonisation, dem Umgang mit Minderheiten und der Analyse von Fallbeispielen wie der Ansiedlung spanischer Pensionisten und dem sog. Temeswarer Wasserschub. Die Arbeit verwendet Begriffe wie „Donauschwaben“, „Schwabenzüge“, „Habsburger“, „Binnenkolonisation“, „Deportationen“, „Bevölkerungspolitik“, „Grenzregion“ und „Minderheitenpolitik“.
- Citar trabajo
- Alexander Hinz (Autor), 2015, Go East. Die Entstehung der "Banater Schwaben", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295878