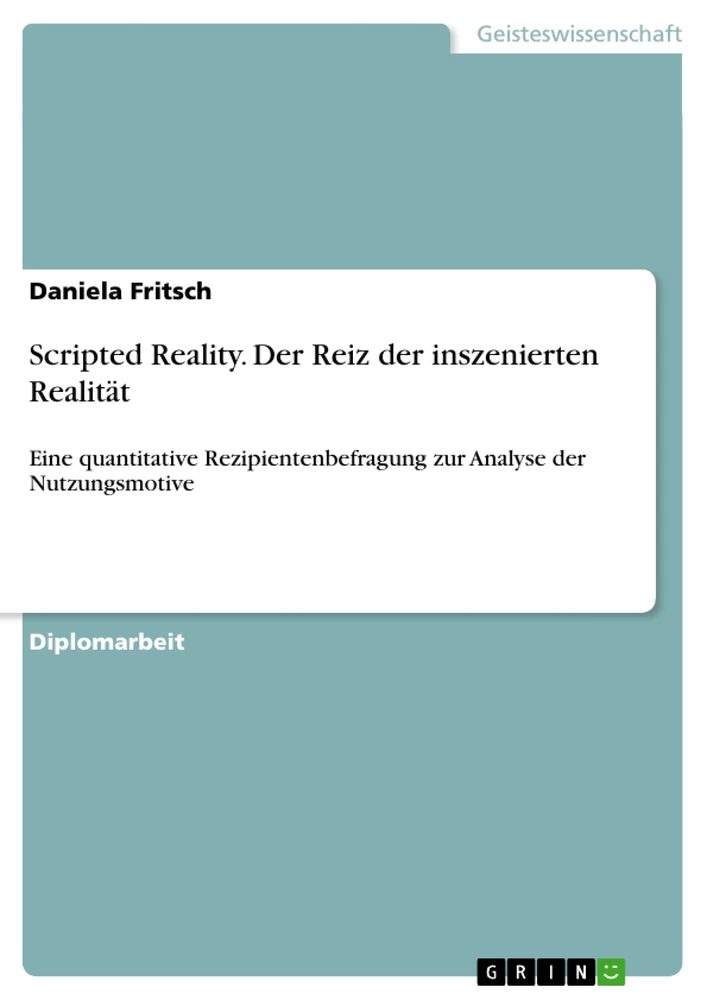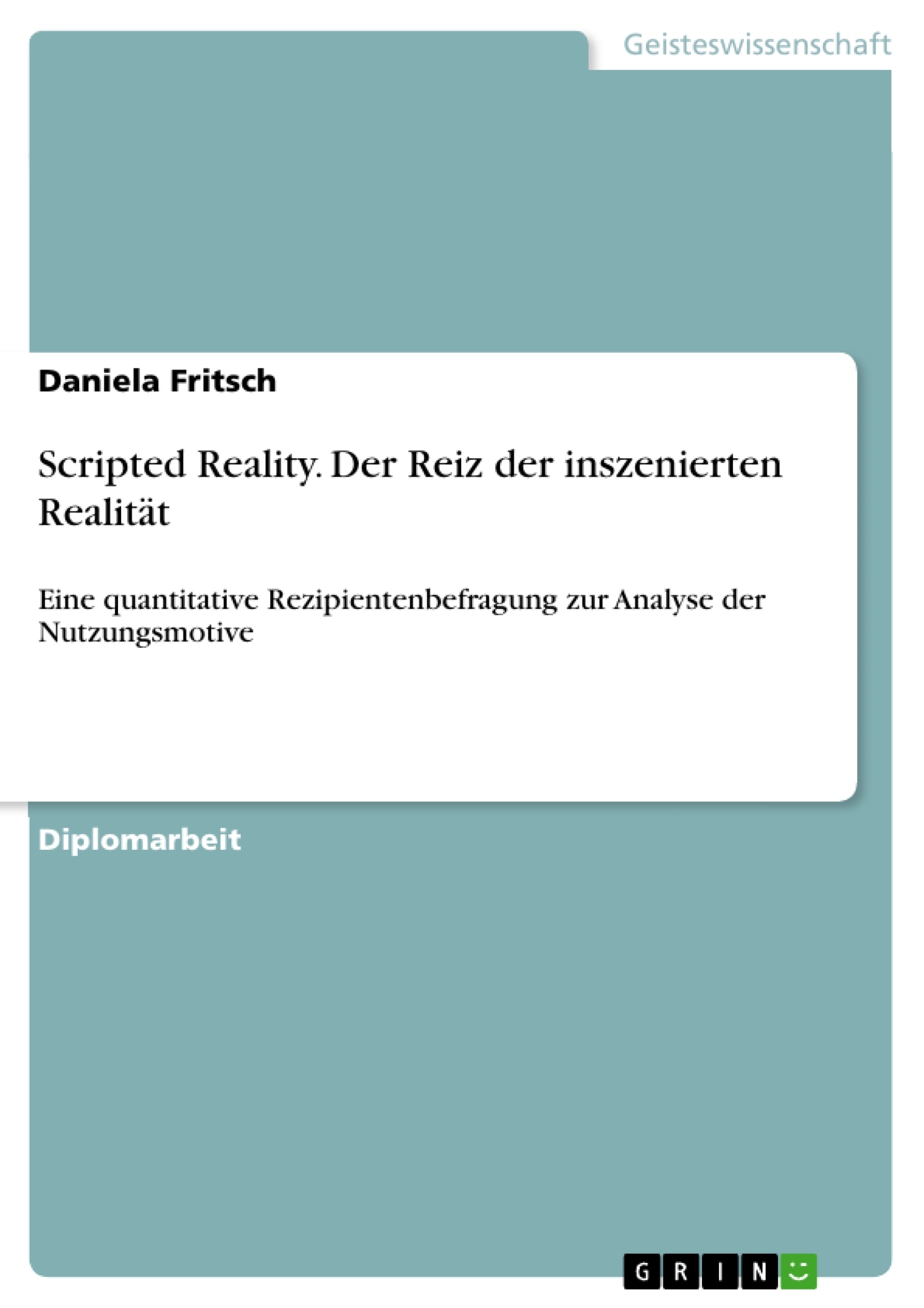Seit geraumer Zeit zeichnet sich auf Seiten der privaten Fernsehsender ein neuer Trend ab. Das Nachmittagsprogramm sowie der Vorabend werden mit einer ganz bestimmten Sendungsart regelrecht überhäuft. Auf den ersten Blick wirken die Inhalte dieser Sendungen wie eine Art Dokumentation und daher real. Im Vor- bzw. Abspann wird mit dem Hinweis „Alle handelnden Personen sind frei erfunden.“ allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass diese Inhalte nicht echt sind, sondern alles gespielt wird. Die Tatsache, dass es sich um inszenierte Fernsehdramen und nach Drehbuch agierende Laiendarsteller handelt, schadet den Formaten jedoch nicht, sie erzielen nicht selten sogar beachtliche Einschaltquoten. Die Rede ist von Scripted Reality.
Wie der Titel dieser wissenschaftlichen Forschungsarbeit bereits ankündigt, besteht das Hauptinteresse darin, Erkenntnisse über die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten zu gewinnen. In Anbetracht des enormen Erfolges dieser Art des Fernsehens stellt sich der Autor in der vorliegenden Untersuchung daher die Frage, welchen Reiz die fiktiven, intimen Geschichten von ihnen unbekannten, frei erfundenen Personen auf die Zuschauer auswirken. Die Rede ist häufig von Voyeurismus, manchmal sogar von moralischem Verfall. Liegt der Zuwendung ein spezifisches individuelles Bedürfnis zugrunde? Oder stellen die Scripted Reality-Formate einfach eine Sendungsform des Realitätsfernsehens dar, die Authentizität bietet und zugleich bestens unterhält und Ablenkung verspricht?
Da die individuelle Fernsehnutzung und die dahinter stehenden Bedürfnisse und Motive der Rezipienten sehr eng mit persönlichen Eigenschaften und Merkmalen verknüpft sind, wird untersucht, welchen Einfluss verschiedene individuelle Faktoren auf die Zuwendung zu Scripted Reality ausüben. So wird nicht nur die Lebenszufriedenheit der Rezipienten, sondern auch deren individuelle Reizsuchetendenz und der soziale Kontext, genauer gesagt der Umfang an interpersoneller Interaktion, ins Auge gefasst. Dabei wird zusätzlich das allgemeine Fernsehverhalten der Rezipienten und dessen Auswirkung auf den Scripted Reality-Konsum untersucht. Das Forschungsinteresse bezieht sich demzufolge nicht nur auf die Aspekte, die den Konsum dieser Formate motivieren, sondern liegt auch darin, inwieweit sich die Nutzungsmotivation innerhalb des Publikums unterscheidet und durch welche Faktoren diese beeinflusst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergrund und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Scripted Reality als Teilbereich des Reality TV
- 2.1 Der Ursprung des Fernsehgenre Reality TV
- 2.2 Einordnung innerhalb des Reality TV
- 2.3 Charakteristische Merkmale des Scripted Reality
- 2.4 Scripted Reality-Formate im deutschen Fernsehen
- 3 Medienwirkungsforschung
- 3.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
- 3.1.1 Konzept und Ursprung
- 3.1.2 Prozessmodelle und Weiterentwicklungen
- 3.1.3 Kritik am Uses-and-Gratifications-Ansatz
- 3.2 Fernsehnutzungsmotive in der Uses-and-Gratifications-Forschung
- 3.2.1 Bedürfnisse und Motive
- 3.2.2 Motivkataloge
- 3.2.3 Instrumentelle und ritualisierte Mediennutzung
- 3.2.4 Das Eskapismus-Konzept
- 3.2.5 Das Konzept der parasozialen Interaktion
- 3.3 Zwischenfazit
- 3.4 Der Einfluss verschiedener Faktoren auf die Fernsehnutzung
- 3.4.1 Soziodemographie
- 3.4.2 Individuelle Merkmale
- 3.4.2.1 Sensation Seeking
- 3.4.2.2 Interpersonelle Interaktion und Einsamkeit
- 3.4.2.3 Lebenszufriedenheit
- 3.4.3 Allgemeine Fernsehgewohnheiten
- 3.5 Empirische Forschungsergebnisse zu Reality TV und Scripted Reality
- 4 Empirischer Teil
- 4.1 Forschungsfragen
- 4.2 Hypothesen
- 4.3 Untersuchungsdesign: Online-Fragebogen
- 4.4 Aufbau des Fragebogens
- 4.4.1 Konzeption des Fragebogens
- 4.4.2 Fernsehgewohnheiten
- 4.4.2.1 Fernsehdauer und Fernsehnutzungssituation
- 4.4.2.2 TV-Genrepräferenzen
- 4.4.2.3 Fernsehverhalten
- 4.4.3 Fernsehverhalten in Bezug auf Scripted Reality
- 4.4.3.1 Nutzung von Scripted Reality-Formaten
- 4.4.3.2 Nutzungsmotive
- 4.4.3.3 Online-Aktivität
- 4.4.4 Individuelle Merkmale
- 4.4.4.1 Sensation Seeking
- 4.4.4.2 Interpersonelle Interaktion
- 4.4.4.3 Lebenszufriedenheit
- 4.4.5 Soziodemographische Daten
- 4.5 Durchführung der empirischen Studie
- 4.5.1 Pretest
- 4.5.2 Online-Befragung
- 4.5.3 Stichprobe
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Deskriptivstatistische Beschreibung der Stichprobe
- 5.1.1 Soziodemographische Beschreibung der Stichprobe
- 5.1.2 Allgemeine Fernsehgewohnheiten der Befragten
- 5.1.3 Angaben zur Scripted Reality-Nutzung
- 5.1.4 Angaben zu den individuellen Merkmalen
- 5.2 Verifikation und Falsifikation der Hypothesen
- 5.2.1 Identifikation der Nutzungsmotive der Scripted Reality-Rezipienten
- 5.2.2 Befunde zur Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 1a bis 1c)
- 5.2.3 Der Einfluss soziodemographischer Daten auf die Scripted Reality-Sehdauer (Hypothese 2a bis 2c)
- 5.2.4 Der Einfluss soziodemographischer Daten auf die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 2d und 2e)
- 5.2.5 Der Einfluss des Merkmals Sensation Seeking auf die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 3a bis 3c)
- 5.2.6 Der Einfluss des Umfangs an interpersoneller Interaktion auf die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 4a bis 4e)
- 5.2.7 Der Einfluss der Lebenszufriedenheit auf die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 5a bis 5c)
- 5.2.8 Der Einfluss allgemeiner Fernsehgewohnheiten auf die Scripted Reality-Sehdauer (Hypothese 6a)
- 5.2.9 Der Einfluss allgemeiner Fernsehgewohnheiten auf die Nutzungsmotivation der Scripted Reality-Rezipienten (Hypothese 6b und 6c)
- 5.3 Übersicht der Ergebnisse der Hypothesenprüfung
- 5.4 Vergleich der Einflüsse auf die Zuwendung zu Scripted Reality
- 6 Resümee
- 6.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- 6.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Nutzungsmotive von Scripted-Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Ziel ist es, mithilfe einer quantitativen Rezipientenbefragung die Gründe für den Konsum dieser Sendungen zu ergründen und den Einfluss verschiedener Faktoren (soziodemografische Merkmale, persönliche Eigenschaften wie Sensation Seeking und Lebenszufriedenheit, sowie allgemeine Fernsehgewohnheiten) auf die Nutzung zu analysieren.
- Nutzungsmotive von Scripted Reality Formaten
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Rezeption
- Rolle individueller Merkmale (z.B. Sensation Seeking, Lebenszufriedenheit)
- Zusammenhang zwischen allgemeinen Fernsehgewohnheiten und Scripted Reality Konsum
- Anwendung des Uses-and-Gratifications-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein. Es beschreibt den Hintergrund und die Zielsetzung der Arbeit, welche die Nutzungsmotive von Scripted Reality Formaten im deutschen Fernsehen untersucht. Der Aufbau der Arbeit wird skizziert, um dem Leser einen klaren Überblick über den weiteren Verlauf zu geben. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas im Kontext der Medienwirkungsforschung und des wachsenden Einflusses von Reality-TV im deutschen Fernsehprogramm.
2 Scripted Reality als Teilbereich des Reality TV: Dieses Kapitel definiert Scripted Reality und grenzt es von anderen Reality-TV-Formaten ab. Es beleuchtet den Ursprung des Reality-TV Genres, ordnet Scripted Reality innerhalb dieser Genrelandschaft ein und beschreibt seine charakteristischen Merkmale, die es von rein dokumentarischen oder fiktionalen Formaten unterscheiden. Schließlich werden Beispiele für Scripted Reality Formate im deutschen Fernsehen vorgestellt und analysiert, um die Verbreitung und Popularität des Genres zu verdeutlichen.
3 Medienwirkungsforschung: Dieses Kapitel stellt die theoretische Grundlage der Arbeit dar. Der Fokus liegt auf dem Uses-and-Gratifications-Ansatz, der die aktiven Bedürfnisse und Motive der Rezipienten in den Mittelpunkt der Mediennutzung rückt. Das Kapitel erläutert das Konzept, seine Entstehungsgeschichte und Weiterentwicklungen sowie die damit verbundene Kritik. Es werden verschiedene Fernsehnutzungsmotive im Detail beleuchtet, einschließlich Eskapismus und parasozialer Interaktion. Der Einfluss soziodemografischer Merkmale, individueller Eigenschaften und allgemeiner Fernsehgewohnheiten auf die Mediennutzung wird ebenfalls ausführlich diskutiert. Das Kapitel schließt mit einem Zwischenfazit und bereitet den empirischen Teil der Arbeit vor.
4 Empirischer Teil: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten quantitativen Rezipientenbefragung. Es werden die Forschungsfragen und Hypothesen vorgestellt, die im Rahmen der Studie untersucht wurden. Das Kapitel detailliert das Untersuchungsdesign, den Aufbau des Online-Fragebogens, und die verwendeten Messinstrumente zur Erfassung der Nutzungsmotive, soziodemografischer Daten, und persönlicher Merkmale der Befragten. Die Durchführung der Studie, einschließlich Pretest und Online-Befragung, sowie die Zusammensetzung der Stichprobe werden präzise dargestellt.
Schlüsselwörter
Scripted Reality, Reality TV, Nutzungsmotive, Uses-and-Gratifications-Ansatz, quantitative Rezipientenbefragung, Medienwirkungsforschung, Sensation Seeking, Interpersonelle Interaktion, Lebenszufriedenheit, Soziodemographie, Fernsehgewohnheiten, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Nutzungsmotive von Scripted-Reality-Formaten im deutschen Fernsehen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Nutzungsmotive von Scripted-Reality-Formaten im deutschen Fernsehen. Sie analysiert, warum Menschen diese Sendungen schauen und welche Faktoren (soziodemografische Merkmale, Persönlichkeitseigenschaften, Fernsehgewohnheiten) den Konsum beeinflussen.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine quantitative Rezipientenbefragung mittels Online-Fragebogen durchgeführt. Der Fragebogen erfasste Nutzungsmotive, soziodemografische Daten, persönliche Merkmale (z.B. Sensation Seeking, Lebenszufriedenheit) und allgemeine Fernsehgewohnheiten.
Welcher theoretische Ansatz wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Uses-and-Gratifications-Ansatz der Medienwirkungsforschung. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die aktiven Bedürfnisse und Motive der Rezipienten und deren Einfluss auf die Mediennutzung.
Welche Faktoren werden untersucht?
Die Studie analysiert den Einfluss folgender Faktoren auf die Nutzung von Scripted-Reality-Formaten: Soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung etc.), individuelle Merkmale (Sensation Seeking, Interpersonelle Interaktion, Lebenszufriedenheit) und allgemeine Fernsehgewohnheiten.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden behandelt?
Die Arbeit formuliert spezifische Forschungsfragen und Hypothesen zu den Nutzungsmotiven von Scripted Reality und dem Einfluss der oben genannten Faktoren. Diese werden im empirischen Teil der Arbeit mithilfe der erhobenen Daten überprüft.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Einordnung von Scripted Reality im Reality-TV, theoretische Grundlagen (Uses-and-Gratifications), empirischer Teil (Methoden, Ergebnisse), Diskussion der Ergebnisse und Resümee/Ausblick.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der quantitativen Analyse werden deskriptivstatistisch dargestellt und im Hinblick auf die formulierten Hypothesen interpretiert. Es wird untersucht, welche Nutzungsmotive vorherrschen und wie die untersuchten Faktoren diese beeinflussen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselbegriffe?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Scripted Reality, Reality TV, Nutzungsmotive, Uses-and-Gratifications-Ansatz, quantitative Rezipientenbefragung, Sensation Seeking, Interpersonelle Interaktion, Lebenszufriedenheit, Soziodemographie, Fernsehgewohnheiten.
Was ist Scripted Reality?
Scripted Reality ist ein Teilbereich des Reality-TV, der sich durch eine Mischung aus inszenierten und realen Elementen auszeichnet. Im Gegensatz zu rein dokumentarischen Formaten ist der Verlauf der Handlung zumindest teilweise vorbestimmt oder beeinflusst.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studierende der Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und verwandter Disziplinen, die sich mit dem Thema Reality-TV, Mediennutzung und Medienwirkungsforschung beschäftigen.
- Citation du texte
- Diplom Sozialwissenschaftlerin Daniela Fritsch (Auteur), 2013, Scripted Reality. Der Reiz der inszenierten Realität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295210