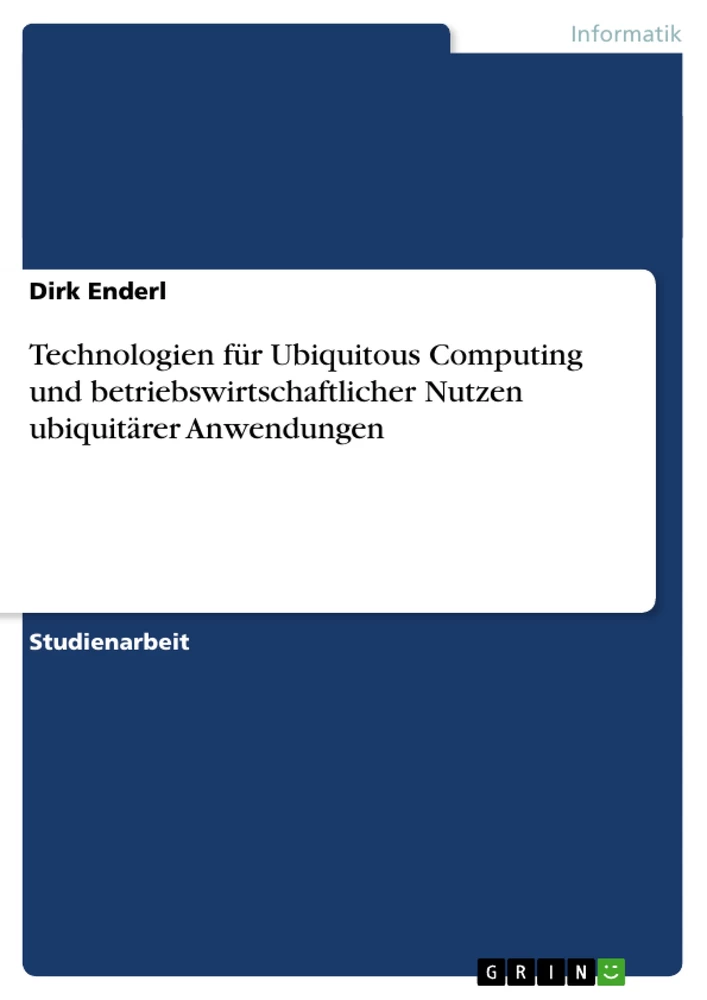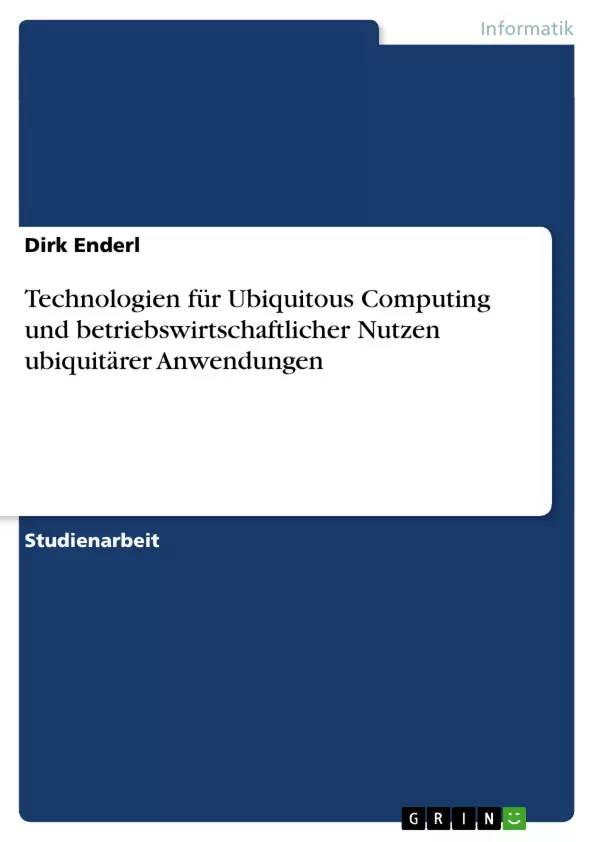Der Begriff des Ubiquitous Computing wurde bereits Anfang der 1990er Jahre geprägt und von Mark Weiser in seinem Beitrag The Computer for the 21st Century beschrieben1. Weiser, damals Wissenschaftler am renommierten Xerox Palo Alto Research Center (heute PARC), in Palo Alto, Kalifornien, propagierte in seinem Artikel den allgegenwärtigen Computer, der unsichtbar und unaufdringlich den Menschen bei seinen Tätigkeiten unterstützt und ihn von lästigen Routineaufgaben weitestgehend befreit. Dabei sieht er die Technik, als pures Mittel zum Zweck, die in den Schatten tritt, um eine Fokussierung auf das Wesentliche an sich, zu ermöglichen – der PC, ein heute weitverbreitetes universelles Werkzeug, sei für diesen Zweck ungeeignet, da dieser aufgrund seiner Komplexität, die Konzentration des Anwenders zu sehr auf sich ziehe. Nach seiner Überzeugung sollte der Computer als Gerät an sich verschwinden, jedoch seine informationsverarbeitende Funktionalität erhalten bleiben und überall verfügbar sein.2 Seine Gedanken und Visionen wurden damals als Schwärmereien, fern der Realität und als technische Utopie belächelt. Seine Vorstellungen von immer kleineren, mobilen und leicht zu bedienenden, fast unsichtbaren Computern, die miteinander kommunizieren, machten ihn mit Recht zum Vater des Ubiquitous Computing.3 Die technologischen Entwicklungen und Fortschritte in der Mikroelektronik und Kommunikationstechnik1, haben heute einen Entwicklungsstand erreicht an dem es möglich geworden ist, kleinste Systeme und Sensoren in Dinge des Alltags zu integrieren und ihnen auf diese Weise zu einem – intelligenten – oder besser smarten Verhalten2 zu verhelfen. Verschiedene Prototypen befinden sich in ersten Testphasen oder sind bereits schon heute erfolgreich implementiert. 1 Weiser, M., The Computer for the 21st Century, Scientific American, September 1991, 265(3), (S. 94-104) alternativ http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html (18-11-2003 22:01) 2 vgl. dazu Mattern, F., Total Vernetzt., Springer Verlag, Berlin, 2003, (S. 3) 3 aus Sauerburger, H. (Hrsg.), Editorial zu HMD 229, Praxis der Wirtschaftsinformatik, dpunkt.verlag, Heidelberg, 2003, (S. 1)
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Ubiquitous Computing
- Vision
- Definition
- Technologien
- Moore's Law
- Drahtlose Sensornetze & Smart Dust
- Radio Frequency Identification - RFID
- Elektronische Tinte & Smartes Papier
- E-Ink Technologie
- Gyricon Technologie
- Betriebswirtschaftlicher Nutzen
- Ubiquitäre Anwendungsbeispiele
- Kanban-Bestellsystem
- Transportlogistik
- Kühlkettenmanagement
- Prozessmodell
- Ubiquitäre Anwendungsbeispiele
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Technologien des Ubiquitous Computing und deren betriebswirtschaftlichen Nutzen. Ziel ist es, ein Verständnis für die zugrundeliegenden Technologien und deren Anwendungspotenzial in verschiedenen Bereichen zu schaffen.
- Technologien des Ubiquitous Computing (z.B. RFID, drahtlose Sensornetze)
- Vision und Definition von Ubiquitous Computing
- Betriebswirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten
- Beispiele für ubiquitäre Anwendungen in verschiedenen Branchen
- Prozessmodelle zur Integration von Ubiquitous Computing in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Diese Einleitung dient der Vorstellung des Themas Ubiquitous Computing und seiner Relevanz für die Betriebswirtschaft. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf behandelt werden. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen technologischem Fortschritt und wirtschaftlichem Nutzen.
Ubiquitous Computing: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept des Ubiquitous Computing. Es beschreibt die Vision einer allgegenwärtigen, nahtlosen Integration von Technologie in den Alltag und definiert die Kernmerkmale dieses Paradigmas. Es analysiert verschiedene Schlüsseltechnologien, die das Ubiquitous Computing ermöglichen, darunter Moore's Law, drahtlose Sensornetze, RFID-Systeme und elektronische Tinte. Die einzelnen Technologien werden detailliert vorgestellt, und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile werden diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der technischen Grundlagen und der Darstellung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Technologien.
Betriebswirtschaftlicher Nutzen: Dieses Kapitel untersucht den betriebswirtschaftlichen Nutzen von Ubiquitous Computing Anwendungen. Es präsentiert verschiedene Anwendungsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen, wie z.B. ein Kanban-Bestellsystem, Transportlogistik und Kühlkettenmanagement. Für jedes Beispiel werden die konkreten Vorteile und die damit verbundenen Effizienzsteigerungen im Detail erläutert. Zusätzlich wird ein generisches Prozessmodell entwickelt, das die Integration von Ubiquitous Computing in bestehende Geschäftsprozesse beschreibt. Der Fokus liegt auf der Quantifizierung des wirtschaftlichen Nutzens und der Darstellung der Implementierungsaspekte.
Schlüsselwörter
Ubiquitous Computing, RFID, drahtlose Sensornetze, Moore's Law, elektronische Tinte, betriebswirtschaftlicher Nutzen, Anwendungsbeispiele, Prozessmodell, Effizienzsteigerung, Transportlogistik, Kühlkettenmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Ubiquitous Computing und sein betriebswirtschaftlicher Nutzen
Was ist der Gegenstand dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Technologien des Ubiquitous Computing und deren betriebswirtschaftlichen Nutzen. Ziel ist es, ein Verständnis für die zugrundeliegenden Technologien und deren Anwendungspotenzial in verschiedenen Bereichen zu schaffen.
Welche Technologien des Ubiquitous Computing werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Schlüsseltechnologien, darunter Moore's Law, drahtlose Sensornetze, RFID-Systeme und elektronische Tinte (E-Ink und Gyricon Technologie). Die einzelnen Technologien werden detailliert vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
Wie wird Ubiquitous Computing definiert und welche Vision steht dahinter?
Die Arbeit beschreibt die Vision einer allgegenwärtigen, nahtlosen Integration von Technologie in den Alltag und definiert die Kernmerkmale dieses Paradigmas. Der Fokus liegt auf der Erklärung der technischen Grundlagen und der Darstellung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Technologien.
Welche betriebswirtschaftlichen Anwendungen von Ubiquitous Computing werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Branchen, wie z.B. ein Kanban-Bestellsystem in der Produktionslogistik, Anwendungen in der Transportlogistik und im Kühlkettenmanagement. Für jedes Beispiel werden die konkreten Vorteile und die damit verbundenen Effizienzsteigerungen im Detail erläutert.
Wie wird der betriebswirtschaftliche Nutzen quantifiziert?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Quantifizierung des wirtschaftlichen Nutzens und die Darstellung der Implementierungsaspekte von Ubiquitous Computing. Ein generisches Prozessmodell beschreibt die Integration von Ubiquitous Computing in bestehende Geschäftsprozesse.
Welche Kapitel umfasst die Studienarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Ubiquitous Computing, ein Kapitel zum betriebswirtschaftlichen Nutzen und einen Ausblick. Die Einführung stellt das Thema vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel zu Ubiquitous Computing bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept und die Schlüsseltechnologien. Das Kapitel zum betriebswirtschaftlichen Nutzen analysiert Anwendungsbeispiele und deren Effizienzsteigerungen. Der Ausblick gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ubiquitous Computing, RFID, drahtlose Sensornetze, Moore's Law, elektronische Tinte, betriebswirtschaftlicher Nutzen, Anwendungsbeispiele, Prozessmodell, Effizienzsteigerung, Transportlogistik, Kühlkettenmanagement.
- Citar trabajo
- Dirk Enderl (Autor), 2004, Technologien für Ubiquitous Computing und betriebswirtschaftlicher Nutzen ubiquitärer Anwendungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29403