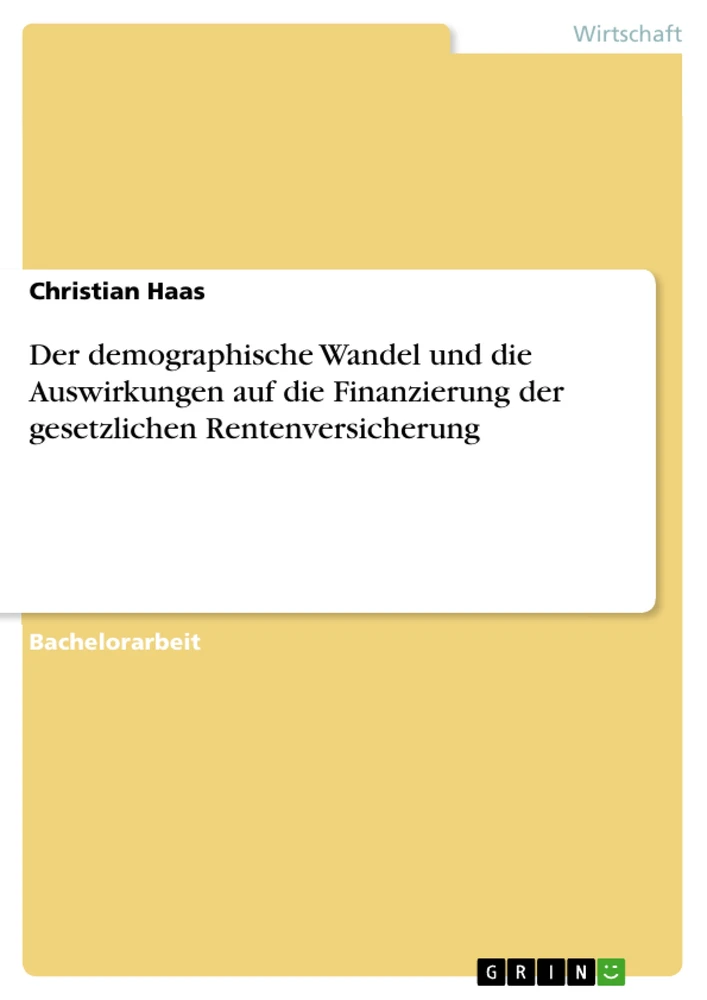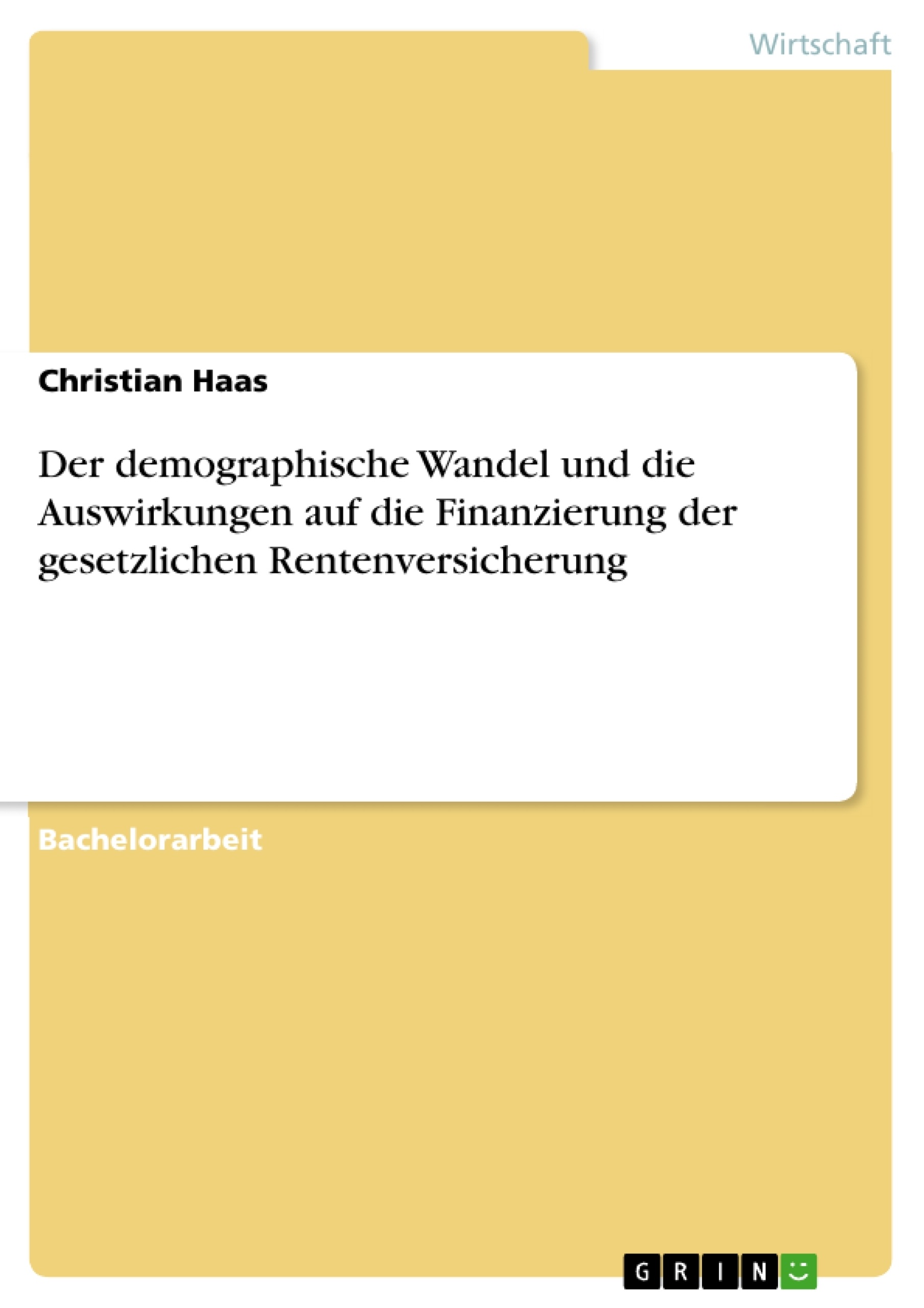Es ist unstrittig, dass die deutsche Bevölkerung aufgrund des demographischen Wandels in der Zukunft aus mehr älteren und weniger jüngeren Menschen bestehen wird. Dies wirft immer wieder die Frage auf, welche Konsequenzen diese Entwicklung für den Sozialstaat und die einzelnen Felder der sozialen Sicherung haben wird. Auch wenn viele Wissenschaftler schon zu Beginn der 1980-Jahre auf den demographischen Wandel hinwiesen, so ist er doch erst seit wenigen Jahren Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Diese dreht sich gerade in jüngster Zeit vor allem um die Frage, wie in Deutschland die Renten gesichert werden können (Frevel, 2004, S. 7f). Die heutigen Bevölkerungsprognosen, die von einer Fortschreibung der aktuellen Bedingungen aus-gehen, deuten darauf hin, dass künftig eine Sozialstruktur entstehen wird, die problema-tisch für das heutige Sozialsystem ist. Klar ist, dass nachhaltige Umbrüche im sozialen System einsetzen müssen, die als Chance betrachtet werden sollen, den demographi-schen Wandel selbst und seine Folgen zu gestalten. Dies betrifft auch die gesetzliche Rentenversicherung (GRV), die derzeit im Umlageverfahren finanziert wird und Ge-genstand der vorliegenden Arbeit ist. Die zunehmend höhere Lebenserwartung, der Ge-burtenrückgang, aber auch die Mobilität sind Faktoren, welche die Alterssicherung maßgeblich beeinflussen. Die demographische Herausforderung besteht in längeren Rentenzahlungen und einem Rückgang der Beitragszahler, was dazu führt, dass „immer weniger Jüngere die Leistung für immer mehr Ältere aufbringen [müssen]“ (BMGS, 2003, S. 51). Der demographische Wandel spielt also eine zentrale Rolle in der Finan-zierungsperspektive der gesetzlichen Rentenversicherung, denn die Veränderung der Bevölkerungsstruktur trifft besonders die umlagefinanzierten Systeme, bei denen es aufgrund der Verletzung der Generationengerechtigkeit zu Verteilungskonflikten zwi-schen jungen und alten Menschen kommt. Eine wichtige Rolle in dieser Debatte spielt der Altenquotient, der das Verhältnis der Zahl der über 65-Jährigen zur Zahl der Perso-nen im Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren berechnet (Bäcker/Kistler/Rehfeld, 2014a, S. 1). Er ist das zentrale Kriterium bei der Frage nach der Finanzierbarkeit der Alterssicherung im Allgemeinen und der Rentenversicherung im Besonderen. Daneben ist es auch eine Frage der ökonomischen Rahmenbedingungen, wie die demographische Nachhaltigkeit gestaltet werden muss, denn auch die zukünftige Entwicklung der Er-werbsbetei
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Forschungsgegenstand
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Aktuelle Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung
- 2.1 Aufgaben
- 2.2 Versichertenkreis
- 2.3 Finanzierung
- 2.4 Leistungen und Ziele
- 2.5 Rentenformel
- 2.6 Die Riester-Rente
- 3. Zukünftige Problematik
- 3.1 Der demographische Wandel
- 3.2 Entwicklung des Altenquotienten
- 3.3 Entwicklung des Finanzierungssystems
- 3.3.1 Auswirkungen auf der Einnahmenseite
- 3.3.2 Auswirkungen auf der Ausgabenseite
- 3.4 Beitragssatzentwicklung
- 4. Alternative Finanzierungsmethoden
- 4.1 Umlageverfahren
- 4.1.1 Das Modell
- 4.1.2 Kritik und zukünftige Problematik
- 4.1.3 Reformansätze
- 4.1.3.1 Anhebung des Renteneintrittsalters
- 4.1.3.2 Ausweitung des versicherungspflichtigen Personenkreises
- 4.1.3.3 Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze
- 4.2 Kapitaldeckungsverfahren
- 4.2.1 Das Modell
- 4.2.2 Vor- und Nachteile
- 4.2.3 Umstellung von UV auf KDV
- 4.3 Steuerfinanzierte Grundrente
- 5. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der zukünftigen Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung im Kontext des demographischen Wandels. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich aus der alternden Gesellschaft ergeben, und beleuchtet verschiedene Reformansätze, um die nachhaltige Finanzierung des Rentensystems zu gewährleisten.
- Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Die Entwicklung des Altenquotienten und seine Bedeutung für die Finanzierung
- Alternative Finanzierungsmodelle: Umlageverfahren, Kapitaldeckungsverfahren, Steuerfinanzierte Grundrente
- Reformansätze zur Sicherung der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherung
- Die Rolle der Rentenversicherung im Kontext der Altersvorsorge
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung ein. Sie definiert den Forschungsgegenstand und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die aktuelle Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenversicherung, ihre Aufgaben, den Versichertenkreis, die Finanzierung, die Leistungen und Ziele sowie die Rentenformel und die Riester-Rente. Kapitel 3 analysiert die zukünftige Problematik der Rentenversicherung im Kontext des demographischen Wandels und betrachtet die Entwicklung des Altenquotienten und die Auswirkungen auf das Finanzierungssystem, insbesondere auf die Einnahmen- und Ausgabenseite. Zudem wird die Beitragssatzentwicklung untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit alternativen Finanzierungsmethoden wie dem Umlageverfahren, dem Kapitaldeckungsverfahren und der steuerfinanzierten Grundrente. Dabei werden die jeweiligen Modelle, ihre Vor- und Nachteile sowie mögliche Reformansätze betrachtet. Kapitel 5 bietet einen Ausblick auf die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung.
Schlüsselwörter
Der demographische Wandel, die gesetzliche Rentenversicherung, Finanzierung, Altenquotient, Umlageverfahren, Kapitaldeckungsverfahren, Reformansätze, Beitragssatzentwicklung, Altersvorsorge, Steuerfinanzierte Grundrente, Rentenformel, Riester-Rente.
- Citation du texte
- Christian Haas (Auteur), 2015, Der demographische Wandel und die Auswirkungen auf die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293517