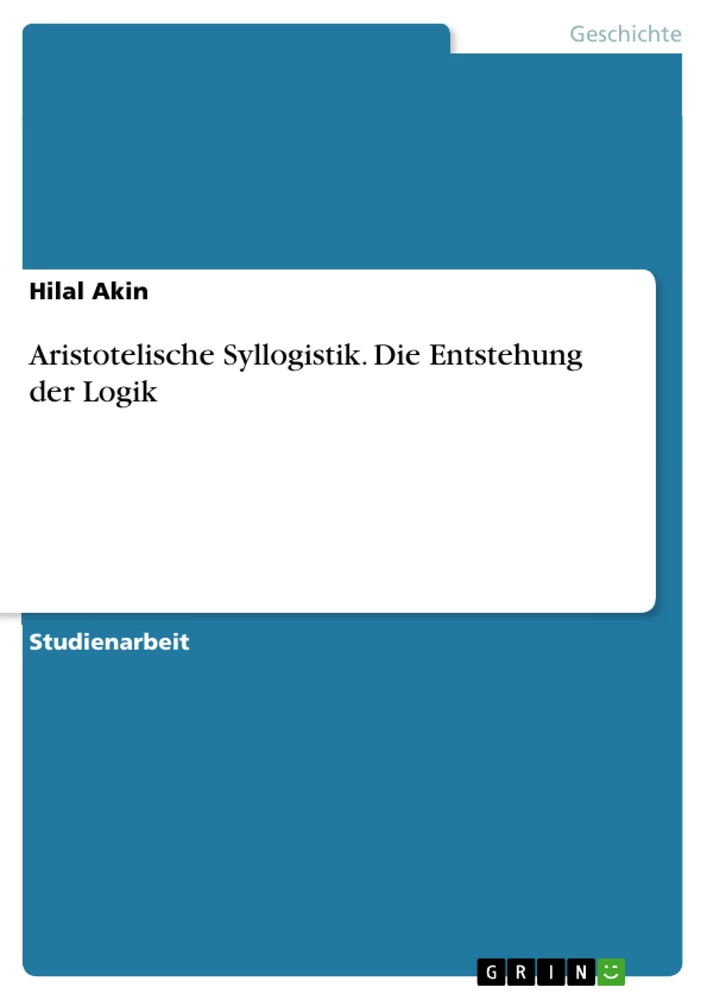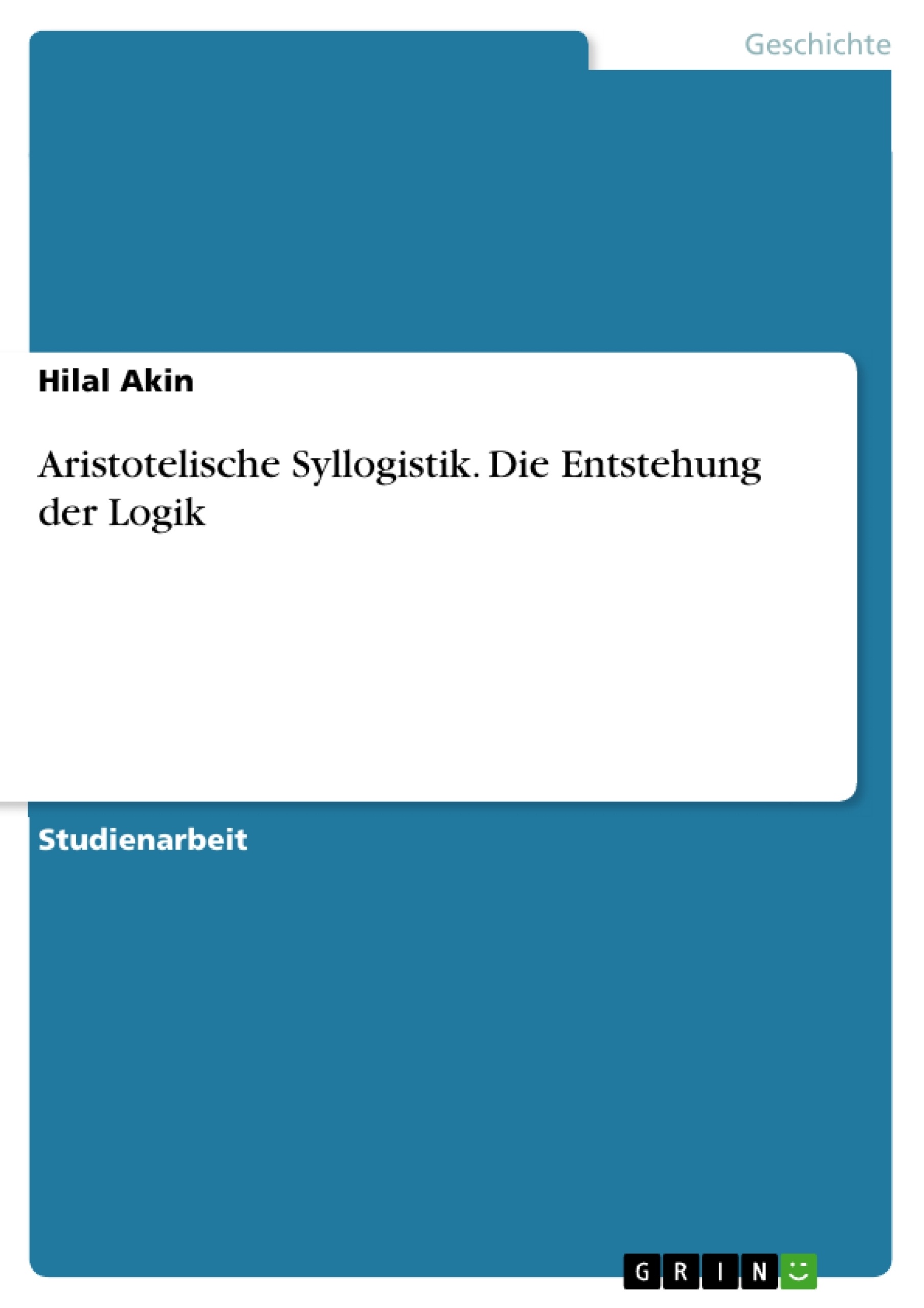Aristoteles (382-322 v. Chr.) gilt als der Logiker der Antike. Das Konzept seiner Logik, die Syllogistik, ist eine einfache Grundform dessen, was heute Prädikatenlogik genannt wird. Er
formulierte sein Konzept zu einer Zeit, als die griechische Antike bereits über eine entwickelte Kultur der beweisenden Mathematik verfügte.
Obwohl die aristotelische Logiksicherlich durch die Kultur des strengen Schließens in der beweisenden Mathematik
inspiriert wurde, sieht er selbst die Anwendungsbereiche seiner Logik eher als ein Instrument, das die Qualität des Argumentierens in allen Bereichen verbessern kann. Er
strebte danach, die Sichtweisen anderer Gelehrten umfassend zur Kenntnis zu nehmen. Ein Gelehrter musste sich nicht nur von den Bindungen der Tradition befreien, sondern auch
diese Freiheit mit intellektueller Disziplin nutzen. Er sah das Streben des Menschen nach Wissen in der Natur und die Grundlage der Weisheit war das Deuten und Verstehen von
Erfahrungen. Philosophieren war für ihn die höchstrangige Form des klugen Verstandesgebrauchs, aber keineswegs die einzige, da er in den Einzelwissenschaften die Ergänzung zur Philosophie sah. Die Ideenlehre des Platon wird von Aristoteles kritisiert. Er lehnt die These, dass bei den Objekte der Erfahrungswelt nur dann Ähnlichkeiten erkannt wird, wenn sie an derselben, immateriell existierenden Idee teilhaben. Ein Großteil des heutigen philosophischen Vokabulars geht auf Aristoteles zurück.
Der Fokus dieser Arbeit gilt der Entstehung des Syllogismus und unter welchen Bedingungen und Einflüssen dies geschah. Heinrich Maier vertritt die Auffassung, dass die Syllogistik das Ergebnis einer eristischen Epoche sei. Seine Entdeckung fiele in eine Zeit, in der die Wissenschaft um ihre Existenz kämpfen musste. Von dieser Stimmung spürt man in Aristoteles logisch-dialektischen Schriften wenig. Er zeigt dem Leser über die Sphäre der dialektischen Wahrscheinlichkeit eine streng methodische Wissenschaft. Die Grundannahme ist also, dass die Syllogistik ein rein technisch-methodisches Verfahren ist und ihren Ursprung in der Eristik hat mit einer implizierten doppelten Methode. Zum einen die Dialektik als Verfahren für die wissenschaftliche Untersuchung und zum anderen eine
Methode für die Erzielung eines strengen und notwendigen Wissens.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die philosophische Lage im 4. Jahrhundert v. Chr.
- 2.1 Sophisten und Eristiker
- 2.2 Die megarische Skepsis
- 2.3 Antisthenes Negation
- 2.4 Der protagoreische Relativismus
- 2.5 Philosophische Gesamtstimmung
- 3. Die Methodologie Platons
- 3.1 Kampf gegen die Skepsis
- 3.2 Die Dialektik
- 3.3 Logisch-metaphysische Grundlage
- 3.4 Grundzüge der dialektischen Methode
- 4. Die Entdeckung des Syllogismus
- 4.1 Aristoteles zur Rhetorik und Meinungsdialektik
- 4.2 Veränderter methodologischer Zustand
- 5. Der Syllogismus
- 5.1 Erkenntnistheoretische-metaphysische Grundlegung des Denkens
- 5.2 Was ist die Syllogistik?
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des aristotelischen Syllogismus und die Bedingungen und Einflüsse, die seine Entwicklung prägten. Sie beleuchtet den Kontext der griechischen Philosophie des 4. Jahrhunderts v. Chr. und analysiert den Einfluss verschiedener philosophischer Schulen auf Aristoteles' Werk.
- Die philosophische Landschaft des 4. Jahrhunderts v. Chr. und die verschiedenen Strömungen (Sophisten, Megariker etc.)
- Die Methodologie Platons und ihre Relevanz für die Entstehung des Syllogismus
- Die eristische Sophistik und ihr möglicher Einfluss auf Aristoteles' Entwicklung der Logik
- Die Definition und Funktion des Syllogismus innerhalb des aristotelischen Denksystems
- Aristoteles' Auseinandersetzung mit der Skepsis und seine Suche nach einer Methode zur Erzielung sicheren Wissens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der aristotelischen Syllogistik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung des Syllogismus. Sie beschreibt Aristoteles als den Logiker der Antike und positioniert seine Syllogistik als eine frühe Form der Prädikatenlogik. Die Einleitung betont Aristoteles' Ziel, die Argumentationsqualität in allen Bereichen zu verbessern, und seine Auseinandersetzung mit dem Wissen und der Erfahrung. Die Kritik an Platons Ideenlehre wird kurz angerissen, um den Kontext der Arbeit zu verdeutlichen. Schliesslich wird der Fokus der Arbeit auf die Entstehungsbedingungen des Syllogismus gelegt, wobei die Auffassung von Heinrich Maier erwähnt wird, der die Syllogistik als Produkt einer eristischen Epoche sieht.
2. Die philosophische Lage im 4. Jahrhundert v. Chr.: Dieses Kapitel beschreibt das intellektuelle Klima des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechenland. Es beleuchtet verschiedene philosophische Schulen und ihre Einflüsse auf die Entwicklung der Logik. Die eristische Sophistik, mit ihrer Fähigkeit, alles zu beweisen oder zu widerlegen, wird detailliert beschrieben. Die Sophisten werden als ein Stand ohne geschlossene Denkrichtung dargestellt, der den praktischen Bedarf nach rhetorischer Ausbildung befriedigte, was zu einer potenziellen Verflachung der Wissenschaft führte. Das Kapitel untersucht auch die megarische Skepsis mit ihrem positiv metaphysischen Hintergrund und der Ablehnung von Veränderung und Werden zugunsten eines ewigen, ruhenden Guten. Die Kapitel beleuchtet das Verhältnis dieser Schulen zum sokratischen Denken und deren Auswirkung auf die Entwicklung des Denkens in dieser Zeit.
Schlüsselwörter
Aristotelische Syllogistik, Entstehung der Logik, 4. Jahrhundert v. Chr., Griechische Philosophie, Sophisten, Megariker, Platon, Dialektik, Eristik, Skepsis, Methode, Erkenntnistheorie, Metaphysik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entstehung des aristotelischen Syllogismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des aristotelischen Syllogismus und die Bedingungen und Einflüsse, die seine Entwicklung prägten. Sie beleuchtet den Kontext der griechischen Philosophie des 4. Jahrhunderts v. Chr. und analysiert den Einfluss verschiedener philosophischer Schulen auf Aristoteles' Werk.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die philosophische Landschaft des 4. Jahrhunderts v. Chr. mit ihren verschiedenen Strömungen (Sophisten, Megariker etc.), die Methodologie Platons und ihre Relevanz für die Entstehung des Syllogismus, die eristische Sophistik und ihren möglichen Einfluss auf Aristoteles' Logikentwicklung, die Definition und Funktion des Syllogismus im aristotelischen Denksystem sowie Aristoteles' Auseinandersetzung mit der Skepsis und seine Suche nach sicherem Wissen.
Welche philosophischen Schulen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Einfluss verschiedener philosophischer Schulen, darunter die Sophisten (mit Fokus auf die eristische Sophistik), die Megariker (und ihre Skepsis), und die Auseinandersetzung mit dem platonischen Denken.
Wie wird die Methodologie Platons behandelt?
Die Arbeit untersucht die Methodologie Platons und deren Bedeutung für die Entstehung des Syllogismus. Platons Kampf gegen die Skepsis und seine Dialektik werden als relevante Aspekte betrachtet.
Welche Rolle spielt die Skepsis?
Die Arbeit beleuchtet die megarische Skepsis und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Denkens im 4. Jahrhundert v. Chr. Sie zeigt auch, wie Aristoteles sich mit der Skepsis auseinandersetzte und nach einer Methode zur Erzielung sicheren Wissens suchte.
Was ist der Syllogismus und wie wird er in der Arbeit definiert?
Der Syllogismus wird als eine frühe Form der Prädikatenlogik definiert, die Aristoteles entwickelte, um die Argumentationsqualität zu verbessern. Die Arbeit untersucht seine Definition und Funktion innerhalb des aristotelischen Denksystems.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, der philosophischen Lage im 4. Jahrhundert v. Chr. (inkl. Sophisten, Megariker, etc.), der Methodologie Platons, der Entdeckung des Syllogismus, dem Syllogismus selbst und einem Fazit. Jedes Kapitel befasst sich detailliert mit den jeweiligen Aspekten der Entstehung und des Kontextes des aristotelischen Syllogismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aristotelische Syllogistik, Entstehung der Logik, 4. Jahrhundert v. Chr., Griechische Philosophie, Sophisten, Megariker, Platon, Dialektik, Eristik, Skepsis, Methode, Erkenntnistheorie, Metaphysik.
Wie wird die eristische Sophistik in der Arbeit behandelt?
Die eristische Sophistik, mit ihrer Fähigkeit, alles zu beweisen oder zu widerlegen, wird detailliert beschrieben und ihr möglicher Einfluss auf Aristoteles' Entwicklung der Logik untersucht.
Wer wird als der Hauptdenker in diesem Kontext genannt?
Aristoteles wird als der Hauptdenker und Logiker der Antike dargestellt, dessen Syllogistik als frühe Form der Prädikatenlogik positioniert wird.
- Citar trabajo
- Hilal Akin (Autor), 2014, Aristotelische Syllogistik. Die Entstehung der Logik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293266