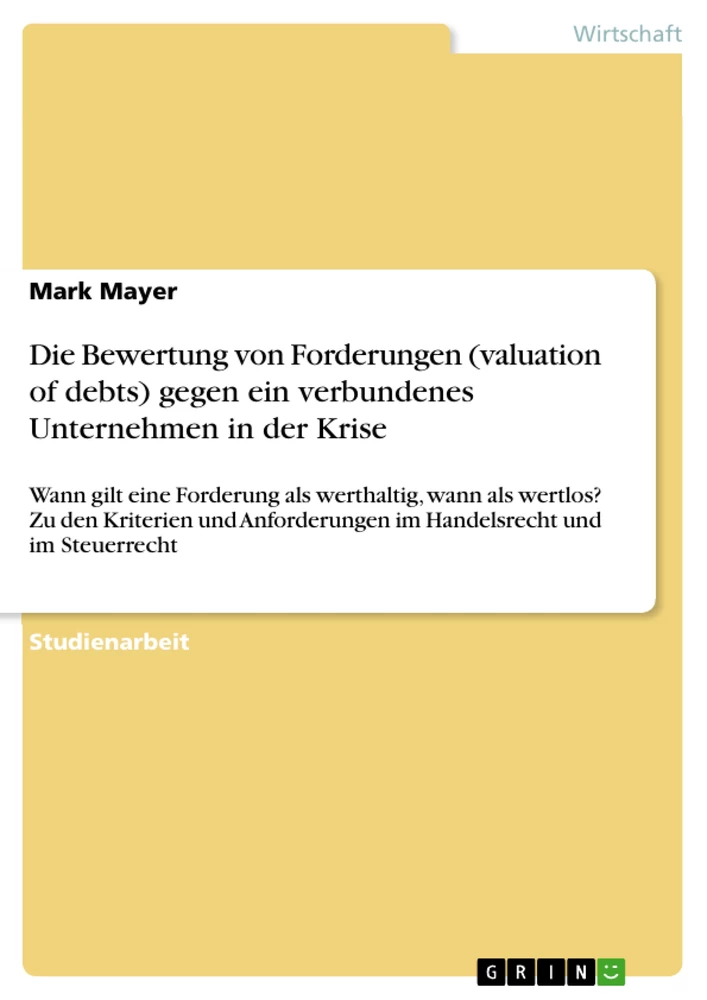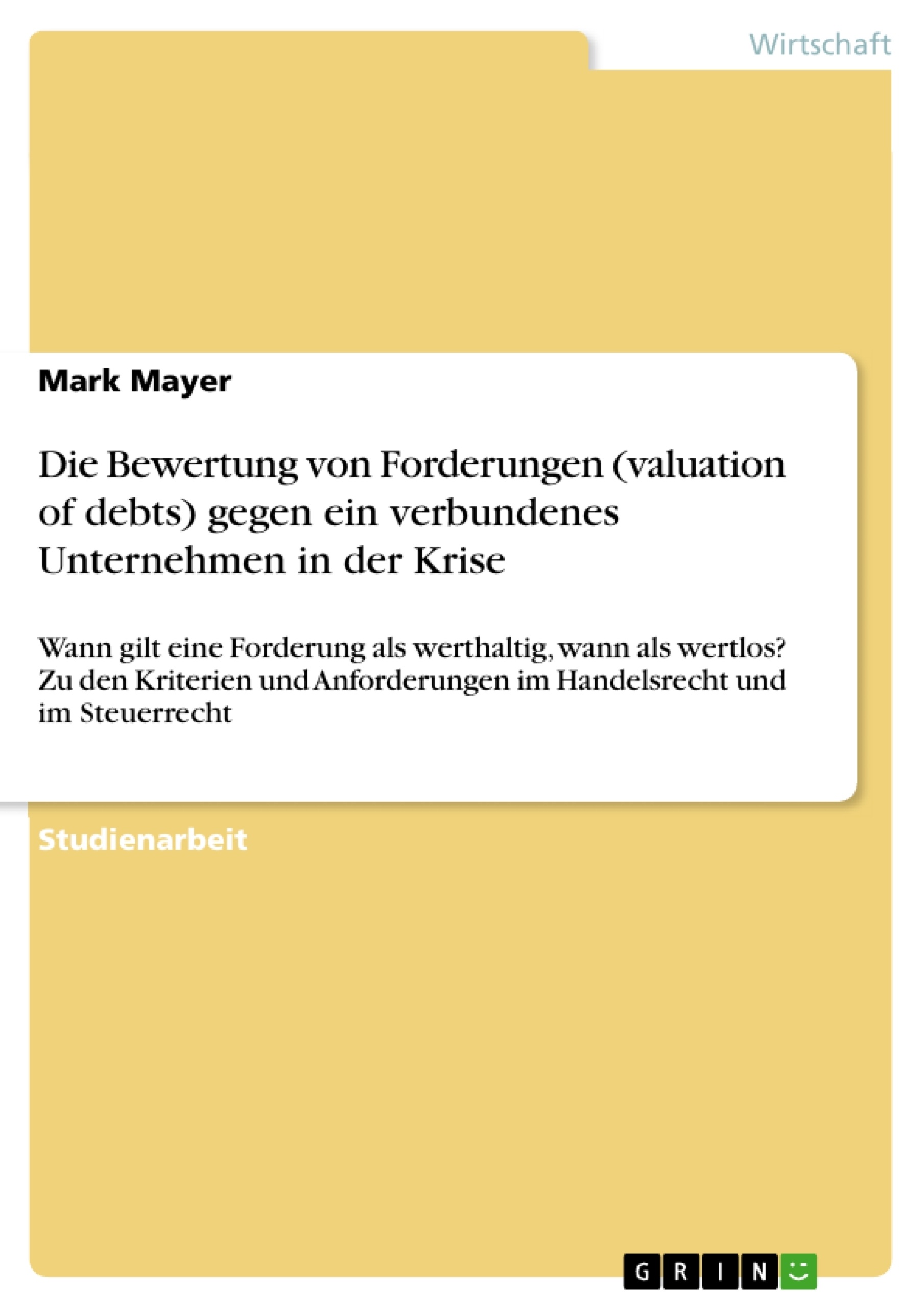Gerät ein Unternehmen in eine Krisensituation, so ist eine der wichtigsten Fragen, die sich alle kooperierenden Unternehmen stellen sollten, die nach der Werthaltigkeit von Forderungen gegen dieses Unternehmen. Die Relevanz dieser Frage ergibt sich u. a. in zweierlei Hinsicht: Einerseits muss nach dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip eine Wertberichtigung durchgeführt werden, die das individuelle Ausfallrisiko der Forderung abbildet. Andererseits – und insbesondere für verbundene Unternehmen des in der Krise befindlichen Unternehmens – kommt Forderungen bei der Sanierung durch den Forderungsverzicht eine wichtige Rolle zu.
Maßgeblich für die Bewertung der Forderung im Handelsrecht ist der ordentliche Kaufmann, der bei Zweifeln an der Einbringlichkeit einer Forderung diese abwerten würde. Da ein Unternehmen, welches sich selbst in der Krise befindet, bevorzugt spät als früh die handelsrechtliche Abwertung einer Forderung gegen ein in der Krise befindliches, verbundenes Unternehmen in Betracht zieht, kann sich ein Konflikt mit den handelsrechtlichen Vorgaben zeigen. Daher werden Kriterien nötig, die eine objektive Beurteilung der Werthaltigkeit einer Forderung bspw. für einen Berater oder die Geschäftsleitung ermöglichen.
Im Rahmen von Unternehmenssanierungen kommt der Werthaltigkeit von Forderungen in steuerlicher Hinsicht besondere Relevanz zu. Dabei führt ein Forderungsverzicht grundsätzlich zu einem steuerpflichtigen Ertrag in Höhe des wertlosen Teils der Forderung aufseiten des Schuldners. Da gerade gegen Unternehmen in der Krise gerichtete Forderungen als wertlos in Frage kommen, kann sich für diese ein erhebliches Liquiditätsproblem ergeben. Hier ist anhand konkreter Kriterien im Vorhinein zu bestimmen, inwieweit eine Forderung werthaltig ist.
Ziel dieser Arbeit ist es eben solche Kriterien zur Beurteilung der Werthaltigkeit von Forderungen sowohl in handels- als auch in steuerrechtlicher Hinsicht aufzuzeigen. Ein besonderer Fokus soll auf den Sanierungsaspekt gelegt werden, weshalb als Beziehung zwischen Schuldner(-) und Gläubiger(unternehmen) ein Beteiligungsverhältnis angenommen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Die Bewertung von Forderungen
- 2.1. Bewertung von Forderungen nach dem Handelsrecht
- 2.2. Bewertung von Forderungen nach dem Steuerrecht und Unterschiede zum Handelsrecht
- 2.3. Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- 3. Weitere Ansätze zur Bestimmung der Werthaltigkeit einer Forderung gegen verbundene Unternehmen in der Krise
- 3.1. Die Problemstellung des Forderungsverzichts als Sanierungsmaßnahme für verbundene Unternehmen in der Krise
- 3.2. Ansätze der Rechtssprechung zur Bestimmung der Werthaltigkeit einer Gesellschafterforderung bei Forderungsverzicht
- 3.2.1. Das Überschuldungskriterium
- 3.2.2. Positive Gewinn- und Liquiditätsprognose
- 3.2.3. Funktionale Bedeutung im Konzern
- 3.3. Der Ansatz der Finanzverwaltung zur Bestimmung der Werthaltigkeit einer Gesellschafterforderung bei Forderungsverzicht
- 3.4. Ausgewählte Ansätze aus der Literatur zur Bestimmung der Gesellschafterforderung bei Forderungsverzicht
- 3.5. Die jüngste Entwicklung der Rechtssprechung zur Beurteilung der Gesellschafterforderung bei Forderungsverzicht: Das Urteil des FG Hamburg vom 12. Februar 2014
- 4. Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Kriterien zur Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Krisensituationen, sowohl im Handels- als auch im Steuerrecht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme. Die Arbeit zielt darauf ab, objektive Beurteilungskriterien für die Werthaltigkeit solcher Forderungen zu entwickeln und aufzuzeigen.
- Bewertung von Forderungen im Handels- und Steuerrecht
- Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme
- Kriterien zur Bestimmung der Werthaltigkeit von Forderungen in Krisensituationen
- Rechtliche und steuerliche Aspekte des Forderungsverzichts
- Analyse der Rechtsprechung und Literatur zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit beginnt mit der Herausarbeitung der zentralen Problematik: der Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen in wirtschaftlichen Krisen. Es wird deutlich, dass sowohl handelsrechtliche (Niederstwertprinzip) als auch steuerrechtliche Aspekte (steuerpflichtiger Ertrag beim Forderungsverzicht) eine entscheidende Rolle spielen. Die Notwendigkeit objektiver Kriterien für die Beurteilung der Werthaltigkeit von Forderungen wird betont, insbesondere im Kontext von Unternehmenssanierungen und der damit verbundenen Notwendigkeit von frühzeitigen Entscheidungen.
2. Die Bewertung von Forderungen: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Bewertung von Forderungen im Handels- und Steuerrecht. Es werden die Unterschiede zwischen beiden Rechtsbereichen herausgestellt und die spezifischen Herausforderungen bei der Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen beleuchtet. Die Kapitelteil 2.3. fokussiert sich auf die Besonderheiten, die entstehen, wenn es sich bei der Forderung um eine verbundene Firma handelt. Der Konflikt zwischen der Notwendigkeit einer frühzeitigen Bewertung im Handelsrecht und dem Wunsch nach Aufschub im Steuerrecht wird angesprochen.
3. Weitere Ansätze zur Bestimmung der Werthaltigkeit einer Forderung gegen verbundene Unternehmen in der Krise: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit verschiedenen Ansätzen zur Bestimmung der Werthaltigkeit von Forderungen in Krisensituationen. Es werden Ansätze aus der Rechtsprechung (Überschuldungskriterium, positive Gewinn- und Liquiditätsprognose, funktionale Bedeutung im Konzern), der Finanzverwaltung und der Literatur diskutiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme und den damit verbundenen rechtlichen und steuerlichen Implikationen. Der aktuelle Stand der Rechtsprechung wird durch die Analyse eines Urteils des FG Hamburg vom 12. Februar 2014 dargestellt.
Schlüsselwörter
Forderungsbewertung, verbundene Unternehmen, Krise, Handelsrecht, Steuerrecht, Forderungsverzicht, Sanierung, Werthaltigkeit, Überschuldung, Gewinnprognose, Liquiditätsprognose, Rechtsprechung, Finanzverwaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Krise
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Kriterien zur Bewertung von Forderungen gegen verbundene Unternehmen, insbesondere in Krisensituationen. Sie beleuchtet dabei sowohl handelsrechtliche als auch steuerrechtliche Aspekte und konzentriert sich auf den Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme.
Welche Rechtsgebiete werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Handelsrecht und das Steuerrecht im Kontext der Bewertung von Forderungen. Die Unterschiede in der Bewertungsmethode zwischen beiden Rechtsgebieten werden detailliert dargestellt.
Was ist das zentrale Problem, das die Arbeit adressiert?
Das zentrale Problem ist die Bestimmung der Werthaltigkeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Krisenzeiten. Die Schwierigkeit liegt in der objektiven Beurteilung der Werthaltigkeit, insbesondere wenn ein Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme in Betracht gezogen wird.
Welche Methoden werden zur Bewertung von Forderungen verwendet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Bewertungsmethoden, darunter das im Handelsrecht geltende Niederstwertprinzip und die steuerrechtlichen Vorschriften. Sie analysiert auch Ansätze aus der Rechtsprechung (z.B. Überschuldungskriterium, positive Gewinn- und Liquiditätsprognose, funktionale Bedeutung im Konzern), der Finanzverwaltung und der Fachliteratur.
Welche Rolle spielt der Forderungsverzicht?
Der Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme steht im Mittelpunkt der Arbeit. Es werden die rechtlichen und steuerlichen Implikationen eines Forderungsverzichts ausführlich diskutiert, einschließlich der damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von Rechtsprechung, insbesondere eines Urteils des FG Hamburg vom 12. Februar 2014, sowie auf Ansätze der Finanzverwaltung und der relevanten Fachliteratur.
Welche konkreten Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bewertung von Forderungen im Handels- und Steuerrecht, den Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme, die Kriterien zur Bestimmung der Werthaltigkeit von Forderungen in Krisensituationen, die rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Forderungsverzichts und die Analyse der Rechtsprechung und Literatur zum Thema.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Problemstellung, Bewertung von Forderungen (inkl. handelsrechtlicher, steuerrechtlicher und Aspekte verbundener Unternehmen), Weitere Ansätze zur Bestimmung der Werthaltigkeit einer Forderung in der Krise (inkl. Ansätze der Rechtsprechung, Finanzverwaltung und Literatur, sowie Analyse eines Urteils des FG Hamburg), und thesenförmige Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Forderungsbewertung, verbundene Unternehmen, Krise, Handelsrecht, Steuerrecht, Forderungsverzicht, Sanierung, Werthaltigkeit, Überschuldung, Gewinnprognose, Liquiditätsprognose, Rechtsprechung, Finanzverwaltung.
- Citation du texte
- B.Sc. der Wirtschaftswissenschaften Mark Mayer (Auteur), 2014, Die Bewertung von Forderungen (valuation of debts) gegen ein verbundenes Unternehmen in der Krise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292688