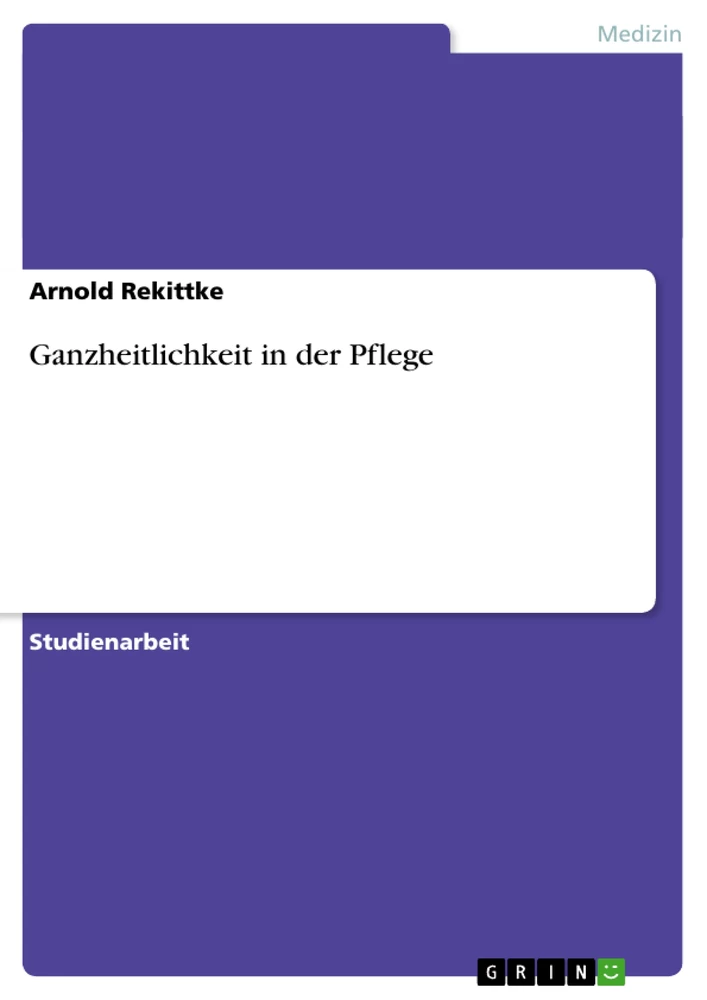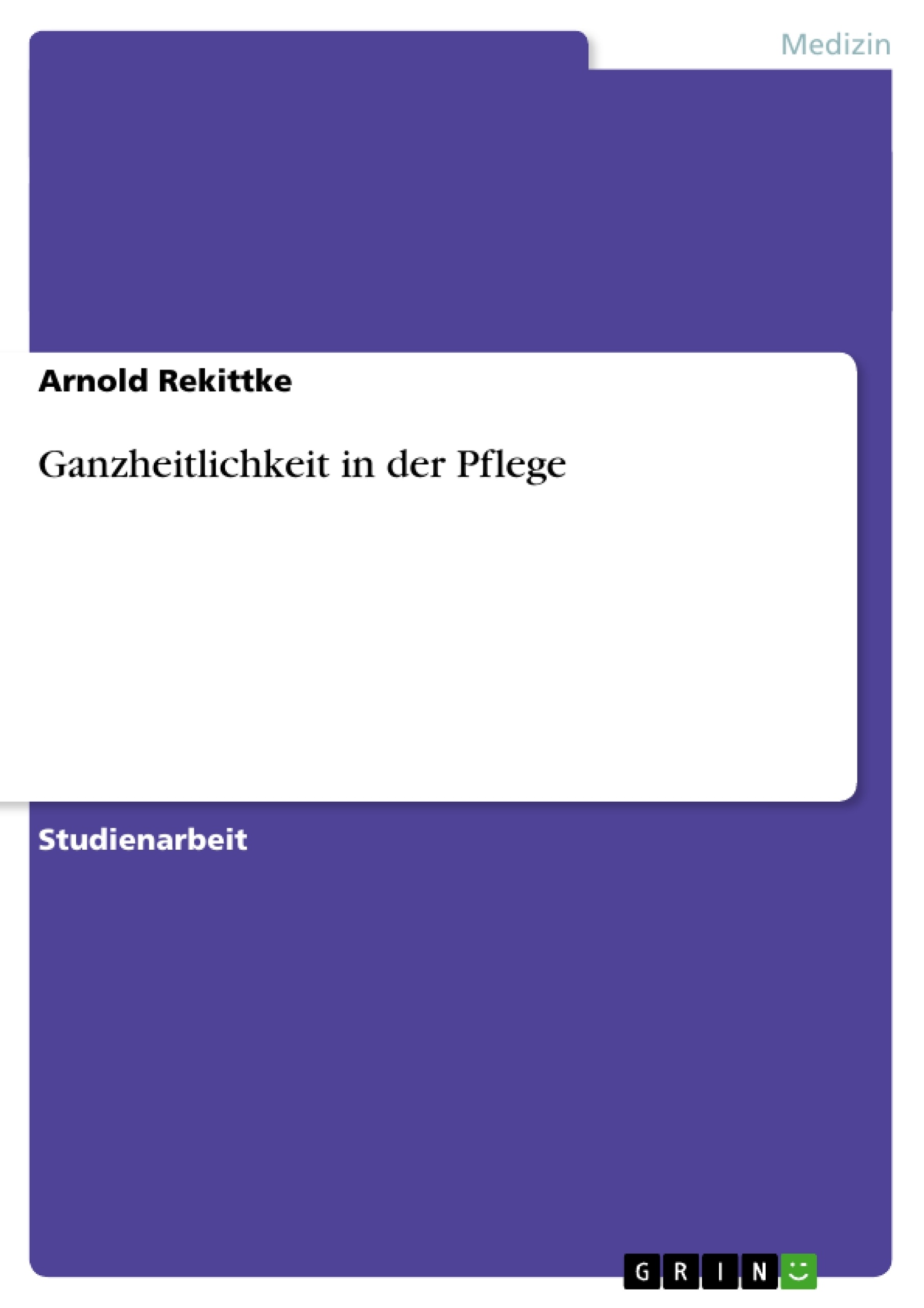Einleitung
Exemplarisch für ganzheitliche, sowie holistischen Ideen und Theorien in der Pflege stelle ich zunächst das Kapitel „Sorge & Pflege“ aus dem Buch „Pflege, Streß und Bewältigung, Bern u.a., Huber Verlag, 1997“ von Patricia Benner und Judith Wrubel dar, um im Anschluß daran kritische Fragen zu entwickeln. Im angegebenen Kapitel wird „Sorge“ zu dem zentralen Begriff in der Pflege, wobei für die Autorinnen in der Vorstellung von der Sorge für andere und anderes die Bindung zum anderen mitschwingt, und damit deutet sich eine Verschmelzung von Gedanken, Gefühlen und Handlungen an, eine Einheit von Wissen und Sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Sorge & Pflege“
- Definition von Sorge
- Bedeutung der Sorge
- Berufsalltag und Relevanz von Pflegewissenschaft
- Sorge bewältigt Stress
- Verständnis, nicht Wissen
- Der Begriff der Ganzheitlichkeit
- Ganzheitlichkeit und Lebensumstände
- Definitionen von Ganzheitlichkeit und Holismus
- Krankheit und Kranksein
- „Erlebtes Sein, erlebte Praxis“
- Gesundheit, WHO und das Sein
- Menschenbild
- Fallbeispiele
- Kritik und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat analysiert den Ansatz der Ganzheitlichkeit in der Pflege, ausgehend von Benner und Wrubels Konzept der „Sorge“. Es untersucht kritisch die Relevanz dieses Ansatzes im Kontext des modernen Pflegeberufs und der gesellschaftlichen Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit und seiner Anwendbarkeit in der Pflegepraxis.
- Das Konzept der „Sorge“ nach Benner und Wrubel und seine Bedeutung für die Pflegepraxis.
- Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit und dem Holismus.
- Die Relevanz von ganzheitlichen Ansätzen im Kontext des modernen Stressmanagements.
- Die Abgrenzung von ganzheitlicher Pflege zu einem rein wissenschaftlich-mechanischen Ansatz.
- Die Berücksichtigung des individuellen Menschenbildes in der Pflege.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dieses Referat untersucht ganzheitliche und holistische Ideen und Theorien in der Pflege, ausgehend von dem Kapitel „Sorge & Pflege“ aus dem Buch „Pflege, Stress und Bewältigung“ von Benner und Wrubel. Es dient als Grundlage für die Entwicklung kritischer Fragen zu diesen Konzepten.
„Sorge & Pflege“: Benner und Wrubel betonen die zentrale Rolle der „Sorge“ in der Pflege. Sie definieren Sorge nicht explizit, verwenden jedoch die Bedeutung des Bemühens um das Wohlergehen anderer. Sorge verleiht dem pflegerischen Handeln Motivation und Richtung, im Gegensatz zu motivationslosen Handlungen, die aus der Befriedigung von Bedürfnissen und Trieben resultieren und zu Sinn- und Bedeutungsverlust führen können. Die Autorinnen kritisieren den gesellschaftlichen Individualismus und plädieren für ein ganzheitliches Ideal der Sorge als Ausweg aus Frustration und Verarmung. Sie betonen die positive Auswirkung sorgende Zuwendung auf den Verlauf von Erkrankungen und fordern eine aus der Praxis für die Praxis entwickelte Pflegewissenschaft, die das „Expertenwissen“ der Pflegenden in den Mittelpunkt stellt.
Der Begriff der Ganzheitlichkeit: Dieses Kapitel setzt Benner und Wrubels Dichotomie von „gesellschaftlichem Individualismus“ und „ganzheitlichem Ideal“ in einen weiteren Kontext. Es hinterfragt die Popularität ganzheitlicher Theorien angesichts nicht-ganzheitlicher Lebensumstände (Arbeitsteilung, Rollenvielfalt, Verlust von Bindungen). Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Patient überhaupt als Ganzes wahrgenommen werden will. Die Sehnsucht nach alten Werten, einem harmonischen Weltbild und einem größeren Sinnzusammenhang wird als möglicher Grund für die Popularität ganzheitlicher Ideen identifiziert. Der Unterschied zwischen Ganzheitlichkeit und Holismus wird erläutert, wobei Holismus die Existenz transzendenter Ganzheiten annimmt.
Schlüsselwörter
Ganzheitlichkeit, Holismus, Sorge, Pflegewissenschaft, Stressbewältigung, Individualismus, Menschenbild, Pflegepraxis, Benner & Wrubel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Pflege, Stress und Bewältigung" (Benner & Wrubel)
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Referats?
Das Referat analysiert den Ansatz der Ganzheitlichkeit in der Pflege, basierend auf Benner und Wrubels Konzept der „Sorge“. Es untersucht kritisch die Relevanz dieses Ansatzes im modernen Pflegeberuf und im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Ganzheitlichkeit und seiner Anwendbarkeit in der Pflegepraxis.
Welche Kernthemen werden behandelt?
Die zentralen Themen umfassen das Konzept der „Sorge“ nach Benner und Wrubel und dessen Bedeutung für die Pflegepraxis, eine kritische Auseinandersetzung mit Ganzheitlichkeit und Holismus, die Relevanz ganzheitlicher Ansätze im Stressmanagement, die Abgrenzung zu rein wissenschaftlich-mechanischen Ansätzen und die Berücksichtigung des individuellen Menschenbildes in der Pflege.
Wie wird der Begriff der „Sorge“ nach Benner und Wrubel definiert?
Benner und Wrubel definieren „Sorge“ nicht explizit, betonen aber das Bemühen um das Wohlergehen anderer. Sorge motiviert pflegerisches Handeln im Gegensatz zu motivationslosen Handlungen, die aus Bedürfnissen und Trieben resultieren und zu Sinnverlust führen können. Sie sehen „Sorge“ als ganzheitliches Ideal im Gegensatz zum gesellschaftlichen Individualismus.
Was ist der Unterschied zwischen Ganzheitlichkeit und Holismus?
Das Referat erläutert den Unterschied zwischen Ganzheitlichkeit und Holismus. Während Ganzheitlichkeit einen ganzheitlichen Ansatz in der Betrachtung von Menschen und Situationen beschreibt, nimmt der Holismus die Existenz transzendenter Ganzheiten an.
Welche Kritikpunkte werden an ganzheitlichen Ansätzen in der Pflege geäußert?
Das Referat hinterfragt die Popularität ganzheitlicher Theorien angesichts nicht-ganzheitlicher Lebensumstände (Arbeitsteilung, Rollenvielfalt, Verlust von Bindungen). Es wirft die Frage auf, ob der Patient überhaupt als Ganzes wahrgenommen werden will und identifiziert die Sehnsucht nach alten Werten und einem größeren Sinnzusammenhang als möglichen Grund für die Popularität dieser Ideen.
Welche Kapitel umfasst das Referat?
Das Referat umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu „Sorge & Pflege“, ein Kapitel zum Begriff der Ganzheitlichkeit, ein Kapitel zu Krankheit und Kranksein, Fallbeispiele, sowie Kritik und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Ganzheitlichkeit, Holismus, Sorge, Pflegewissenschaft, Stressbewältigung, Individualismus, Menschenbild, Pflegepraxis und Benner & Wrubel.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Referat?
Das Referat zieht kritische Schlussfolgerungen zur Anwendbarkeit ganzheitlicher Ansätze in der Pflegepraxis und deren Relevanz im Kontext des modernen Pflegeberufs und gesellschaftlicher Herausforderungen. Es hinterfragt die Umsetzbarkeit des Ideals der „Sorge“ in der Realität der Pflege und diskutiert die Grenzen und Möglichkeiten ganzheitlicher Pflegeansätze.
- Quote paper
- Arnold Rekittke (Author), 2000, Ganzheitlichkeit in der Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28861