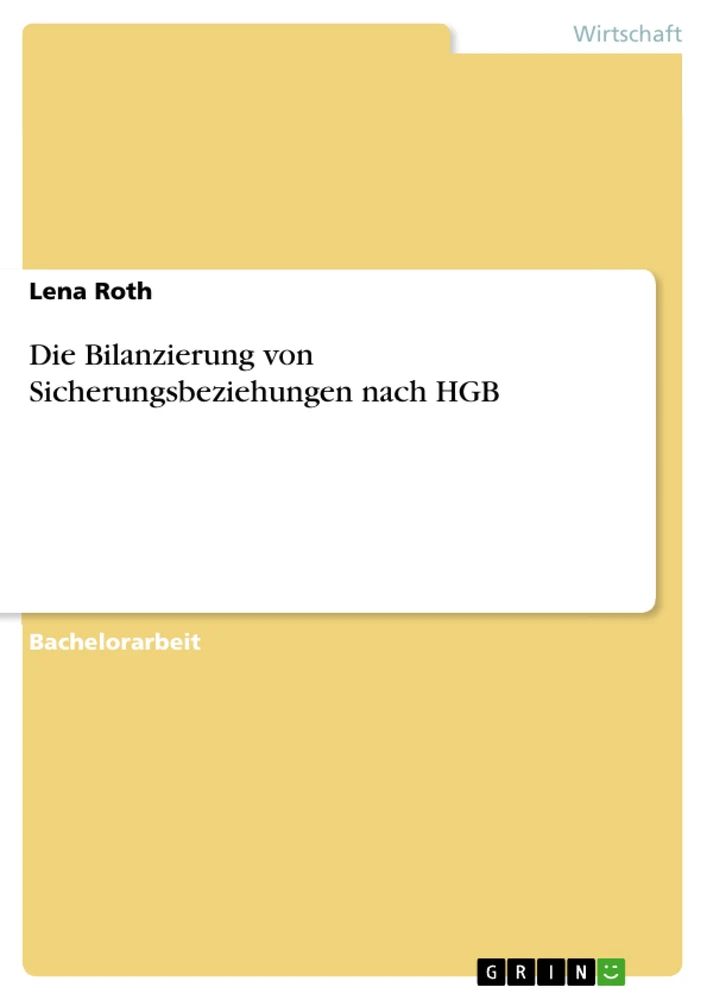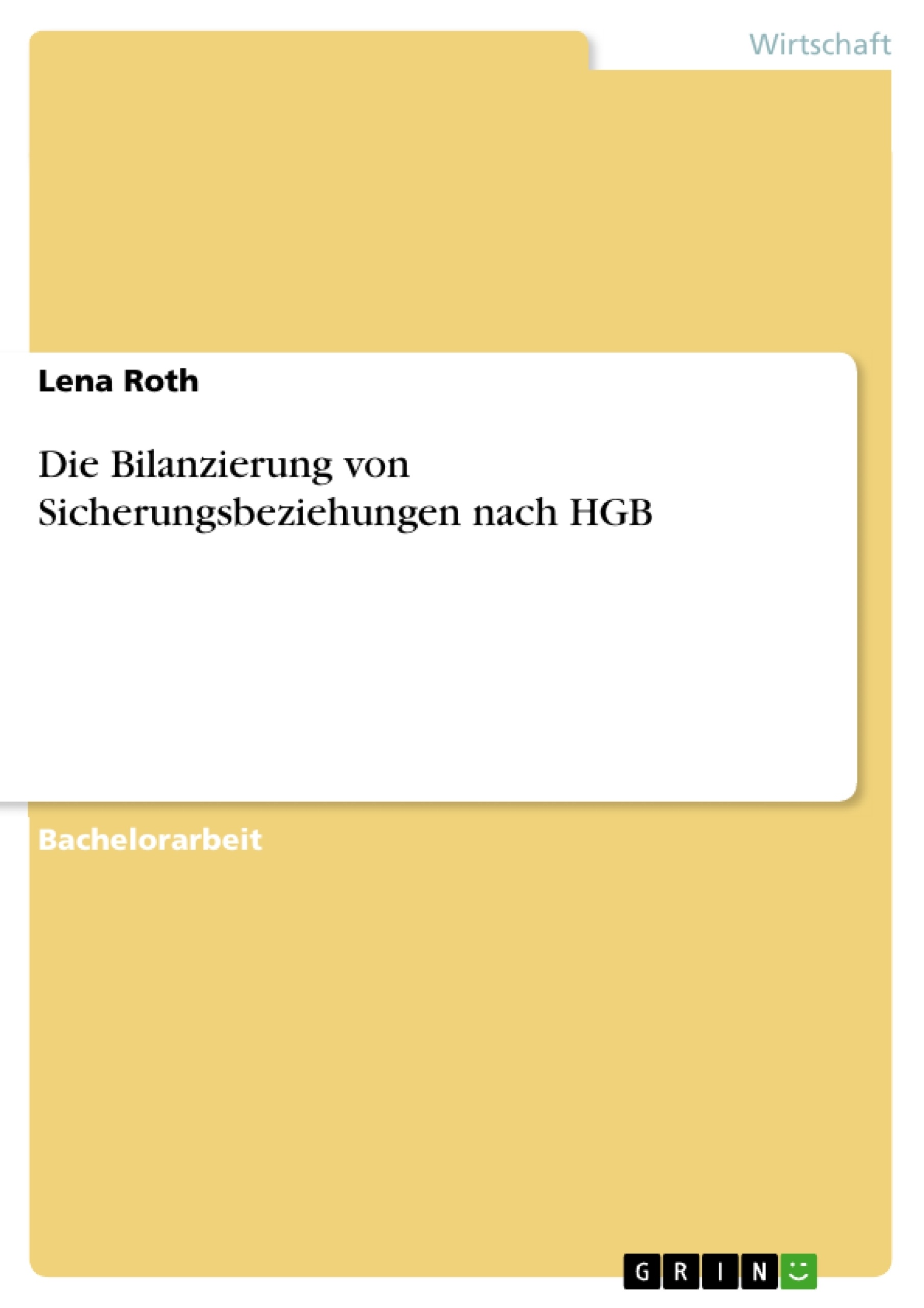Mit der Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) im Jahr 2009 wurde das deutsche Handelsrecht an die internationale Rechnungslegungspraxis angepasst, ohne jedoch die bisherigen Systeme wie beispielsweise die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung oder die HGB-Bilanz als Grund-lage für die steuerliche Gewinnermittlung und Ausschüttungsbemessung aufzugeben . Hierdurch wurde mit dem neuen § 254 HGB auch die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen im Gesetz gefestigt. Durch die Norm des § 5 Abs. 1a
S. 2 EStG sind die zur Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken in der Handelsbilanz gebildeten Bewertungseinheiten sogar maßgeblich für die steuerliche Gewinnermittlung . Besteht die Möglichkeit, das aus einem Grundgeschäft resultierende Risiko, wie beispielsweise bei eine Fremdwährungsforderung, mit einem Sicherungsinstrument, in diesem Fall eine Verbindlichkeit in derselben Fremdwährung, zu neutralisieren, entsteht eine Sicherungsbeziehung, die mit Hilfe einer Bewertungseinheit im handelsrechtlichen Jahresabschluss abgebildet wird . Durch die Bilanzierung von Bewertungseinheiten soll die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens erreicht werden . In der Praxis war diese Vorgehensweise schon lange anerkannt. Durch die Einführung dieser Norm soll die bisherige Bilanzierungspraxis nicht geändert werden, es ergeben sich aber dennoch durch deren Auslegung diverse Fragestellungen, unter anderem ob sie ein Wahlrecht oder eine Pflicht darstellt oder mit welcher Methode die Bewertungseinheiten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet werden sollen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat zu diesem Thema auch eine Stellungnahme zur handelsrechtlichen Bilanzierung von Bewertungseinheiten veröffentlicht, die nicht immer mit den Ansichten anderer fachkundiger Autoren übereinstimmt. Ziel dieser Arbeit ist es, die Anwendung und die Methodik der Norm zu erläutern und auf Fragestellungen und Probleme, die sich hieraus ergeben, einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Die gesetzliche Regelung des § 254 HGB
- 2.1 Zweck und Inhalt des § 254 HGB
- 3 Bildung von Bewertungseinheiten nach § 254 HGB
- 3.1 Begriff und Formen von Bewertungseinheiten
- 3.1.1 Micro Hedge
- 3.1.2 Portfolio Hedge
- 3.1.3 Macro Hedge
- 3.2 Absicherbare Risikoarten
- 3.2.1 Wertänderungsrisiko und Zahlungsstromänderungsrisiko
- 3.3 Voraussetzung für die Anwendung von § 254 HGB
- 3.3.1 Abzusichernde Risiken
- 3.3.2 Zulässige Grundgeschäfte
- 3.3.3 Zulässige Sicherungsinstrumente
- 3.3.4 Sicherungs- und Durchhalteabsicht
- 3.4 Sicherungseignung und -wirksamkeit
- 3.4.1 Methoden zur Beurteilung der Sicherungswirksamkeit
- 3.4.2 Dokumentation des Sicherungszusammenhangs
- 4 Abbildung von Bewertungseinheiten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung
- 4.1 Zweistufige Bewertungstechnik bei Bewertungseinheiten mit kontrahierenden Grundgeschäften
- 4.2 Bilanzielle Abbildung der Bewertungseinheit nach der
- 4.2.1 Durchbuchungs- und Einfriermethode
- 4.2.2 Einfrierungsmethode
- 4.2.3 Durchbuchungsmethode
- 4.2.3 Behandlung von antizipativen Bewertungseinheiten
- 4.3 Beendigung einer Sicherungsbeziehung
- 4.4 Berichterstattungspflichten im Zusammenhang mit Bewertungseinheiten
- 4.5 Pflicht oder Wahlrecht zur Bildung bilanzieller Bewertungseinheiten
- 4.6 Die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen in der Praxis
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Ziel ist es, die gesetzlichen Regelungen des § 254 HGB zu erläutern und die praktische Anwendung der Bilanzierung von Bewertungseinheiten zu beschreiben. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Sicherungsbeziehungen, von der Bildung von Bewertungseinheiten bis hin zur berichterstattungspflichtigen Abbildung in der Bilanz.
- Gesetzliche Grundlagen der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach § 254 HGB
- Formen und Arten von Bewertungseinheiten (Micro, Portfolio, Macro Hedge)
- Methoden zur Beurteilung der Sicherungswirksamkeit
- Bilanzielle Abbildung von Bewertungseinheiten (Durchbuchungs- und Einfriermethode)
- Praktische Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
2 Die gesetzliche Regelung des § 254 HGB: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen gemäß § 254 HGB. Es beleuchtet den Zweck und Inhalt der Vorschrift und legt den Fokus auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Anwendung des § 254 HGB relevant sind. Die Bedeutung der klaren Definition von Zielen und der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird hervorgehoben, um die korrekte und transparente Abbildung von Sicherungsbeziehungen in der Bilanz zu gewährleisten. Die Analyse berücksichtigt dabei die Zusammenhänge mit anderen relevanten Vorschriften des HGB und beleuchtet mögliche Interpretationsspielräume.
3 Bildung von Bewertungseinheiten nach § 254 HGB: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Bildung von Bewertungseinheiten im Rahmen von Sicherungsbeziehungen nach § 254 HGB. Es beschreibt unterschiedliche Arten von Bewertungseinheiten wie Micro, Portfolio und Macro Hedge und analysiert deren jeweilige Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten. Die verschiedenen absicherbaren Risikoarten, wie Wertänderungs- und Zahlungsstromänderungsrisiken, werden detailliert erläutert und in den Kontext der Bewertungseinheiten eingeordnet. Das Kapitel beleuchtet die Voraussetzungen für die Anwendung von § 254 HGB, einschließlich der zulässigen Grundgeschäfte, Sicherungsinstrumente, sowie die Notwendigkeit einer Sicherungs- und Durchhalteabsicht. Die Methoden zur Beurteilung der Sicherungswirksamkeit und die Dokumentation des Sicherungszusammenhangs werden ebenfalls eingehend behandelt, um die korrekte Anwendung und Nachweisführung zu gewährleisten.
4 Abbildung von Bewertungseinheiten in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung: Dieses Kapitel widmet sich der bilanziellen Abbildung von Bewertungseinheiten. Es erklärt die zweistufige Bewertungstechnik bei Bewertungseinheiten mit kontrahierenden Grundgeschäften und vergleicht die Durchbuchungs- und Einfriermethode. Die Behandlung von antizipativen Bewertungseinheiten wird ebenfalls erläutert, ebenso wie die Beendigung einer Sicherungsbeziehung und die damit verbundenen berichterstattungspflichtigen Aspekte. Das Kapitel beleuchtet die Pflicht oder das Wahlrecht zur Bildung bilanzieller Bewertungseinheiten und gibt einen Einblick in die praktische Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen.
Schlüsselwörter
§ 254 HGB, Sicherungsbeziehungen, Bewertungseinheiten, Micro Hedge, Portfolio Hedge, Macro Hedge, Wertänderungsrisiko, Zahlungsstromänderungsrisiko, Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung, Durchbuchungsmethode, Einfriermethode, Sicherungswirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach § 254 HGB
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit behandelt die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach dem Handelsgesetzbuch (§ 254 HGB). Sie erläutert die gesetzlichen Regelungen und beschreibt die praktische Anwendung der Bilanzierung von Bewertungseinheiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt verschiedene Aspekte von Sicherungsbeziehungen ab, darunter die gesetzlichen Grundlagen nach § 254 HGB, die verschiedenen Formen von Bewertungseinheiten (Micro, Portfolio, Macro Hedge), Methoden zur Beurteilung der Sicherungswirksamkeit, die bilanziellen Abbildungsmethoden (Durchbuchungs- und Einfriermethode) und die praktische Anwendung der Bilanzierung.
Welche Arten von Bewertungseinheiten werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Micro Hedge, Portfolio Hedge und Macro Hedge. Die jeweiligen Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten dieser Bewertungseinheiten werden detailliert analysiert.
Welche Risikoarten werden im Zusammenhang mit Sicherungsbeziehungen betrachtet?
Die Arbeit betrachtet das Wertänderungsrisiko und das Zahlungsstromänderungsrisiko als absicherbare Risikoarten.
Welche Voraussetzungen müssen für die Anwendung des § 254 HGB erfüllt sein?
Die Anwendung des § 254 HGB setzt die Existenz absicherbarer Risiken, zulässiger Grundgeschäfte und Sicherungsinstrumente sowie eine Sicherungs- und Durchhalteabsicht voraus.
Wie wird die Sicherungswirksamkeit beurteilt?
Die Arbeit beschreibt Methoden zur Beurteilung der Sicherungswirksamkeit und betont die Bedeutung der Dokumentation des Sicherungszusammenhangs.
Welche Methoden der bilanziellen Abbildung von Bewertungseinheiten werden erläutert?
Die Arbeit erläutert die zweistufige Bewertungstechnik bei Bewertungseinheiten mit kontrahierenden Grundgeschäften und vergleicht die Durchbuchungs- und Einfriermethode. Die Behandlung von antizipativen Bewertungseinheiten wird ebenfalls behandelt.
Wie wird die Beendigung einer Sicherungsbeziehung bilanziell abgebildet?
Die Arbeit beschreibt die bilanziellen Auswirkungen der Beendigung einer Sicherungsbeziehung und die damit verbundenen Berichterstattungspflichten.
Gibt es eine Pflicht oder ein Wahlrecht zur Bildung bilanzieller Bewertungseinheiten?
Die Arbeit beleuchtet die Frage nach der Pflicht oder dem Wahlrecht zur Bildung bilanzieller Bewertungseinheiten.
Wie sieht die praktische Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen aus?
Die Arbeit gibt einen Einblick in die praktische Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Zu den Schlüsselwörtern gehören § 254 HGB, Sicherungsbeziehungen, Bewertungseinheiten, Micro Hedge, Portfolio Hedge, Macro Hedge, Wertänderungsrisiko, Zahlungsstromänderungsrisiko, Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung, Durchbuchungsmethode, Einfriermethode und Sicherungswirksamkeit.
- Quote paper
- Lena Roth (Author), 2014, Die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287167