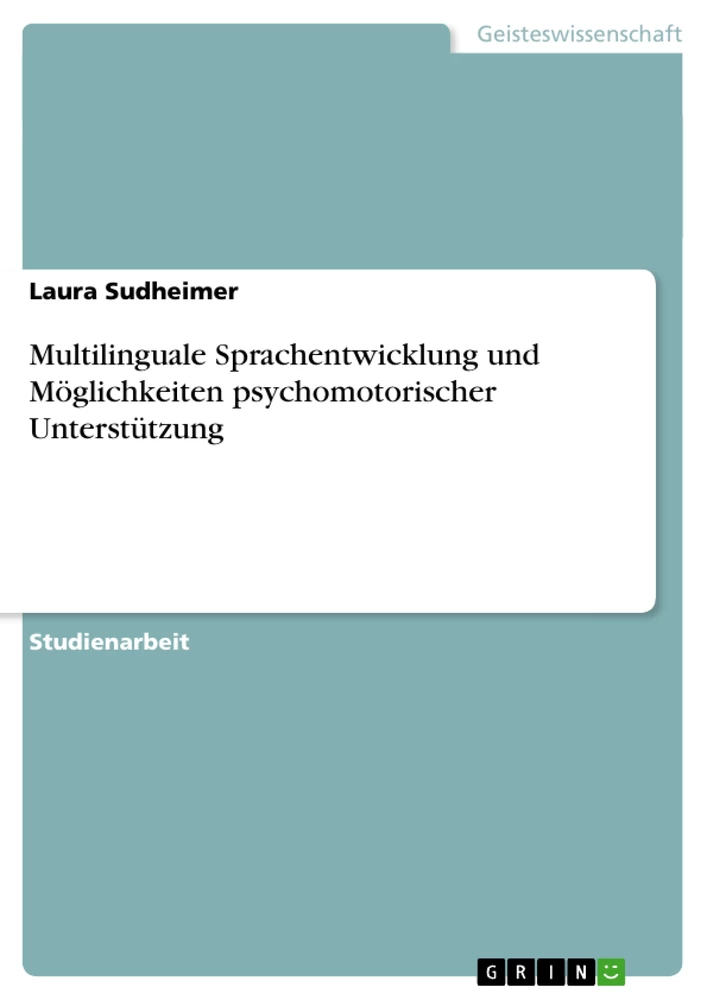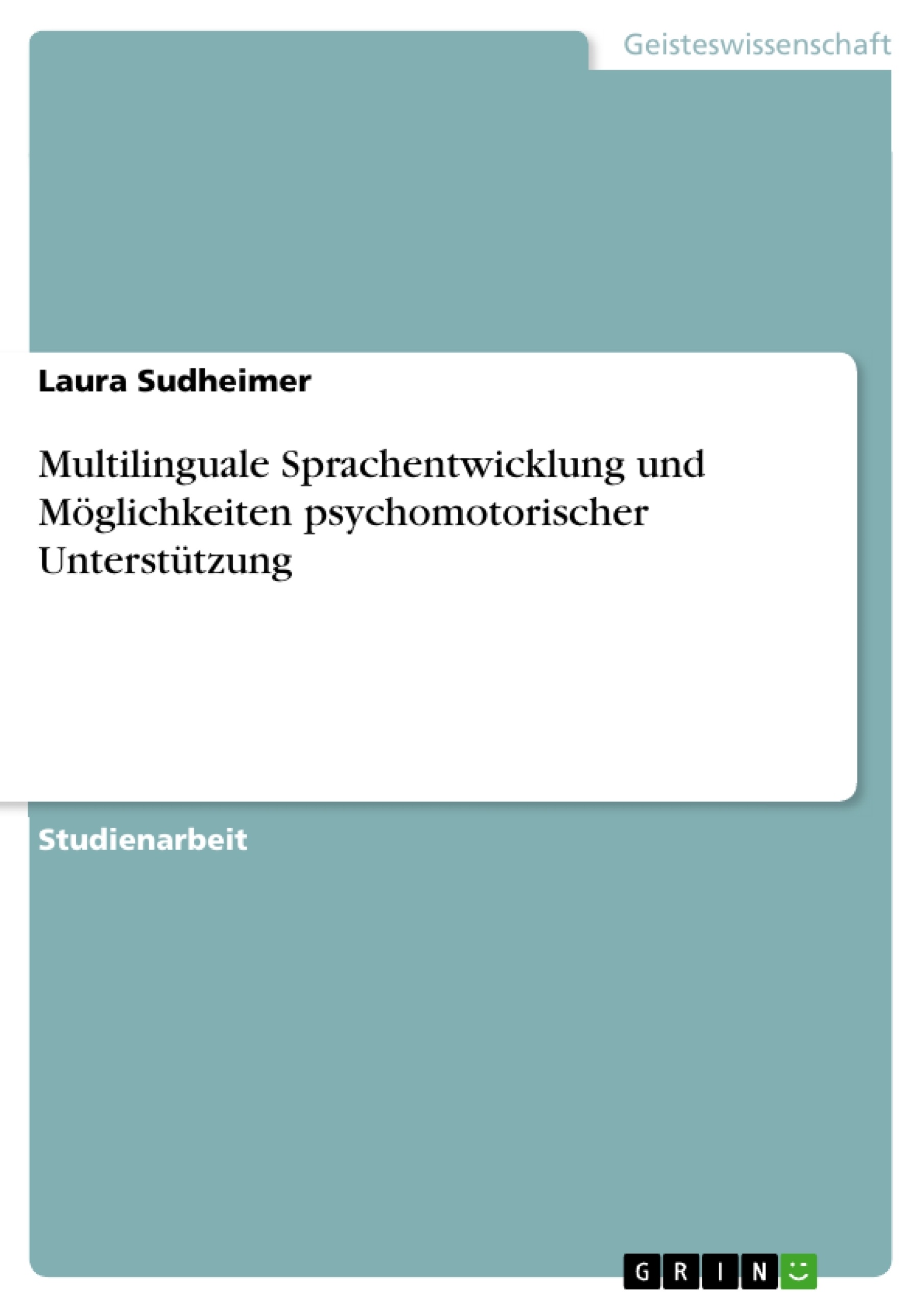Deutschland ist ein Einwanderungsland und vereinigt damit auch eine sprachliche, soziale und kulturelle Vielfalt. In Großstädten wachsen mittlerweile 30 bis 40% der Kinder aus Migrationsfamilien zweisprachig auf. Jede sechste
Eheschließung ist eine binationale Ehe. So gibt es immer mehr Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Der direkte
Umgang mit mehreren Sprachen findet entweder in den Familien oder im Freundeskreis sowie auch in institutionellen Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen statt. Mehrsprachig zu leben rückt immer mehr in die Lebenswelt
der Kinder. Damit entwickelt sich Mehrsprachigkeit von einer besonderen Lebenssituation zur Normalität. Jede Gesellschaft weist Migrationsbewegungen als einen festen Bestandteil ihrer Struktur auf, bedingt z. B. durch die weltweite Mobilität aufgrund von Arbeitsmigration, Armut oder politischen Unruhen.
Wie kann die Psychomotorik das Ansehen der Sprachenvielfalt positiv beeinflussen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mehrsprachigkeit. Definitionen, Ebenen und Formen
- 2.1 Grundlagen der Sprachentwicklung
- 2.2.1 Der Sprachbaum nach Wendlandt
- 2.2.2 Der zweisprachige Sprachbaum
- 2.3 Phasen des Doppelspracherwerbs
- 2.4 Die Bedeutung der Sprache für die Identitätsentwicklung
- 3. Einführung in die Psychomotorik
- 3.1 Wechselwirkung von Psyche und Motorik
- 3.2 Ressourcenorientierung
- 3.3 Handlungskompetenz
- 4. Die Verbindung von Psychomotorik und Sprache
- 4.1 Bewegung als Ausdrucksmittel innerer Vorgänge
- 4.2 Die Bedeutung des Spiels im Bezug auf Sprache
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Potenzial der Verbindung von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb bei Kindern. Ziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie psychomotorische Ansätze die positive Anerkennung und Förderung von Mehrsprachigkeit unterstützen können. Der Fokus liegt auf Kindern, die während des Spracherwerbs mit mehreren Sprachen konfrontiert werden, wobei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf ausgeschlossen sind.
- Definitionen und Ebenen der Mehrsprachigkeit
- Grundlagen der Sprachentwicklung im mehrsprachigen Kontext
- Einführung in die Psychomotorik und deren Ressourcenorientierung
- Die Interaktion zwischen Bewegung, Sprache und emotionaler Entwicklung
- Möglichkeiten der Verknüpfung von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar: Deutschland als Einwanderungsland mit zunehmender Mehrsprachigkeit bei Kindern. Sie thematisiert die oft getrennte Betrachtung von Sprach- und Bewegungsentwicklung in Bildungsplänen und formuliert die Forschungsfrage nach dem Potenzial der Kombination beider Bereiche. Die Autorin beschreibt ihre Motivation und den Fokus der Arbeit auf Kinder, die im Spracherwerb mit mehreren Sprachen konfrontiert werden, wobei Kinder mit erhöhtem Förderbedarf ausgeschlossen sind.
2. Mehrsprachigkeit. Definition, Ebenen und Formen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen von Mehrsprachigkeit, von einer restriktiven Auffassung (Beherrschung mehrerer Sprachen wie die Muttersprache) bis hin zu einer inklusiveren Sichtweise (sinnvolle Äußerungen in mehreren Sprachen). Es werden drei Ebenen der sprachlichen Kompetenz (sprachliche Mittel, kommunikativer Einsatz, sprachkognitive Kompetenz) untersucht und verschiedene Arten des Spracherwerbs (Doppelspracherwerb vs. Zweitspracherwerb) differenziert. Das Kapitel betont die Bedeutung des Sprachinputs aus verschiedenen Situationen und die Herausforderungen für mehrsprachig aufwachsende Kinder, ihren Sprachinput zu filtern.
3. Einführung in die Psychomotorik: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Psychomotorik, indem es die Wechselwirkung zwischen Psyche und Motorik beleuchtet und die ressourcenorientierte Perspektive betont. Die Bedeutung der Handlungskompetenz als Ziel psychomotorischer Förderung wird hervorgehoben. Es wird die Grundlage für die spätere Verbindung zur Sprachentwicklung gelegt.
4. Die Verbindung von Psychomotorik und Sprache: Dieses Kapitel fokussiert die Verbindung zwischen Psychomotorik und Sprache. Es wird erörtert, wie Bewegung als Ausdrucksmittel innerer Vorgänge fungieren kann und wie das Spiel eine wichtige Rolle im Spracherwerb spielt, insbesondere im mehrsprachigen Kontext. Hier werden die theoretischen Grundlagen für die praktische Anwendung der Psychomotorik zur Förderung der Mehrsprachigkeit gelegt.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Psychomotorik, Bewegung, Sprache, Bilingualismus, Doppelspracherwerb, Zweitspracherwerb, Ressourcenorientierung, Handlungskompetenz, Sprachentwicklung, Identitätsentwicklung, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verbindung von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb bei Kindern
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Potenzial der Verbindung von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb bei Kindern. Das Ziel ist es aufzuzeigen, wie psychomotorische Ansätze die positive Anerkennung und Förderung von Mehrsprachigkeit unterstützen können. Der Fokus liegt dabei auf Kindern, die während des Spracherwerbs mit mehreren Sprachen konfrontiert werden (Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind ausgeschlossen).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Mehrsprachigkeit (Definitionen, Ebenen, Formen, Spracherwerb), der Psychomotorik (Wechselwirkung von Psyche und Motorik, Ressourcenorientierung, Handlungskompetenz) und deren Verbindung. Es werden die Bedeutung des Spiels für den Spracherwerb und Bewegung als Ausdrucksmittel innerer Vorgänge beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Interaktion zwischen Bewegung, Sprache und emotionaler Entwicklung und zeigt Möglichkeiten der Verknüpfung von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb in der Praxis auf.
Wie wird Mehrsprachigkeit in der Arbeit definiert?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Definitionen von Mehrsprachigkeit, von einer restriktiven (Beherrschung mehrerer Sprachen wie die Muttersprache) bis hin zu einer inklusiveren Sichtweise (sinnvolle Äußerungen in mehreren Sprachen). Drei Ebenen der sprachlichen Kompetenz werden untersucht: sprachliche Mittel, kommunikativer Einsatz und sprachkognitive Kompetenz. Es wird zwischen Doppelspracherwerb und Zweitspracherwerb differenziert.
Was ist die Rolle der Psychomotorik im Kontext des mehrsprachigen Spracherwerbs?
Die Arbeit argumentiert, dass psychomotorische Ansätze die positive Anerkennung und Förderung von Mehrsprachigkeit unterstützen können. Bewegung wird als Ausdrucksmittel innerer Vorgänge gesehen und das Spiel als wichtiger Bestandteil des Spracherwerbs, besonders im mehrsprachigen Kontext, hervorgehoben. Die ressourcenorientierte Perspektive der Psychomotorik und die Bedeutung der Handlungskompetenz werden betont.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit umfasst fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Mehrsprachigkeit (Definitionen, Ebenen und Formen, inklusive Sprachentwicklung und Identitätsentwicklung), ein Kapitel zur Einführung in die Psychomotorik, ein Kapitel zur Verbindung von Psychomotorik und Sprache und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und vertieft die Thematik schrittweise.
Welche Zielgruppe wird in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Kinder, die während des Spracherwerbs mit mehreren Sprachen konfrontiert werden. Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind explizit ausgeschlossen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Spracherwerb, Psychomotorik, Bewegung, Sprache, Bilingualismus, Doppelspracherwerb, Zweitspracherwerb, Ressourcenorientierung, Handlungskompetenz, Sprachentwicklung, Identitätsentwicklung, Migrationshintergrund.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit untersucht das Potenzial der Kombination von Sprach- und Bewegungsentwicklung, da diese Bereiche in Bildungsplänen oft getrennt betrachtet werden. Die zentrale Forschungsfrage lautet somit: Welches Potenzial birgt die Kombination von Psychomotorik und mehrsprachigem Spracherwerb für Kinder?
- Quote paper
- Laura Sudheimer (Author), 2014, Multilinguale Sprachentwicklung und Möglichkeiten psychomotorischer Unterstützung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287049