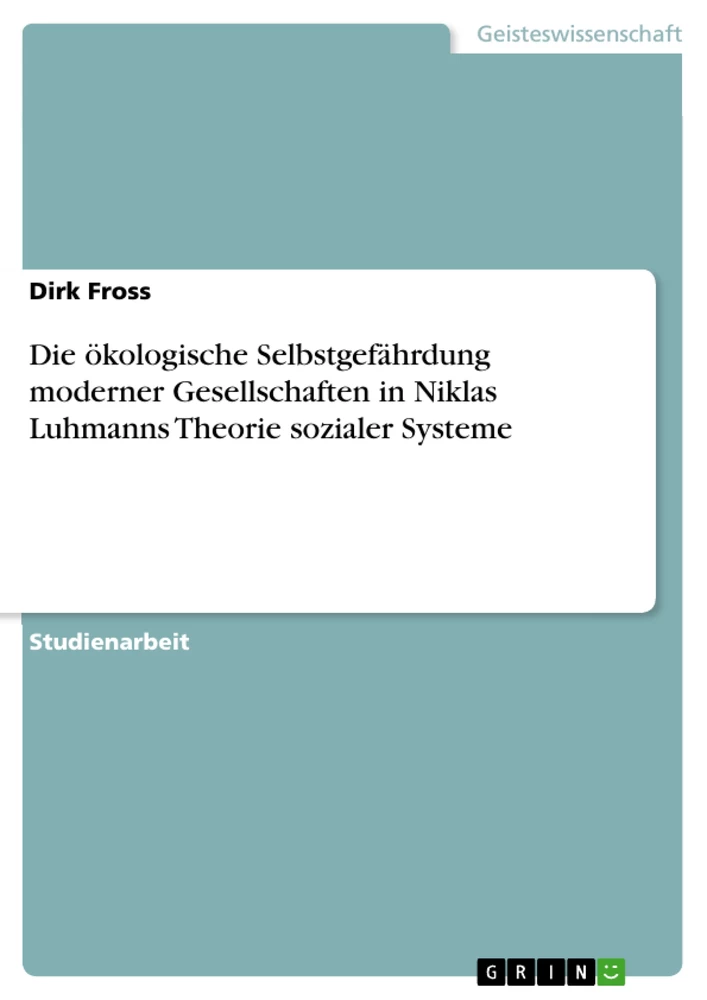Einleitung
In den letzten Jahrzehnten zeichnen sich in immer mehr Bereichen anthropogene Umweltveränderungen ab, welche sich zunehmend auch auf die menschlichen Lebensgrundlagen auswirken. Ökologische Probleme haben exponentiell zugenommen. Einzelne Komponenten summieren sich zu multifaktoriellen Einflüssen mit unvorhersagbaren Konsequenzen für die Umwelt. In Bezug auf die ökologische Selbstgefährdung moderner Gesellschaften waren soziologische Theorien durch die Beschränkung auf innergesellschaftliche Perspektiven
bis vor einigen Jahren blind ,"... der ökologische Zusammenhang von Natur und Gessellschaft wurde nicht thematisiert..."(1) . Ulrich Beck spricht von ´ökologischer Blindheit´, als Geburtsfehler der Soziologie, welche nur in der Gegenüberstellung zur Natur und der Konzentration auf ´soziale Tatsachen´ ihre disziplinäre Selbständigkeit gegenüber den Naturwissenschaften erreichen
und behaupten konnte.(2)
Die rasch zunehmende Thematisierung ökologischer Zusammenhänge in den
letzten Jahrzehnten kam für die Soziologie somit überraschend, hatte man doch bislang als besondere Gegenstände soziologischer Forschung ´die Gesellschaft´ oder ´Teile der Gesellschaft´ behandelt und ´Natur´ als gesellschaftliche Umwelt anderen Disziplinen überlassen.
[...]
______
1 Luhmann 1996: S. 47.
2 vgl. Beck : S. 69f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Differenz statt Identität
- Beobachtung
- System/Umwelt – Differenz
- Autopoietische, selbstreferentielle Systeme
- Soziale Systeme
- Resonanz
- Die ökologische Selbstgefährdung moderner Gesellschaften
- Funktionale Differenzierung
- Codes und Programme
- Zu viel und zu wenig Resonanz
- Angstrhetorik und soziale Bewegungen
- Funktionale Differenzierung
- Ökologische Rationalität
- Schluẞ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ökologische Selbstgefährdung moderner Gesellschaften aus der Perspektive von Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Ziel ist es, die Problematik der ökologischen Selbstgefährdung anhand der Konzepte von Differenz, System/Umwelt, Autopoiesis und Resonanz zu analysieren.
- Die Bedeutung von Differenz und Beobachtung in Luhmanns Theorie
- Die Funktionsweise autopoietischer, selbstreferentieller Systeme
- Die Rolle von Resonanz in der Beziehung zwischen Gesellschaft und Umwelt
- Die Problematik der ökologischen Selbstgefährdung aus systemtheoretischer Perspektive
- Luhmanns Ansatz zur Bewältigung der ökologischen Problematik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Problematik der ökologischen Selbstgefährdung in den Kontext soziologischer Theorien dar. Kapitel 2 behandelt Luhmanns Theorie der Beobachtung und die Unterscheidung von System und Umwelt. Kapitel 3 erläutert das Konzept der Autopoiesis und die Funktionsweise sozialer Systeme. Kapitel 4 diskutiert die Bedeutung von Resonanz für das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt. Kapitel 5 beleuchtet die ökologische Selbstgefährdung moderner Gesellschaften im Lichte der funktionalen Differenzierung, der Codes und Programme sowie der Problematik von zu viel und zu wenig Resonanz. Kapitel 6 analysiert Luhmanns Ansatz der ökologischen Rationalität.
Schlüsselwörter
Ökologische Selbstgefährdung, Niklas Luhmann, Systemtheorie, Soziale Systeme, Beobachtung, Differenz, Autopoiesis, Resonanz, Funktionale Differenzierung, Codes und Programme, Ökologische Rationalität.
Häufig gestellte Fragen
Was meint Luhmann mit „ökologischer Selbstgefährdung“?
Luhmann beschreibt, wie die moderne Gesellschaft durch ihre eigene funktionale Differenzierung (z.B. Wirtschaft, Recht, Politik) Umweltveränderungen nur gefiltert wahrnimmt und dadurch ihre eigenen Lebensgrundlagen gefährdet.
Was ist ein autopoietisches System?
Ein autopoietisches System ist ein System, das sich selbst durch seine eigenen Operationen produziert und erhält. Soziale Systeme tun dies laut Luhmann durch Kommunikation.
Warum spricht Ulrich Beck von „ökologischer Blindheit“?
Beck kritisiert, dass die klassische Soziologie Natur und Gesellschaft getrennt betrachtete und Umweltprobleme lange Zeit als außerhalb des sozialen Gefüges stehend ignorierte.
Was bedeutet „Resonanz“ in der Systemtheorie?
Resonanz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, auf Veränderungen in seiner Umwelt (z.B. ökologische Krisen) zu reagieren. Luhmann analysiert, warum Systeme oft „zu viel“ (Panik) oder „zu wenig“ (Ignoranz) Resonanz zeigen.
Was ist ökologische Rationalität?
Es ist der Versuch, ökologische Belange so in die Codes der Teilsysteme (z.B. Preise in der Wirtschaft, Gesetze im Recht) zu übersetzen, dass die Gesellschaft langfristig überlebensfähig bleibt.
- Citation du texte
- Dirk Fross (Auteur), 2001, Die ökologische Selbstgefährdung moderner Gesellschaften in Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2862