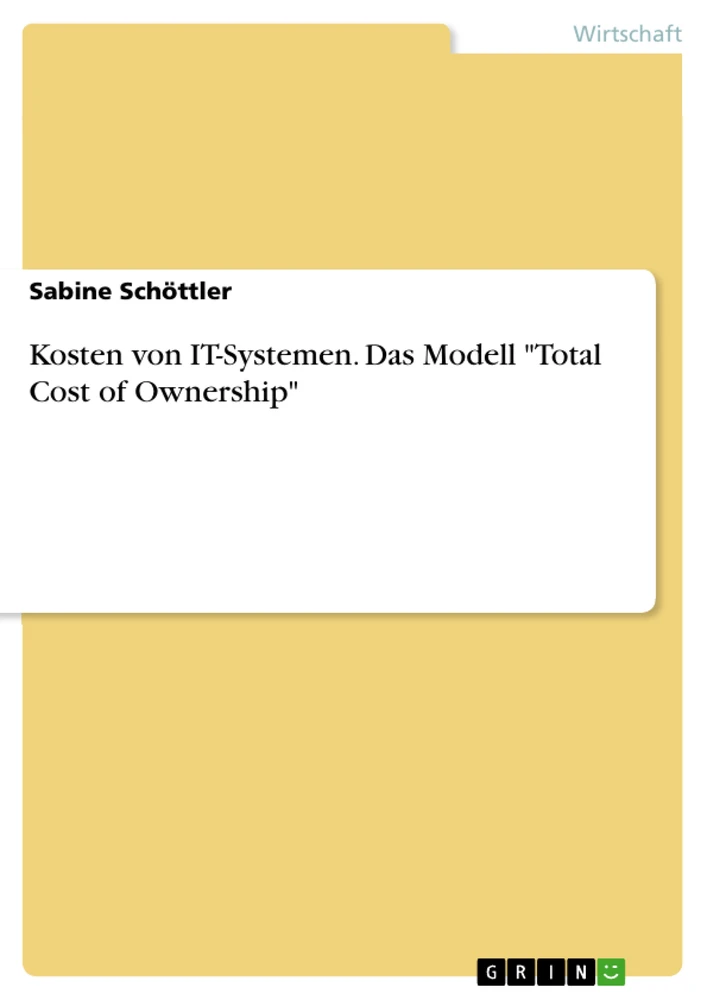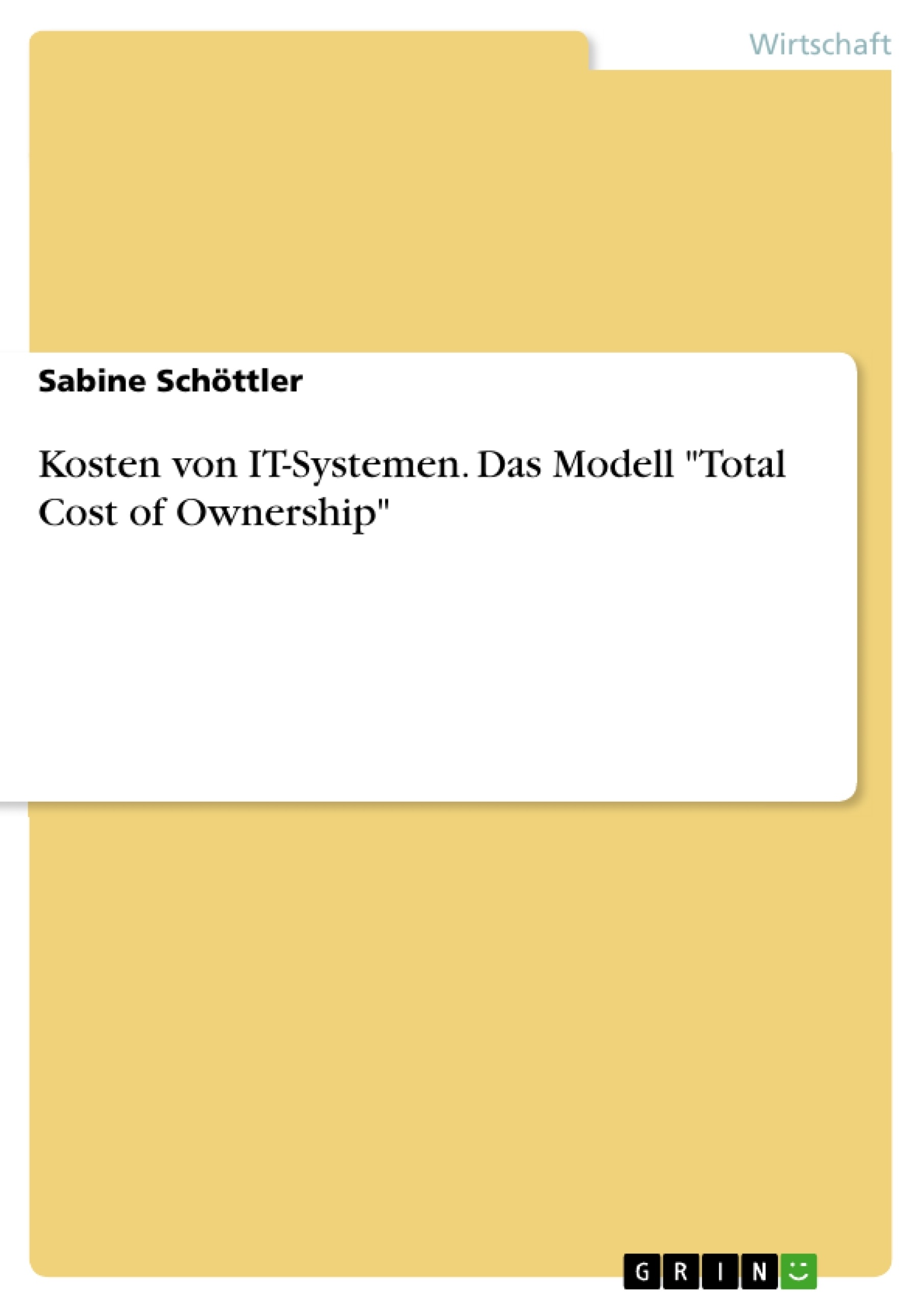Bis in die 80er Jahre gab es für Unternehmen keine Alternative zur Nutzung von Großrechneranlagen, Betriebs- und Softwaresysteme mit einer zentral organisierten Systembetreuung. Bedingt durch diese Strukturen war das Budget innerhalb der Informationsverarbeitung gekennzeichnet durch Investitionen für zentrale Hardwaresysteme und ebenfalls kostenintensive Entwicklungen von Individualsoftware.
Im Laufe der 80er Jahre fand innerhalb der Informationsverarbeitung eine gedankliche Neuorientierung statt. Diese Neuorientierung führte dazu, dass eingesetzte Großrechner überwiegend durch Client-Server-Architekturen abgelöst wurden, somit konnten bisher eingesetzte Verrechnungskonzepte zur korrekten Kostenverrechnung nicht mehr verwendet werden, da eine Anpassung an neue Kostenbestandteile und Verrechnungsgrundsätze erforderlich war.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hintergründe und Schwerpunkte des Total Cost of Ownership-Modells
- 2. Das Total Cost of Ownership-Modell
- 3. Vorteile und Nachteile des Total Cost of Ownership-Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Total Cost of Ownership (TCO)-Modell für IT-Systeme. Die Zielsetzung besteht darin, die Hintergründe, Funktionsweise, Vorteile und Nachteile des Modells zu erläutern.
- Entwicklung des TCO-Modells im Kontext der Veränderung der IT-Landschaft
- Zusammensetzung der Gesamtkosten im TCO-Modell (direkte und indirekte Kosten)
- Vorteile des TCO-Modells für strategische Beschaffungsentscheidungen
- Grenzen und Kritikpunkte des TCO-Modells
- Anwendbarkeit des Modells in Abhängigkeit vom Investitionswert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hintergründe und Schwerpunkte des Total Cost of Ownership-Modells: Das Kapitel beschreibt den Wandel in der IT-Landschaft von zentralisierten Großrechnern hin zu dezentralisierten Client-Server-Architekturen in den 1980er Jahren. Dieser Wandel machte traditionelle Kostenverrechnungsmethoden obsolet und führte zur Entwicklung des TCO-Modells. Es wird hervorgehoben, wie sich der Kostenanteil für Hardware im Vergleich zu Personalkosten und Endbenutzeraktivitäten verändert hat. Die zunehmende Bedeutung von Anwenderschulungen, Applikationsverwaltung und Datenmanagement wird betont, während der Einfluss der IT-Abteilung auf das Gesamtbudget abnimmt. Der Fokus verschiebt sich hin zu Service- und Beratungsfunktionen.
2. Das Total Cost of Ownership-Modell: Dieses Kapitel präsentiert das TCO-Modell, das von der Gartner-Group entwickelt wurde. Es umfasst die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus eines IT-Systems, inklusive direkter und indirekter Kosten. Die Studie der Gartner-Group zeigt einen hohen Anteil von Personalkosten (ca. 70%) im Vergleich zu Hard- und Softwarekosten (ca. 21%). Ein bedeutender Kostenfaktor sind die Endbenutzeraktivitäten, einschließlich Installationen, Datenmanagement und unproduktiver Tätigkeiten. Der Umgang mit dem System selbst stellt einen erheblichen Kostenanteil dar. Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Kosten wird erklärt, wobei das TCO-Modell als Instrument zur Kostenoptimierung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vorgestellt wird.
3. Vorteile und Nachteile des Total Cost of Ownership-Modells: Das Kapitel beleuchtet die Vorteile des TCO-Modells, wie die verbesserte Kostenkontrolle und -transparenz sowie die Unterstützung strategischer Beschaffungsentscheidungen. Die detaillierte Kostenanalyse ermöglicht eine verursachungsgerechte Zuordnung von Kostentreibern und die Bewertung von Lieferanten. Kritisch betrachtet wird die Komplexität und der Zeitaufwand bei der Implementierung des Modells. Die Schwierigkeit der Erhebung und Bewertung indirekter Kosten wird hervorgehoben. Ein weiterer Kritikpunkt ist die ausschließliche Berücksichtigung von Kostenfaktoren und die Vernachlässigung weicher Faktoren. Die Wirtschaftlichkeit des Modells wird als begrenzt bei Investitionsgütern mit geringem Wert eingeschätzt.
Schlüsselwörter
Total Cost of Ownership (TCO), Client-Server-Architekturen, Kostenmanagement, IT-Kosten, Personalkosten, Hard- und Softwarekosten, Endbenutzeraktivitäten, strategische Beschaffung, Kostenanalyse, direkte Kosten, indirekte Kosten, Kostenoptimierung.
Häufig gestellte Fragen zum Total Cost of Ownership (TCO)-Modell
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über das Total Cost of Ownership (TCO)-Modell für IT-Systeme. Er beleuchtet die Hintergründe, Funktionsweise, Vorteile und Nachteile des Modells und untersucht seine Anwendbarkeit in verschiedenen Kontexten.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entwicklung des TCO-Modells im Kontext des Wandels der IT-Landschaft, die Zusammensetzung der Gesamtkosten (direkte und indirekte Kosten), die Vorteile des TCO-Modells für strategische Beschaffungsentscheidungen, Grenzen und Kritikpunkte des Modells und seine Anwendbarkeit in Abhängigkeit vom Investitionswert.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in drei Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beschreibt die Hintergründe und Schwerpunkte des TCO-Modells, Kapitel 2 erläutert das TCO-Modell selbst und Kapitel 3 diskutiert die Vorteile und Nachteile des Modells. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was sind die wichtigsten Punkte zu den Hintergründen des TCO-Modells?
Kapitel 1 beschreibt den Wandel von zentralisierten Großrechnern zu dezentralisierten Client-Server-Architekturen in den 1980er Jahren als Auslöser für die Entwicklung des TCO-Modells. Traditionelle Kostenverrechnungsmethoden erwiesen sich als ungeeignet, und die Bedeutung von Personalkosten, Endbenutzeraktivitäten und Applikationsverwaltung nahm zu, während der Einfluss der IT-Abteilung auf das Gesamtbudget abnahm. Der Fokus verlagerte sich auf Service- und Beratungsfunktionen.
Wie wird das TCO-Modell definiert und welche Kosten umfasst es?
Kapitel 2 stellt das von der Gartner-Group entwickelte TCO-Modell vor. Es umfasst die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus eines IT-Systems, inklusive direkter und indirekter Kosten. Die Studie der Gartner-Group zeigt einen hohen Anteil von Personalkosten (ca. 70%) im Vergleich zu Hard- und Softwarekosten. Endbenutzeraktivitäten stellen einen weiteren bedeutenden Kostenfaktor dar. Der Text erklärt die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Kosten und präsentiert das TCO-Modell als Instrument zur Kostenoptimierung.
Welche Vorteile und Nachteile bietet das TCO-Modell?
Kapitel 3 beschreibt die Vorteile des TCO-Modells wie verbesserte Kostenkontrolle und -transparenz und die Unterstützung strategischer Beschaffungsentscheidungen. Kritisch betrachtet werden die Komplexität und der Zeitaufwand der Implementierung, die Schwierigkeit der Erhebung indirekter Kosten und die Vernachlässigung weicher Faktoren. Die Wirtschaftlichkeit des Modells ist bei geringen Investitionsgütern begrenzt.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem TCO-Modell verbunden?
Schlüsselwörter sind: Total Cost of Ownership (TCO), Client-Server-Architekturen, Kostenmanagement, IT-Kosten, Personalkosten, Hard- und Softwarekosten, Endbenutzeraktivitäten, strategische Beschaffung, Kostenanalyse, direkte Kosten, indirekte Kosten und Kostenoptimierung.
Für wen ist dieser Text relevant?
Dieser Text ist relevant für alle, die sich mit IT-Kostenmanagement, strategischen Beschaffungsentscheidungen und der Optimierung von IT-Systemen befassen. Dies schließt IT-Manager, Finanzverantwortliche und Entscheidungsträger in Unternehmen ein.
- Quote paper
- Sabine Schöttler (Author), 2014, Kosten von IT-Systemen. Das Modell "Total Cost of Ownership", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285807