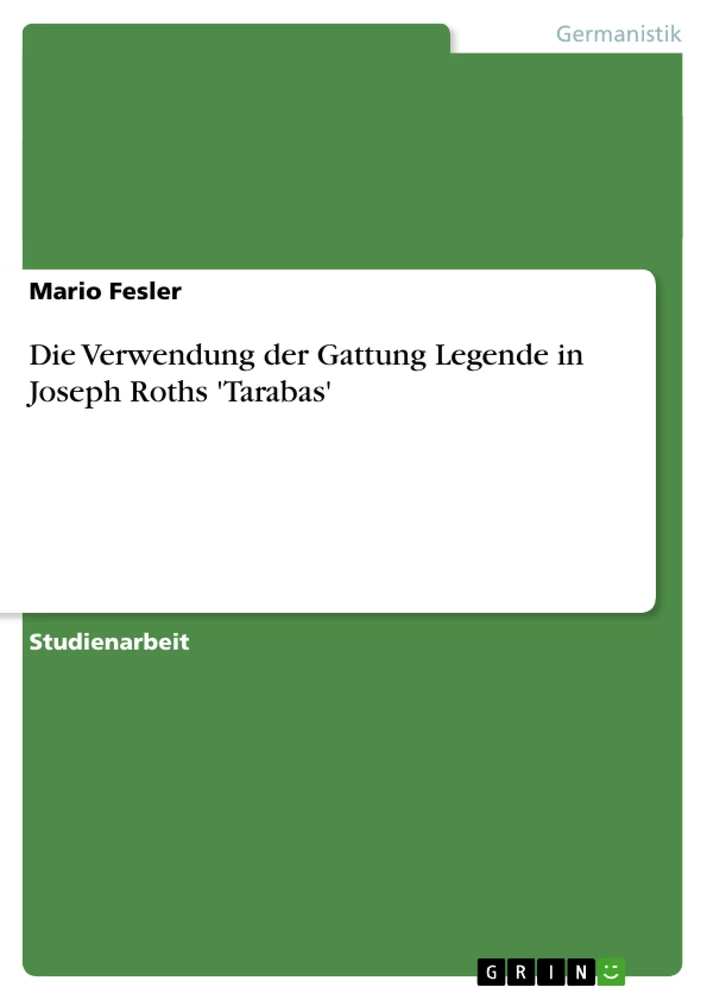„Tarabas“ gehört zu den von der Forschung auffällig wenig beachteten Werken Joseph Roths. Ein Grund hierfür mag sein, dass Roth sich gerade in seinem Spätwerk ganz entschieden zu traditionellen Erzählweisen bekannt hat und die Forschung dazu geneigt hat, Gattungszuordnungen unhinterfragt zu übernehmen. Um Roths Bekenntnis zu Erzähltraditionen soll es in dieser Arbeit gehen, genauer gesagt um Roths Verwendung einer bestimmten Gattung – die der Legende. Hierbei soll zunächst festgestellt werden, was die Legende in ihrer ursprünglichen Form ausmacht, ihre Konstituenten verortet werden um dann anhand dieser zu untersuchen, inwieweit Roth in seiner Erzählung Merkmale und Charakteristika der Gattung verwendet, neu anordnet, ihnen widerspricht und sie unterläuft. Dabei wird aufgezeigt, dass Roths “Tarabas“, der auf den ersten Blick auffallend schlicht scheint, einen ausgesprochen originären und einfallsreichen Umgang mit einer Gattung darstellt, die in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhundert mit Sicherheit nicht mehr als sonderlich zeitgemäß gelten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1. Einleitung
- 2. Die Gattung Legende
- 2.1 Notwendige Beschränkungen
- 2.2 Inhalt und Struktur der Legende
- 2.3 Form und Funktion der Legende
- 3. „Tarabas“
- 3.1. Deutlich erkennbare Legendenhaftigkeit
- 3.2 Die Verwendung der Legendenstruktur
- 3.3 Tarabas – ein „nachvollziehbarer\" Heiliger
- 3.4 Das pervertierte Wunder
- 3.5 Die „Funktion“ von Roths „Tarabas“
- 4. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Joseph Roths Erzählung „Tarabas“ im Hinblick auf dessen Verwendung der Legengattung. Ziel ist es, Roths Umgang mit den Merkmalen und Charakteristika der Legende zu analysieren – wie er sie verwendet, umordnet, ihnen widerspricht oder unterläuft. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, inwieweit „Tarabas“, trotz seines scheinbar schlichten Aufbaus, einen originären Umgang mit einer in den 1930er Jahren als nicht mehr zeitgemäß geltenden Gattung darstellt.
- Roths Verwendung der Legenden-Gattung in „Tarabas“
- Analyse der Struktur und Merkmale der Legende in ihrer ursprünglichen Form
- Vergleich zwischen Roths Interpretation und traditionellen Legendenmerkmalen
- Die Rolle des „pervertierten Wunders“ in Roths Erzählung
- Die „Funktion“ von Roths „Tarabas“ im Kontext der Legendenliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
2.1. Einleitung: Die Einleitung diskutiert den Forschungsstand zu Joseph Roths Werk und hebt die relative Vernachlässigung von „Tarabas“ hervor. Sie begründet die Fokussierung auf Roths Gebrauch der Legenden-Gattung und kündigt die methodische Vorgehensweise an: Zuerst wird die Legende in ihrer ursprünglichen Form definiert, um anschließend Roths Umgang damit in „Tarabas“ zu analysieren. Die Einleitung betont die scheinbare Schlichtheit von „Tarabas“ und die damit verbundene originelle Verwendung der Legenden-Gattung, die im Kontext der 1930er Jahre als nicht mehr zeitgemäß galt. Im Gegensatz zur umstrittenen Gattungszuweisung von Roths „Legende vom heiligen Trinker“ wird „Tarabas“ von Interpreten eher als moderne Legende anerkannt. Die Einleitung deutet an, dass Roths vermeintliche „Naivität“ in „Tarabas“ durch eine genauere Analyse seiner Verwendung gattungsspezifischer Merkmale widerlegt werden kann.
2. Die Gattung Legende: Dieses Kapitel definiert den schwer fassbaren Begriff der Legende. Es betont die Notwendigkeit von begrifflichen Grenzziehungen im Vergleich zu anderen Textsorten. Es beschränkt sich auf die mittelalterliche und christliche Erscheinungsform der Legende, insbesondere auf die Heiligenvita. Der Fokus liegt auf schlicht, fromm und ernst präsentierten Erzählungen religiösen Inhalts, die von heiligen Personen und Wundern handeln und einen göttlichen Heilsplan darstellen. Der klassische Rezipient glaubt an die tatsächliche Existenz des Heiligen und seiner Taten. Das Kapitel beschreibt das „triadische Muster“ der Legende, bestehend aus dem Leben eines Heiligen, seinen Wundertaten und dem göttlichen Heilsplan.
3. „Tarabas“: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung von Legendenmerkmalen in Roths „Tarabas“. Es untersucht, inwieweit Roths Erzählung die Merkmale der Legende aufgreift, umordnet, ihnen widerspricht oder unterläuft. Es geht detailliert auf die Legendenhaftigkeit, die Legendenstruktur und die Darstellung Tarabas als „nachvollziehbaren Heiligen“ ein. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem „pervertierten Wunder“ und der Funktion, die „Tarabas“ im Kontext der Legendenliteratur einnimmt.
Schlüsselwörter
Joseph Roth, Tarabas, Legende, Gattungsmerkmale, Heiligenvita, modernes Erzählen, religiöser Inhalt, Wunder, Heiligkeit, Tradition, Spätwerk.
Joseph Roths "Tarabas": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Joseph Roths Erzählung "Tarabas" im Hinblick auf deren Verwendung der Legenden-Gattung. Der Fokus liegt darauf, wie Roth mit den Merkmalen und Charakteristika der Legende umgeht – wie er sie verwendet, umordnet, ihnen widerspricht oder unterläuft. Die Arbeit untersucht, inwieweit "Tarabas" trotz seines scheinbar schlichten Aufbaus einen originären Umgang mit einer in den 1930er Jahren als nicht mehr zeitgemäß geltenden Gattung darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Roths Verwendung der Legenden-Gattung in "Tarabas", die Analyse der Struktur und Merkmale der Legende in ihrer ursprünglichen Form, den Vergleich zwischen Roths Interpretation und traditionellen Legendenmerkmalen, die Rolle des „pervertierten Wunders“ in Roths Erzählung und die „Funktion“ von Roths "Tarabas" im Kontext der Legendenliteratur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel zur Gattung Legende, ein Kapitel zur Analyse von "Tarabas" und ein Fazit. Die Einleitung diskutiert den Forschungsstand und die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel zur Legende definiert den Begriff und seine Grenzen im Vergleich zu anderen Textsorten, konzentriert sich auf die mittelalterliche und christliche Legende, insbesondere die Heiligenvita, und beschreibt das „triadische Muster“ der Legende. Das Kapitel zu "Tarabas" analysiert die Verwendung von Legendenmerkmalen in Roths Erzählung, untersucht deren Aufgreifen, Umordnung, Widerspruch oder Unterlaufung und legt besonderes Augenmerk auf das „pervertierte Wunder“ und die Funktion der Erzählung im Kontext der Legendenliteratur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Joseph Roth, Tarabas, Legende, Gattungsmerkmale, Heiligenvita, modernes Erzählen, religiöser Inhalt, Wunder, Heiligkeit, Tradition, Spätwerk.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit hebt die relative Vernachlässigung von "Tarabas" in der Forschung hervor und fokussiert auf Roths Gebrauch der Legenden-Gattung, insbesondere im Vergleich zu seiner "Legende vom heiligen Trinker", die eine umstrittene Gattungszuweisung aufweist. "Tarabas" wird von Interpreten eher als moderne Legende anerkannt, und die Arbeit zielt darauf ab, die vermeintliche "Naivität" Roths durch eine genauere Analyse seiner Verwendung gattungsspezifischer Merkmale zu widerlegen.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Das zentrale Argument ist, dass Roths "Tarabas", trotz seiner scheinbaren Schlichtheit und im Kontext der 1930er Jahre, einen originellen Umgang mit der Legenden-Gattung darstellt, indem er deren Merkmale aufgreift, modifiziert und in einem modernen Kontext neu interpretiert.
- Citar trabajo
- Mario Fesler (Autor), 2004, Die Verwendung der Gattung Legende in Joseph Roths 'Tarabas', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28463