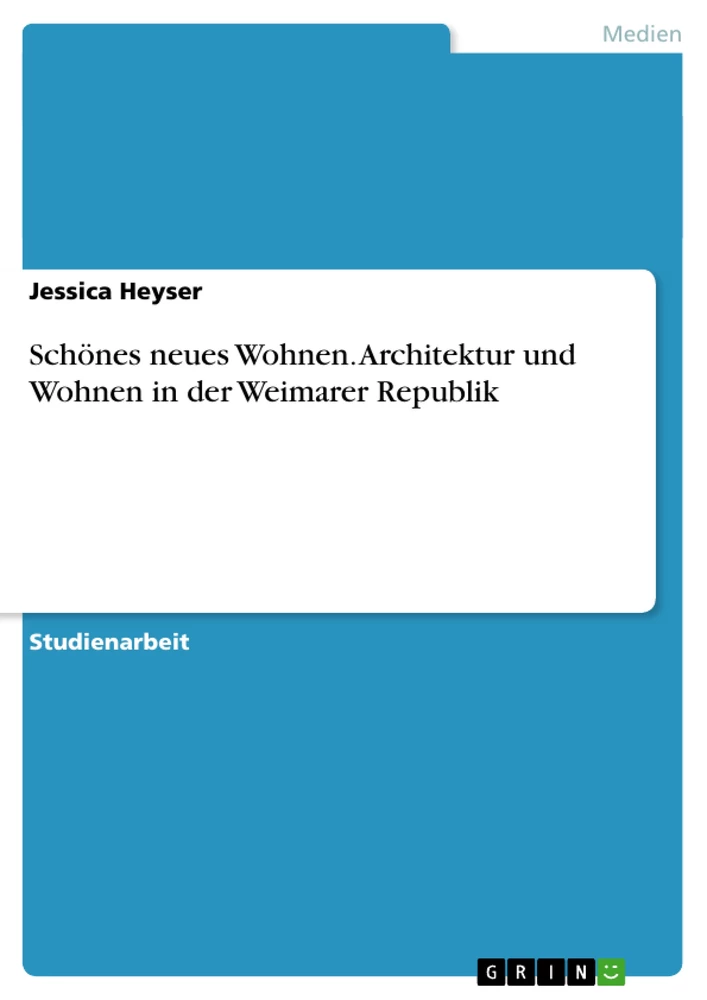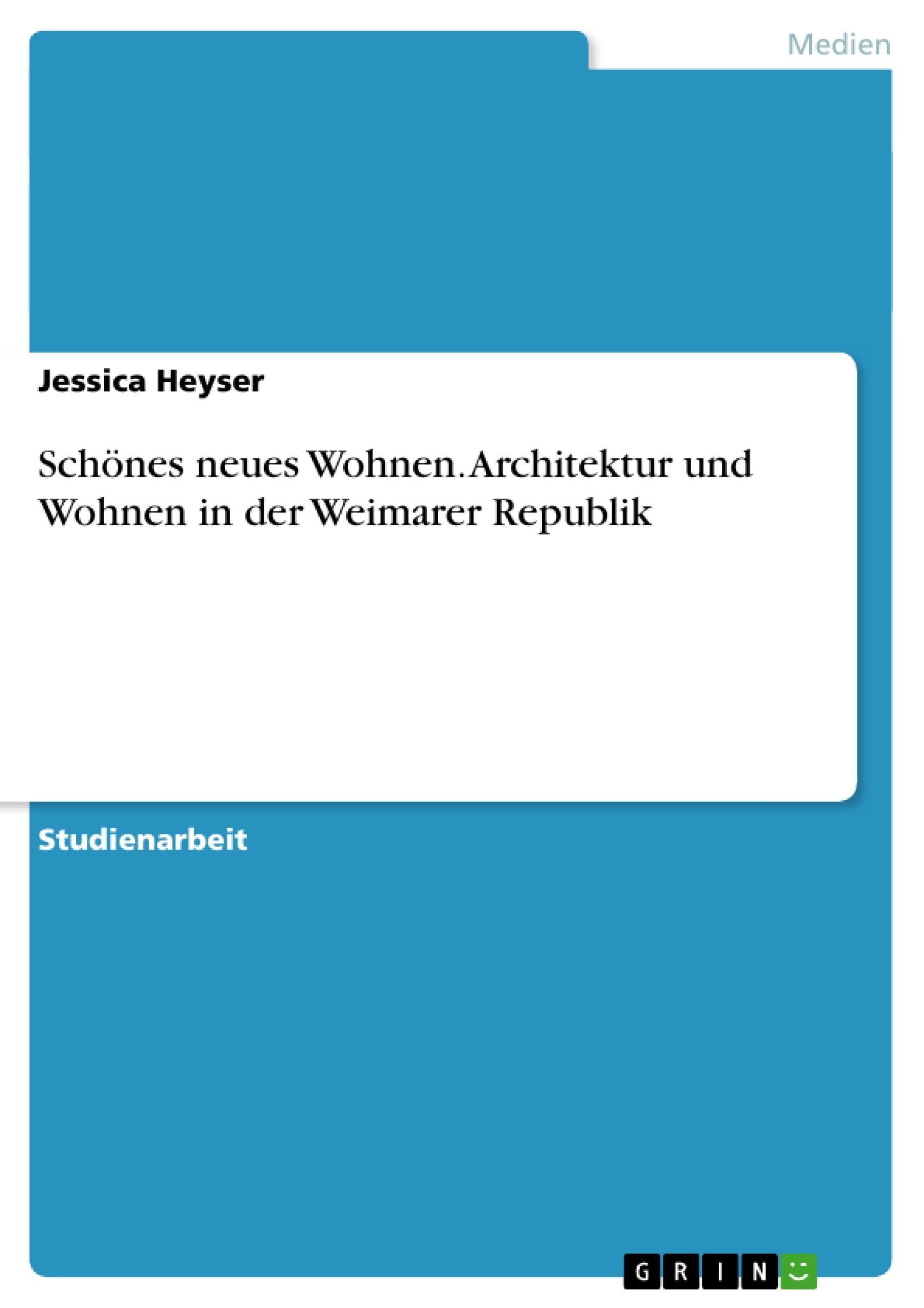„Die mächtigsten Menschen haben immer die Architektur inspiriert. (...) Im Bauwerk soll sich der Stolz, der Sieg über die Schwere, der Wille zur Macht versichtbaren; Architektur ist eine Art Macht-Beredsamkeit in Formen, bald überredend, selbst schmeichelnd, bald bloß befehlend. Das höchste Gefühl von Macht und Sicherheit kommt in dem zum Ausdruck, was großen Stil hat.“
Architektur ist angesiedelt zwischen Kunst und Alltag. Der Gestaltungsanspruch von Architekten und Stadtplaner läßt sich jedoch selten auf ästhetische und funktionale Kriterien beschränken, sondern schließt, explizit oder implizit, wie Nietzsche es in der zitierten Passage energisch hervorhebt, auch einen gesellschaftspolitischen Gestaltungsanspruch ein.
Bauwerke fungieren immer auch als Zeichenträger, die sich indirekt auf Verhaltensweisen von Menschen auswirken. Es bleibt jedoch zu diskutieren, welchen Grad an manipulativer Kraft man ihnen zuspricht.
In architektonischen Entwürfen verkörpern sich aber ebenso individuelle Vorstellungen, ja Träume. Die utopischen Visionen, welche während der Zeit der Weimarer Republik entstanden, geben diesen unmittelbaren Ausdruck.
Innerhalb des Architekturdiskurses geht es immer wieder um die Frage, welches Programm einem Bauwerk zugrunde gelegt werden soll. Bei der konkreten Ausführung eines Bauprojekts spielen außerdem praktische Aspekte eine Rolle wie z.B., auf welche Weise ein Gebäude genutzt werden soll und welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Das Thema Architektur, wie ich bereits versucht habe anzudeuten, eröffnet einen komplexen Problemhorizont, der unterschiedlichste Aspekte, wie soziologische, philosophische, ästhetische etc. beinhaltet. Die Hausarbeit hat die Architektur der Zwanziger Jahre zum Thema. Das Ziel der Arbeit soll darin bestehen, sich dem ‚Neuen Bauen‘ als kulturhistorischem Phänomen anzunähern und weniger darin, die Entwürfe jener Zeit detailliert zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neues Bauen in der Weimarer Republik
- Der Deutsche Werkbund
- Architektonische Form der Utopie. Bruno Taut und „Die Gläserne Kette"
- Das Bauhaus: die Entwicklung einer Idee 1919-1932
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Architektur der Weimarer Republik, insbesondere die Bewegung des „Neuen Bauens“. Sie befasst sich mit der Entwicklung dieser architektonischen Strömung, ihren zentralen Ideen und ihrer Bedeutung im Kontext der damaligen Zeit.
- Der Einfluss des technischen Fortschritts auf die Architektur
- Die Rolle der Utopie und der sozialen Verantwortung in der Architektur
- Der Konflikt zwischen traditioneller und moderner Architektur
- Die Bedeutung des Deutschen Werkbundes und des Bauhauses für die Architektur des Neuen Bauens
- Die verschiedenen Strömungen innerhalb des Neuen Bauens, wie Expressionismus und Neue Sachlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Architektur als Spiegel der Gesellschaft und als Ausdruck von Macht und Idealen dar. Sie führt in das Thema „Neues Bauen“ ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit.
- Neues Bauen in der Weimarer Republik: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung des Neuen Bauens als Reaktion auf den Jugendstil und die traditionelle Architektur. Es beleuchtet die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser Bewegung und die Herausforderungen, denen die Architekten der Weimarer Republik gegenüberstanden.
- Der Deutsche Werkbund: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Deutschen Werkbundes in der Entwicklung des Neuen Bauens. Der Werkbund trug maßgeblich zur Verbreitung neuer Gestaltungsprinzipien bei und förderte den Austausch zwischen Künstlern, Architekten und Handwerkern.
- Architektonische Form der Utopie. Bruno Taut und „Die Gläserne Kette“: Dieses Kapitel widmet sich dem utopischen Aspekt des Neuen Bauens, insbesondere am Beispiel von Bruno Tauts „Gläsernen Kette". Es untersucht die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, die in den utopischen Entwürfen der Architekten zum Ausdruck kommt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf zentrale Begriffe wie „Neues Bauen“, „Architektur der Weimarer Republik“, „Utopie“, „Sozialer Wohnungsbau“, „Expressionismus“, „Neue Sachlichkeit“, „Deutscher Werkbund“, „Bauhaus“ und „technischer Fortschritt“. Die Analyse dieser Schlüsselwörter trägt zum Verständnis der Architekturgeschichte und der Entwicklung des modernen Bauens bei.
- Quote paper
- Jessica Heyser (Author), 2001, Schönes neues Wohnen. Architektur und Wohnen in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28252