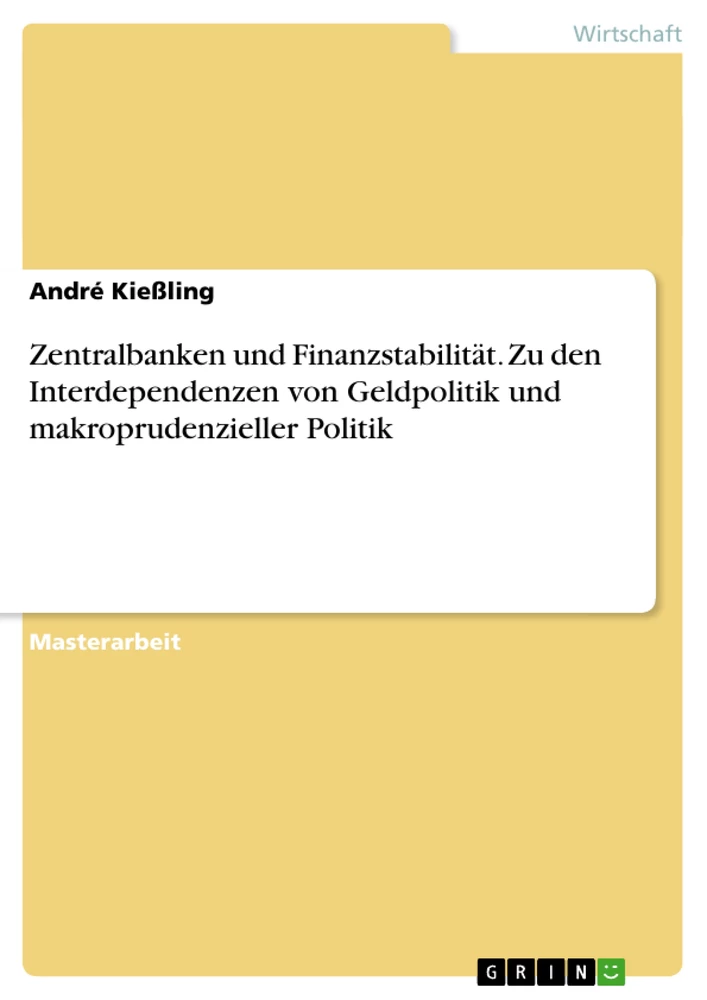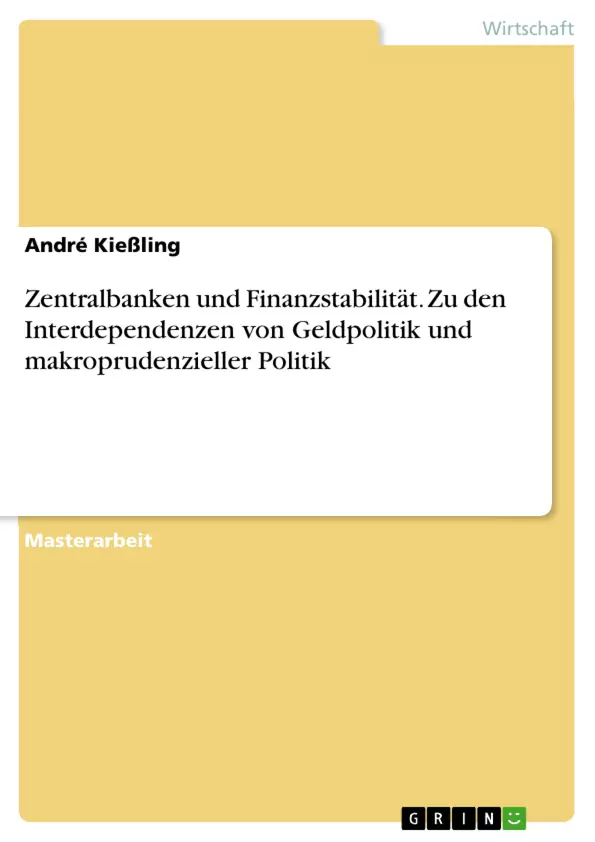Inhaltsangabe:
Die vorliegende Arbeit definiert zuerst den Begriff der Finanzstabilität. Im Anschluss werden Systemrisiken von mikroprudenziellen Risiken abgegrenzt und die Dimensionen aufgezeigt, in denen Systemrisiken auftreten können.
Im dritten Kapitel wird die Wirkung von Geldpolitik auf die Finanzstabilität herausgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den Transmissionsmechanismen und deren Auswirkungen. Der Risikokanal wird wegen seiner besonderen Bedeutung separat behandelt.
Das vierte Kapitel zeigt eingangs auf, was unter makroprudenzieller Politik verstanden wird und stellt dann das verfügbare Instrumentarium vor. Im Anschluss werden die makroprudenzielle Politik und deren zugehörigen Instrumente bewertet.
Kapitel fünf behandelt den gemeinsamen Einsatz von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik für die Finanzstabilität. Zuerst werden die drei wichtigsten Theorieansätze vorgestellt. Danach diskutiert der Text die Wechselwirkungen zwischen den beiden Politikinstrumenten sowie die institutionellen Ausgestaltungsmöglichkeiten eines Finanzstabilitätsmandats. Schließlich werden zwei Modelle zur Abstimmung von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik vorgestellt und anschließend deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und interpretiert.
Kapitel sechs bietet einen Überblick über die bestehenden makroprudenziellen Strukturen auf globaler Ebene sowie in England, den Vereinigten Staaten und dem Euroraum und stellt deren Vor- und Nachteile heraus.
Den Abschluss bildet die Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse.
Einleitung:
Die Finanzkrise mit ihrem Höhepunkt im Jahr 2008 stellte die Verwundbarkeit des weltweiten Finanzsystems bloß. Durch die Pleite der Lehman Brothers Investment Bank und weitere Schockmomente verloren Interbankenmarkt und Kreditmarkt innerhalb kurzer Zeit ihre Funktionsfähigkeit und stellten so eine bedeutende Bedrohung für die Finanzstabilität dar. Durch politische Hilfsprogramme für angeschlagene Banken und die Bereitstellung von Liquidität wurde ein Zusammenbruch des Systems verhindert.
Infolge der Ereignisse wurden und werden Ursachen sowie Vermeidungsstrategien für solche Krisen gesucht. Vor der Finanzkrise betrachteten Politik und Forschung die makroökonomische Politik mit ihren Zielen der Geldwertstabilität und der realwirtschaftlichen Entwicklung als weitgehend unabhängig von der mikroprudenziellen Überwachung einzelner Institute. Die mikroprudenzielle Politik hatte die Aufgabe, die [...].
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Finanzstabilität
- 2.1 Definition
- 2.2 Systemrisiken
- 2.2.1 Unterscheidung von makroprudenziellen und mikroprudenziellen Risiken
- 2.2.2 Unterscheidung von Systemrisiken
- 3 Interdependenz von Geldpolitik und Finanzstabilität
- 3.1 Transmissionskanäle der Geldpolitik
- 3.2 Der Risikokanal
- 4 Makroprudenzielle Politik
- 4.1 Definition
- 4.2 Instrumente
- 4.2.1 Weiche Instrumente
- 4.2.2 Mittlere Instrumente
- 4.2.3 Harte Instrumente
- 4.3 Beurteilung
- 5 Einsatz von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik für die Finanzstabilität
- 5.1 Theoretische Ansätze
- 5.1.1 Modified Jackson Hole Consensus
- 5.1.2 Leaning against the wind vindicated
- 5.1.3 Finanzstabilität und Preisstabilität
- 5.2 Diskussion von Wechselwirkungen
- 5.3 Probleme der institutionellen Ausgestaltung
- 5.3.1 Dualmandat
- 5.3.2 Trennung der Mandate
- 5.4 Modellvergleich zur Abstimmung von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik
- 5.4.1 Modell von Woodford nach Svensson
- 5.4.2 Modell von Cecchetti und Kohler
- 5.4.3 Vergleichende Interpretation der Modelle
- 5.1 Theoretische Ansätze
- 6 Institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik
- 6.1 Internationale Institutionen
- 6.2 Ausgewählte Systembeispiele
- 6.2.1 England
- 6.2.2 Vereinigte Staaten von Amerika
- 6.2.3 Europa
- 6.2.3.1 ESRB und Bankenaufsicht
- 6.2.3.2 Institutionalisierung in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Interdependenzen von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik im Hinblick auf die Finanzstabilität. Ziel ist es, die Wechselwirkungen beider Politikfelder zu analysieren und verschiedene institutionelle Ausgestaltungen zu vergleichen.
- Definition und Bedeutung von Finanzstabilität
- Transmissionskanäle der Geldpolitik und deren Einfluss auf die Finanzstabilität
- Instrumente und Wirksamkeit makroprudenzieller Politik
- Theoretische Ansätze zur Abstimmung von Geld- und makroprudenzieller Politik
- Institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik auf internationaler und nationaler Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Interdependenzen von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik zur Sicherung der Finanzstabilität ein. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Finanzstabilität: Dieses Kapitel definiert Finanzstabilität und beschreibt verschiedene Arten von Systemrisiken. Es unterscheidet zwischen makro- und mikroprudenziellen Risiken und analysiert deren Charakteristika. Die Unterscheidung verdeutlicht die unterschiedlichen Betrachtungsweisen und die Notwendigkeit makroprudentieller Maßnahmen zur Bewältigung systemischer Risiken.
3 Interdependenz von Geldpolitik und Finanzstabilität: Dieses Kapitel analysiert die Wechselwirkungen zwischen Geldpolitik und Finanzstabilität. Es beschreibt die verschiedenen Transmissionskanäle der Geldpolitik und deren Auswirkungen auf das Finanzsystem. Ein wichtiger Aspekt ist die Untersuchung des Risikokanals, der zeigt, wie geldpolitische Maßnahmen ungewollte Nebenwirkungen auf die Stabilität des Finanzsystems haben können.
4 Makroprudenzielle Politik: Dieses Kapitel definiert makroprudenzielle Politik und beschreibt deren Instrumente. Es unterscheidet zwischen weichen, mittleren und harten Instrumenten und analysiert deren jeweilige Wirkungsweise und Effektivität. Der Fokus liegt auf der Steuerung systemischer Risiken und der Vermeidung von Finanzkrisen.
5 Einsatz von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik für die Finanzstabilität: Dieses Kapitel untersucht verschiedene theoretische Ansätze zur Abstimmung von Geld- und makroprudenzieller Politik. Es diskutiert die Wechselwirkungen zwischen beiden Politikfeldern und analysiert die Herausforderungen der institutionellen Ausgestaltung. Insbesondere werden Modelle von Woodford, Svensson und Cecchetti/Kohler verglichen, um die optimalen Koordinierungsmechanismen zu beleuchten.
6 Institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik: Dieses Kapitel analysiert die institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik auf internationaler Ebene und anhand ausgewählter Länderbeispiele (England, USA, Europa). Es beschreibt die Strukturen und Prozesse der Aufsicht und Steuerung sowie deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Der Fokus liegt auf der Analyse der Institutionen und ihrer Rolle in der Gewährleistung der Finanzstabilität.
Schlüsselwörter
Finanzstabilität, Geldpolitik, makroprudenzielle Politik, Systemrisiken, Transmissionskanäle, institutionelle Ausgestaltung, Modellvergleich, Woodford, Svensson, Cecchetti, Kohler, ESRB.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Masterarbeit: Interdependenzen von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik im Hinblick auf die Finanzstabilität
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die komplexen Wechselwirkungen zwischen Geldpolitik und makroprudenzieller Politik zur Sicherung der Finanzstabilität. Sie analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren und vergleicht unterschiedliche institutionelle Gestaltungsformen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition und Bedeutung von Finanzstabilität, die Transmissionskanäle der Geldpolitik und deren Einfluss auf die Finanzstabilität, die Instrumente und die Wirksamkeit makroprudenzieller Politik, verschiedene theoretische Ansätze zur Abstimmung von Geld- und makroprudenzieller Politik und die institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik auf internationaler und nationaler Ebene. Es werden verschiedene Modelle (Woodford, Svensson, Cecchetti/Kohler) verglichen und analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Finanzstabilität (inkl. Systemrisiken), Interdependenz von Geldpolitik und Finanzstabilität, Makroprudenzielle Politik (inkl. Instrumente), Einsatz von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik für die Finanzstabilität (inkl. Modellvergleich), und Institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik (inkl. internationaler und nationaler Beispiele).
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Finanzstabilität, Geldpolitik, makroprudenzielle Politik, Systemrisiken, Transmissionskanäle, institutionelle Ausgestaltung, Modellvergleich, Woodford, Svensson, Cecchetti, Kohler und ESRB.
Welche Arten von Systemrisiken werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet und analysiert verschiedene Arten von Systemrisiken, wobei ein Fokus auf der Unterscheidung zwischen makro- und mikroprudenziellen Risiken liegt, um die Notwendigkeit makroprudentieller Maßnahmen zur Bewältigung systemischer Risiken hervorzuheben.
Welche Instrumente der makroprudenziellen Politik werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt und analysiert verschiedene Instrumente der makroprudenziellen Politik, unterteilt in weiche, mittlere und harte Instrumente, und bewertet deren jeweilige Wirkungsweise und Effektivität bei der Steuerung systemischer Risiken.
Welche theoretischen Ansätze zur Abstimmung von Geld- und makroprudenzieller Politik werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht verschiedene theoretische Ansätze, darunter den "Modified Jackson Hole Consensus", "Leaning against the wind vindicated" und die Beziehung zwischen Finanzstabilität und Preisstabilität. Ein zentraler Bestandteil ist der Vergleich der Modelle von Woodford nach Svensson und Cecchetti und Kohler.
Welche institutionellen Ausgestaltungen der makroprudenziellen Politik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die institutionelle Ausgestaltung der makroprudenziellen Politik auf internationaler Ebene und anhand ausgewählter Länderbeispiele wie England, den Vereinigten Staaten und Europa (inkl. ESRB und der deutschen Institutionalisierung).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Interdependenzen zwischen Geldpolitik und makroprudenzieller Politik im Hinblick auf die Finanzstabilität zu analysieren und verschiedene institutionelle Ausgestaltungen zu vergleichen, um optimale Koordinierungsmechanismen aufzuzeigen.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die Kernaussagen und die zentralen Ergebnisse jedes Kapitels prägnant beschreibt.
- Quote paper
- André Kießling (Author), 2014, Zentralbanken und Finanzstabilität. Zu den Interdependenzen von Geldpolitik und makroprudenzieller Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282374