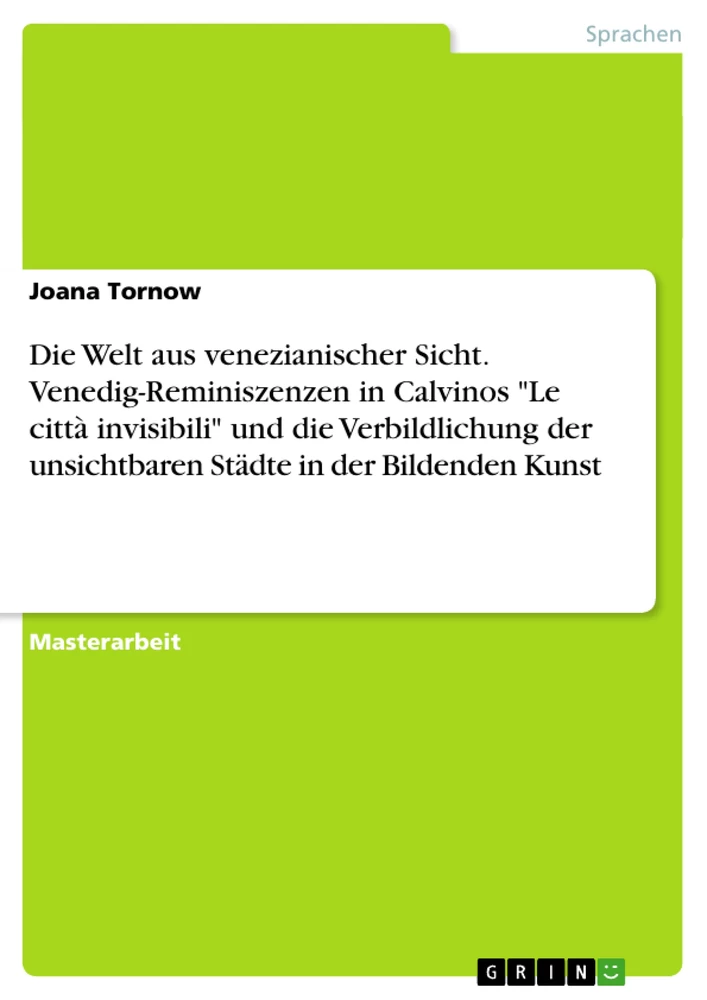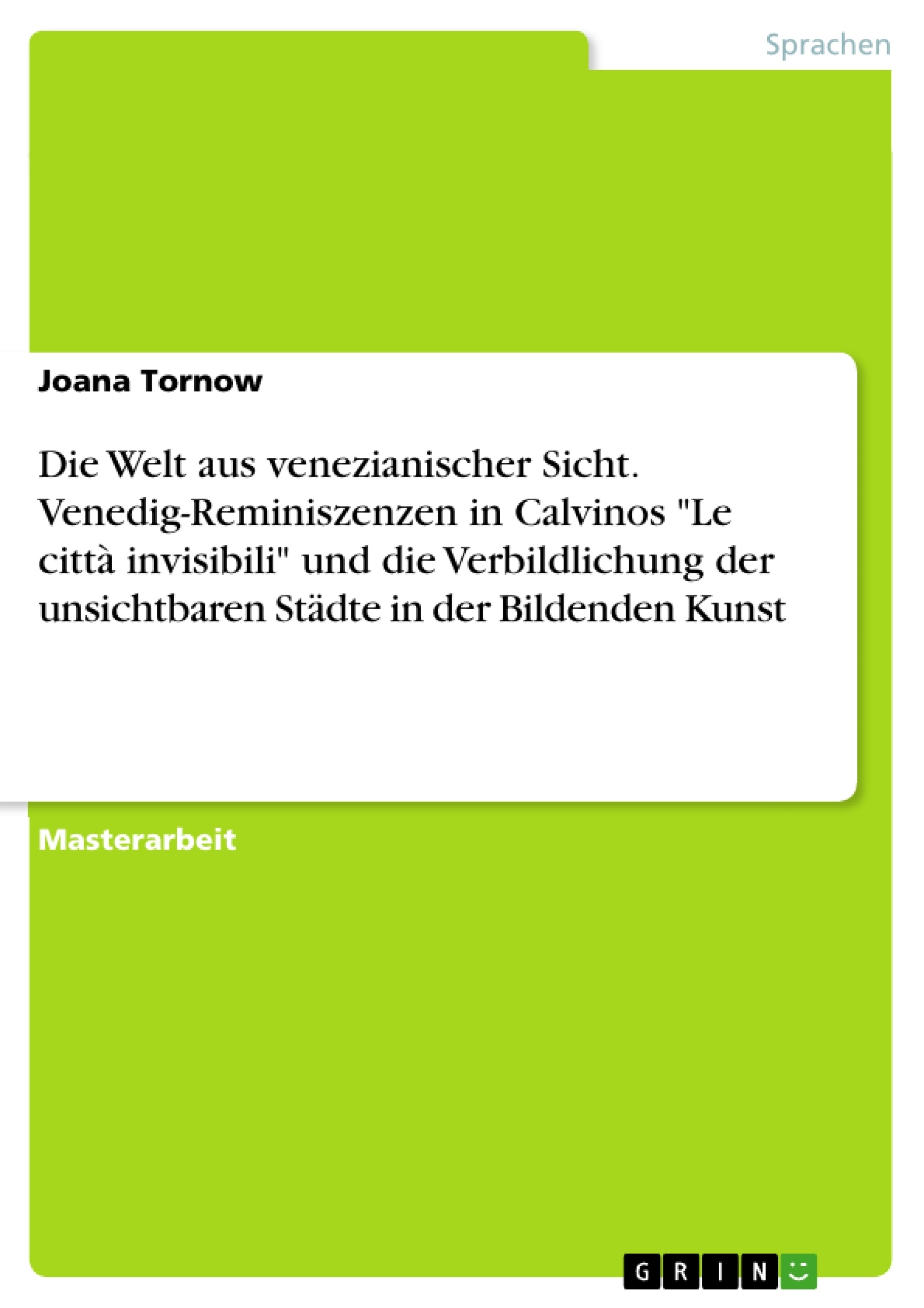Das umfangreiche schriftstellerische Werk Italo Calvinos entstand im Laufe mehrerer Jahrzehnte und ist geprägt durch das Experimentieren mit unterschiedlichen Textgattungen
und das Aufgreifen neuer stilistischer Elemente. Seine Feingespür und sein innovativer Geist, die sich in seiner schriftstellerischen Experimentierfreudigkeit ausdrücken,
haben dazu geführt, dass sein OEvre heute als eines der abwechslungsreichsten Gesamtwerke des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird:
Calvino [...] è tra gli scrittori italiani uno dei più sensibili e innovatori, sempre pronto a comunicare con i segni del tempo e a inserirli in una scrittura che si acuisce nel confronto tra storia e letterature.
Bereits in den Jahren vor seinem Umzug nach Paris, wo Calvino mehr als ein Jahrzehnt seines Lebens verbrachte, setzte er sich intensiv mit den Theorien seiner französischen Kollegen auseinander. Von den Einflüssen des französischen Poststrukturalismus und seinem Interesse für die Ideen der Oulipiens sowie für die Verfahren der strukturalen Textanalyse zeugen insbesondere die Texte des späten Calvino.
Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht 1972 erschienene, sich einer konkreten Gattungszuordnung entziehende Text Le città invisibili (1972), bei dem es sich um eine ré-écriture von Marco Polos Reisebericht Il Milione aus dem 13. Jahrhundert handelt.
Bereits im Jahr 1960 hatte sich Calvino erstmals mit dem Vorhaben einer ré-écriture dieses Textes beschäftigt. Das Projekt kam jedoch erst zehn Jahre später mit dem Entwurf von Le città invisibili zu einer konkreten Realisierung und zwar inhaltlich „arricchito dalla complessità delle sperimentazioni combinatorie degli anni sessanta“.
In seinem formalen, beinahe mathematisch anmutenden Aufbau ist dieser Text wiederholter Ausdruck der Affinität Calvinos gegenüber dem Experimentieren mit nichtliterarischen
Textformen.
Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Text zunächst über den notwendigen Exkurs zu einigen theoretische Grundbegriffen, dessen Ziel es ist, das écriture-Konzept des Autors speziell im Hinblick auf Le città invisibili zu erarbeiten. Das poststrukturalistische Verständnis von Text als intertextuelles Konstrukt wendet Calvino auf seine unsichtbaren Städte an, die ihrerseits als rein intertextuelles Produkt zu verstehen sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Einordnung von Le città invisibili in den poststrukturalistischen und postmodernen Kontext
- 2.1.1 Der Text als intertextuelles Konstrukt
- 2.1.2 Lesen als produktiver Akt
- 2.1.3 écriture, ré-écriture, mythécriture
- 2.1.4 Dekonstruktion und différance
- 2.2 Mythos und Mythenanalyse
- 2.2.1 Begriffsbestimmung
- 2.2.2 Die strukturale Mythenanalyse von Lévi-Strauss
- 2.3 Über Calvinos Umgang mit Intertextualität und Mythos
- 3. Prätext und ré-écriture
- 3.1 Der Prätext: Il Milione
- 3.1.1 Einführung
- 3.1.2 Wahrheitsgehalt und Spannungsaufbau
- 3.2 Die ré-écriture: Le città invisibili
- 3.2.1 Einführung
- 3.2.2 Die Problematik der Gattungszuordnung
- 3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 3.4 Il Milione und Le città invisibili zwischen Beschreibung und Erzählung
- 4. Der venezianische Blick. Venedig-Reminiszenzen in den Città invisibili
- 4.1 Kulturell-historischer Kontext der Stadt Venedig und ihre Bedeutung als Wirtschaftsmacht
- 4.2 Venedig als literarischer Schauplatz und Mythos
- 4.3 Venedig in der Imagination Calvinos - zwischen Archetyp und Utopie
- 4.4 Die Stadt als initiales Dispositiv und das Funktionieren von Erinnerung
- 5. Textanalyse
- 5.1 Vorbemerkung
- 5.2 Città acquatiche
- 5.3 Handel und Handwerk
- 5.4 Die Bedrohungen der (modernen) Stadt
- 6. Die Transformation der erzählten unsichtbaren Städte in eine sichtbare Bildergalerie
- 6.1 Vorüberlegung
- 6.2 Das Verhältnis von Bild-Text und Text-Bild
- 6.3 Die künstlerischen Stadt-Dispositive von Cano und Corrado Brannigan
- 6.4 Bild-Analyse
- 6.4.1 Bauci: Eine Frage der Perspektive
- 6.4.2 Ottavia: Die Stadt als Imitation der Natur
- 6.4.3 Pentesilea: Die Stadt als Makrokosmos
- 6.4.4 Sofronia: Die demontierte Stadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Italo Calvinos Le città invisibili als Réécriture von Marco Polos Il Milione. Die Zielsetzung besteht darin, die venezianischen Reminiszenzen in Calvinos Text aufzuzeigen und deren Verbildlichung in der bildenden Kunst zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den intertextuellen Charakter des Werkes und untersucht die Bedeutung von Mythos und Mythenanalyse im Kontext des poststrukturalistischen und postmodernen Denkens.
- Intertextualität und Réécriture in Le città invisibili
- Die Rolle Venedigs als kultureller und literarischer Mythos
- Die Verbindung von Text und Bild in der Darstellung der unsichtbaren Städte
- Poststrukturalistische und postmoderne Perspektiven auf Text und Interpretation
- Mythenanalyse und ihre Anwendung auf Le città invisibili
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Kontext des Werkes Le città invisibili von Italo Calvino innerhalb seines Gesamtwerks. Sie hebt die experimentelle Natur des Textes und dessen Bezug zum französischen Poststrukturalismus hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Réécriture von Marco Polos Il Milione und die Untersuchung der venezianischen Einflüsse im Werk.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Le città invisibili. Es erörtert Konzepte des Poststrukturalismus, wie die Vorstellung vom Text als intertextuelles Konstrukt, das Lesen als produktiven Akt und die Bedeutung von écriture, ré-écriture und mythécriture. Ferner wird die strukturale Mythenanalyse von Lévi-Strauss vorgestellt und auf Calvinos Umgang mit Intertextualität und Mythos eingegangen.
3. Prätext und ré-écriture: Dieses Kapitel vergleicht Il Milione und Le città invisibili als Prätext und Réécriture. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Werken, sowohl in Bezug auf Form und Inhalt als auch auf ihren narrativen Ansatz. Der venezianische Blick Marco Polos wird als prägender Faktor für beide Texte herausgestellt.
4. Der venezianische Blick. Venedig-Reminiszenzen in den Città invisibili: Dieses Kapitel untersucht den kulturell-historischen Kontext Venedigs und seine Bedeutung als Wirtschaftsmacht und literarischer Schauplatz. Es analysiert die Rolle Venedigs in Calvinos Imagination, zwischen Archetyp und Utopie, und untersucht die Stadt als initiales Dispositiv und die Funktion von Erinnerung.
5. Textanalyse: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse von Le città invisibili, unterteilt in Abschnitte über aquatische Städte, Handel und Handwerk, und die Bedrohungen der modernen Stadt. Es beleuchtet die verschiedenen Facetten der unsichtbaren Städte und ihre Bedeutung im Kontext des gesamten Werkes.
6. Die Transformation der erzählten unsichtbaren Städte in eine sichtbare Bildergalerie: Dieses Kapitel untersucht die visuelle Darstellung der unsichtbaren Städte und das Verhältnis zwischen Text und Bild. Es analysiert ausgewählte künstlerische Interpretationen der Städte und deren Bedeutung für das Verständnis des Textes.
Schlüsselwörter
Italo Calvino, Le città invisibili, Il Milione, Marco Polo, Venedig, Intertextualität, Réécriture, Poststrukturalismus, Postmoderne, Mythos, Mythenanalyse, Textanalyse, Bildanalyse, Stadt, Utopie, Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen zu Italo Calvinos "Le città invisibili"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Italo Calvinos „Le città invisibili“ als eine Réécriture (Um-Schreibung) von Marco Polos „Il Milione“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der venezianischen Reminiszenzen in Calvinos Text und deren visueller Darstellung in der bildenden Kunst. Die Arbeit beleuchtet den intertextuellen Charakter des Werkes und untersucht die Bedeutung von Mythos und Mythenanalyse im Kontext des poststrukturalistischen und postmodernen Denkens.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf poststrukturalistischen und postmodernen Theorien, insbesondere auf Konzepten der Intertextualität, des Lesens als produktiven Akts, der écriture, ré-écriture und mythécriture. Die strukturale Mythenanalyse von Lévi-Strauss spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Umgang Calvinos mit Intertextualität und Mythos wird detailliert untersucht.
Wie wird der Vergleich zwischen "Il Milione" und "Le città invisibili" angestellt?
„Il Milione“ wird als Prätext zu „Le città invisibili“ betrachtet. Die Arbeit vergleicht beide Werke hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Form, Inhalt und narrativem Ansatz. Der venezianische Blick Marco Polos wird als prägender Einfluss für beide Texte identifiziert.
Welche Rolle spielt Venedig in "Le città invisibili"?
Die Arbeit untersucht den kulturellen und historischen Kontext Venedigs als Wirtschaftsmacht und literarischen Schauplatz. Sie analysiert Venedigs Rolle in Calvinos Imagination – zwischen Archetyp und Utopie – und betrachtet die Stadt als initiales Dispositiv und die Funktion der Erinnerung.
Wie wird der Text von "Le città invisibili" analysiert?
Die Textanalyse konzentriert sich auf verschiedene Aspekte der „unsichtbaren Städte“, unterteilt in Abschnitte über aquatische Städte, Handel und Handwerk sowie die Bedrohungen der modernen Stadt. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Facetten der Städte und deren Bedeutung im Kontext des Gesamtwerkes.
Wie wird das Verhältnis von Text und Bild behandelt?
Die Arbeit untersucht die visuelle Darstellung der unsichtbaren Städte und das Verhältnis zwischen Text und Bild. Sie analysiert ausgewählte künstlerische Interpretationen der Städte (von Cano und Corrado Brannigan) und deren Beitrag zum Verständnis des Textes. Es wird das Verhältnis von Bild-Text und Text-Bild untersucht. Beispielhafte Bildanalysen (Bauci, Ottavia, Pentesilea, Sofronia) zeigen unterschiedliche Perspektiven auf die Städte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Prätext und Réécriture, Der venezianische Blick, Textanalyse und Die Transformation der erzählten unsichtbaren Städte in eine sichtbare Bildergalerie. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Italo Calvino, Le città invisibili, Il Milione, Marco Polo, Venedig, Intertextualität, Réécriture, Poststrukturalismus, Postmoderne, Mythos, Mythenanalyse, Textanalyse, Bildanalyse, Stadt, Utopie, Erinnerung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die venezianischen Reminiszenzen in Calvinos „Le città invisibili“ aufzuzeigen und deren Verbildlichung in der bildenden Kunst zu analysieren. Sie untersucht den intertextuellen Charakter des Werkes und die Bedeutung von Mythos und Mythenanalyse im Kontext des poststrukturalistischen und postmodernen Denkens.
- Citation du texte
- Joana Tornow (Auteur), 2013, Die Welt aus venezianischer Sicht. Venedig-Reminiszenzen in Calvinos "Le città invisibili" und die Verbildlichung der unsichtbaren Städte in der Bildenden Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280276