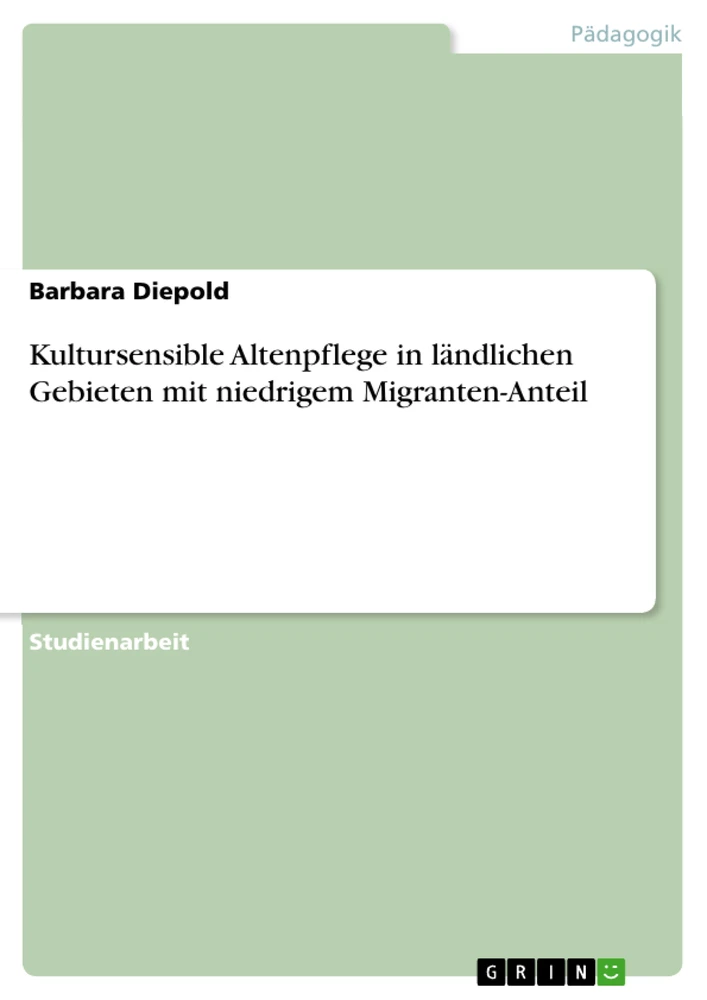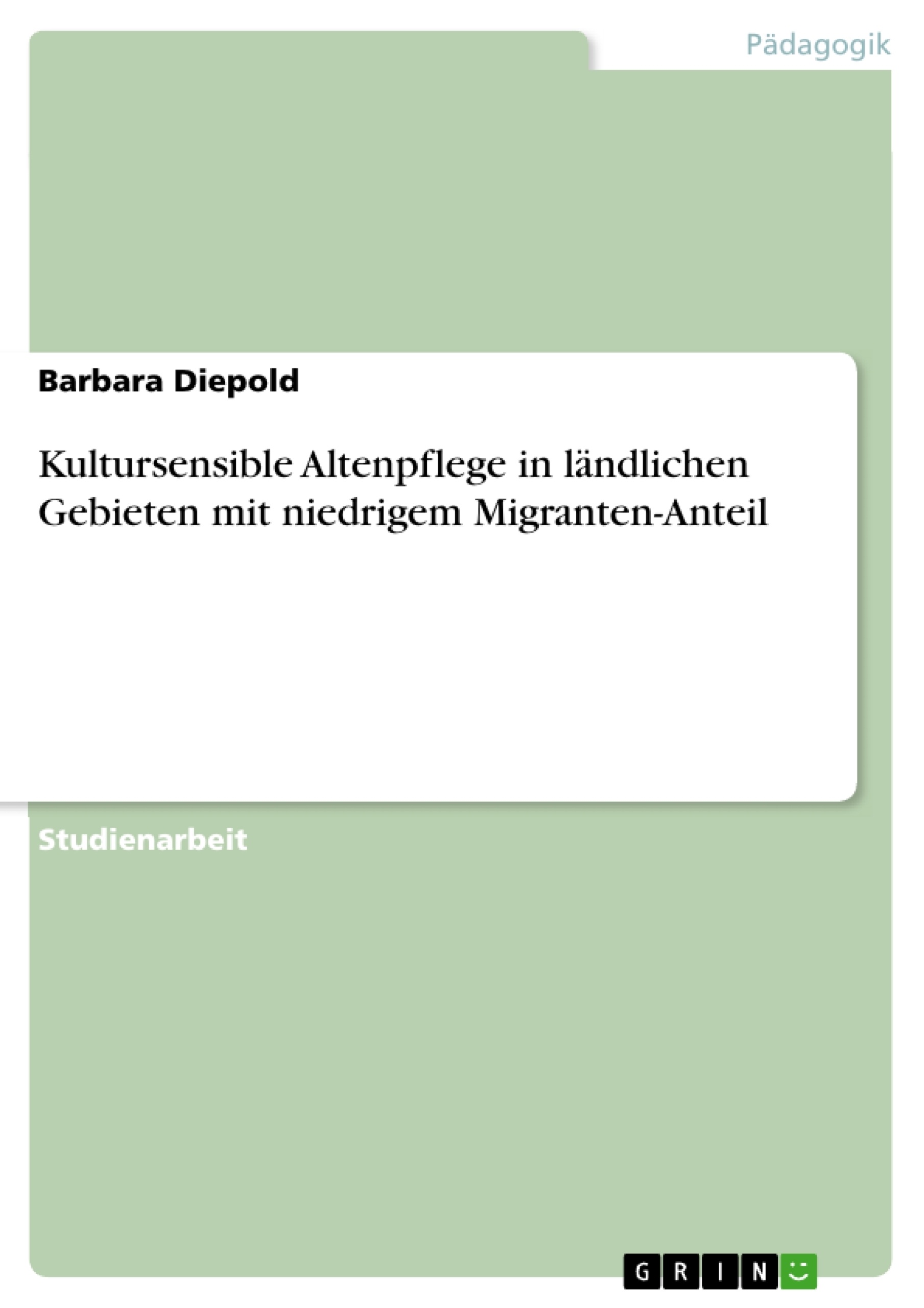Als in den fünfziger Jahren Gastarbeiter angeworben wurden, ging die deutsche Gesellschaft von Rückkehrabsichten derselben in ihre jeweiligen Heimatländer aus. Auch von Seiten der Politik wurde immer wieder betont, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Zuwanderungsland sei (Schmidt 2003, S. 13). Eine Auffassung, die heute angesichts demografischen Wandels und schrumpfender deutscher Bevölkerung auch von politischer Seite revidiert wurde und in der Erkenntnis mündete, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Zuwanderungsland ist (ebd.). Dies bedeutete jedoch zugleich anzuerkennen, dass die Migranten bis an ihr Lebensende bleiben und nicht im Alter in ihre Heimatländer zurückkehren.
Zuwanderung wird in Öffentlichkeit, Politik und (Integrations-)Forschung vor allem als großstädtisches Thema bzw. als auf Ballungsgebiete zentriert wahrgenommen (Schader, 2011, S. 7). Die Bedingungen für Migranten im ländlichen Raum finden erst seit kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der Integrationsforschung (a.a.O., S. 11). Ihre wesentlich geringere Präsenz im ländlichen Raum im Verbund mit den oft knapp bemessenen finanziellen Lagen der kleineren Gemeinden, wirkt sich nicht nur erschwerend auf die Integrationsbemühungen sowohl der Institutionen und Einrichtungen vor Ort als auch der Migranten selbst aus (ebd.; z.B. S. 112f). Somit nimmt es nicht wunder, dass auch in der ambulanten Altenpflege die Auswirkungen spürbar sind. So zeigt sich, dass in ländlichen Gebieten 71% der ambulanten Pflegedienste keinen Kontakt zu Patienten mit Migrationshintergrund haben (Kohls 2012, S 63f). Dies hat zur Folge, dass kultursensible Altenpflege hier noch kaum angekommen ist.
Da die Autorin dieser Arbeit selbst lange Zeit in der ambulanten Altenpflege tätig war, soll in dieser Hausarbeit folgender Frage nachgegangen werden: Wie kann für kultursensible Pflege in der ambulanten Altenpflege im ländlichen Raum sensibilisiert werden, wenn die Wichtigkeit dieses Themas von den Pflegenden kaum erkannt wird?
Auf Grundlage von Maßnahmen und Aspekten der Personalentwicklung fußend
sollen Selbstlernprozesse in Form von Selbstgesteuertem Lernen für eine kultursensible ambulante Altenpflege angestoßen werden
Hierzu werden zunächst die Fachtermini erläutert, um dann im 3. Abschnitt die lerntheoretischen Grundlagen des Kognitivismus und des Konstruktivismus kurz zu beleuchten und Rahmenbedingungen für Selbstlernprozesse auszuloten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffserklärung
- 2.1 Der Begriff der Kultur
- 2.2 Kultursensible Pflege
- 2.3 Interkulturelle und transkulturelle Kompetenzen
- 3 Lerntheoretische Grundlagen
- 3.1 Der Kognitivismus
- 3.2 Der Konstruktivismus
- 3.4 Rahmenbedingungen für Selbstlernprozesse
- 4 Das praktische Arrangement
- 4.1 Förderung der interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter
- 4.2 Multikultureller Teams
- 4.3 Konstruktive Umsetzungen mit Vertiefung und Erweiterung der erworbenen Kompetenzen am Patienten und in seinem Umfeld
- 5 Fazit mit Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie kultursensible Pflege in der ambulanten Altenpflege im ländlichen Raum gefördert werden kann, insbesondere in einem Kontext, in dem die Wichtigkeit dieses Themas von den Pflegenden kaum erkannt wird. Sie untersucht die Rolle von Selbstlernprozessen, gestützt auf Maßnahmen und Aspekten der Personalentwicklung, um eine kultursensible ambulante Altenpflege zu fördern.
- Einführung des Konzepts der kultursensitiven Pflege und seiner Bedeutung im ländlichen Raum.
- Analyse lerntheoretischer Grundlagen, insbesondere des Kognitivismus und des Konstruktivismus, im Kontext von Selbstlernprozessen.
- Prüfung der Rolle eines interkulturellen Managements bei der Implementierung kultursensitiver Pflege in der Praxis.
- Bewertung der Notwendigkeit von Investitionen in inter- und transkulturelle Kompetenzen der Mitarbeiter.
- Diskussion der Möglichkeiten zur Förderung von Akzeptanz und Motivation für Fort- und Weiterbildungen im Bereich der kultursensitiven Altenpflege.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der kultursensitiven Pflege im ländlichen Raum dar, wo der Kontakt zu Patienten mit Migrationshintergrund oft begrenzt ist. Die Arbeit untersucht, wie Selbstlernprozesse zur Sensibilisierung für kultursensible Pflege angestoßen werden können. Kapitel 2 definiert die Begriffe "Kultur", "kultursensible Pflege" und "interkulturelle und transkulturelle Kompetenzen". Kapitel 3 beleuchtet die lerntheoretischen Grundlagen des Kognitivismus und Konstruktivismus und erörtert die Rahmenbedingungen für Selbstlernprozesse. Kapitel 4 beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung von interkulturellem Management in der Altenpflege, wobei die Förderung interkultureller Kompetenzen der Mitarbeiter im Fokus steht.
Schlüsselwörter
Kultursensible Pflege, ambulante Altenpflege, ländlicher Raum, Selbstlernprozesse, interkulturelles Management, Personalentwicklung, interkulturelle Kompetenzen, transkulturelle Kompetenzen, Kognitivismus, Konstruktivismus, Migranten, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet kultursensible Pflege im ländlichen Raum?
Kultursensible Pflege berücksichtigt die kulturellen Hintergründe und Bedürfnisse von Patienten. Im ländlichen Raum ist dies eine Herausforderung, da dort oft weniger Kontakt zu Migranten besteht und das Thema von Pflegenden seltener erkannt wird.
Warum ist das Thema Migration auch für ländliche Gemeinden relevant?
Entgegen früheren Annahmen bleiben viele Migranten bis ins hohe Alter in Deutschland. Auch in kleineren Gemeinden wächst die Zahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund, was die ambulante Pflege vor neue Aufgaben stellt.
Wie können Pflegende für dieses Thema sensibilisiert werden?
Die Arbeit schlägt Selbstlernprozesse und Maßnahmen der Personalentwicklung vor, um interkulturelle Kompetenzen auch dann zu fördern, wenn die Relevanz im Arbeitsalltag zunächst nicht offensichtlich erscheint.
Welche lerntheoretischen Grundlagen werden genutzt?
Es werden der Kognitivismus und der Konstruktivismus herangezogen, um Rahmenbedingungen für effektive Selbstlernprozesse in der Pflegepraxis zu definieren.
Was versteht man unter interkultureller Kompetenz in der Altenpflege?
Es ist die Fähigkeit, professionell und empathisch mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung umzugehen, Sprachbarrieren zu überwinden und kulturell bedingte Vorstellungen von Krankheit und Pflege zu respektieren.
- Citation du texte
- Barbara Diepold (Auteur), 2014, Kultursensible Altenpflege in ländlichen Gebieten mit niedrigem Migranten-Anteil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/279817