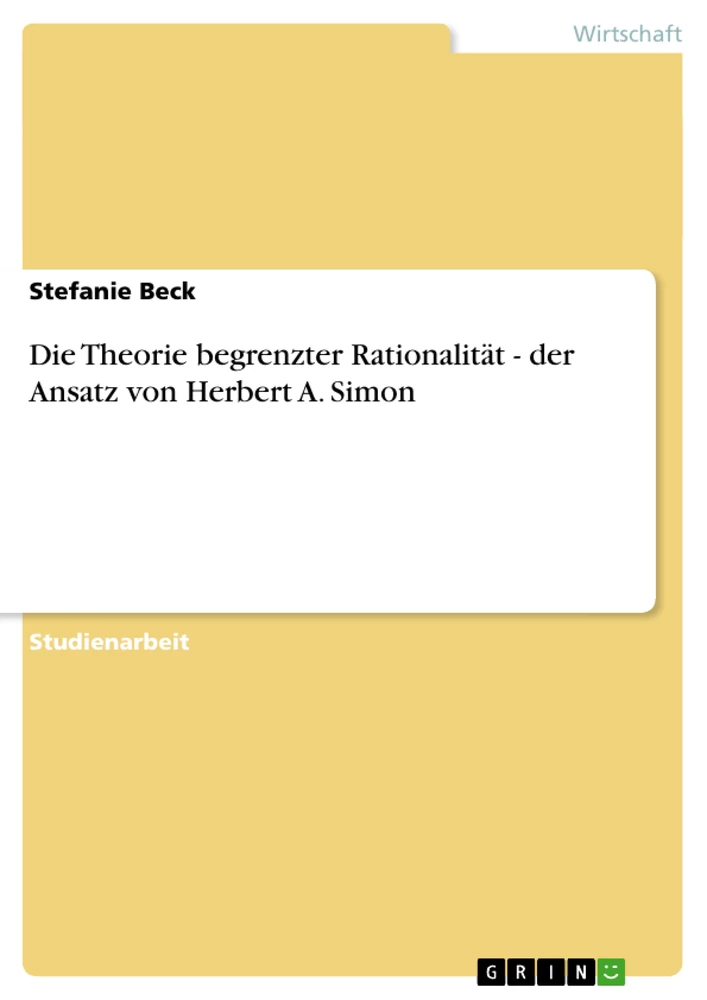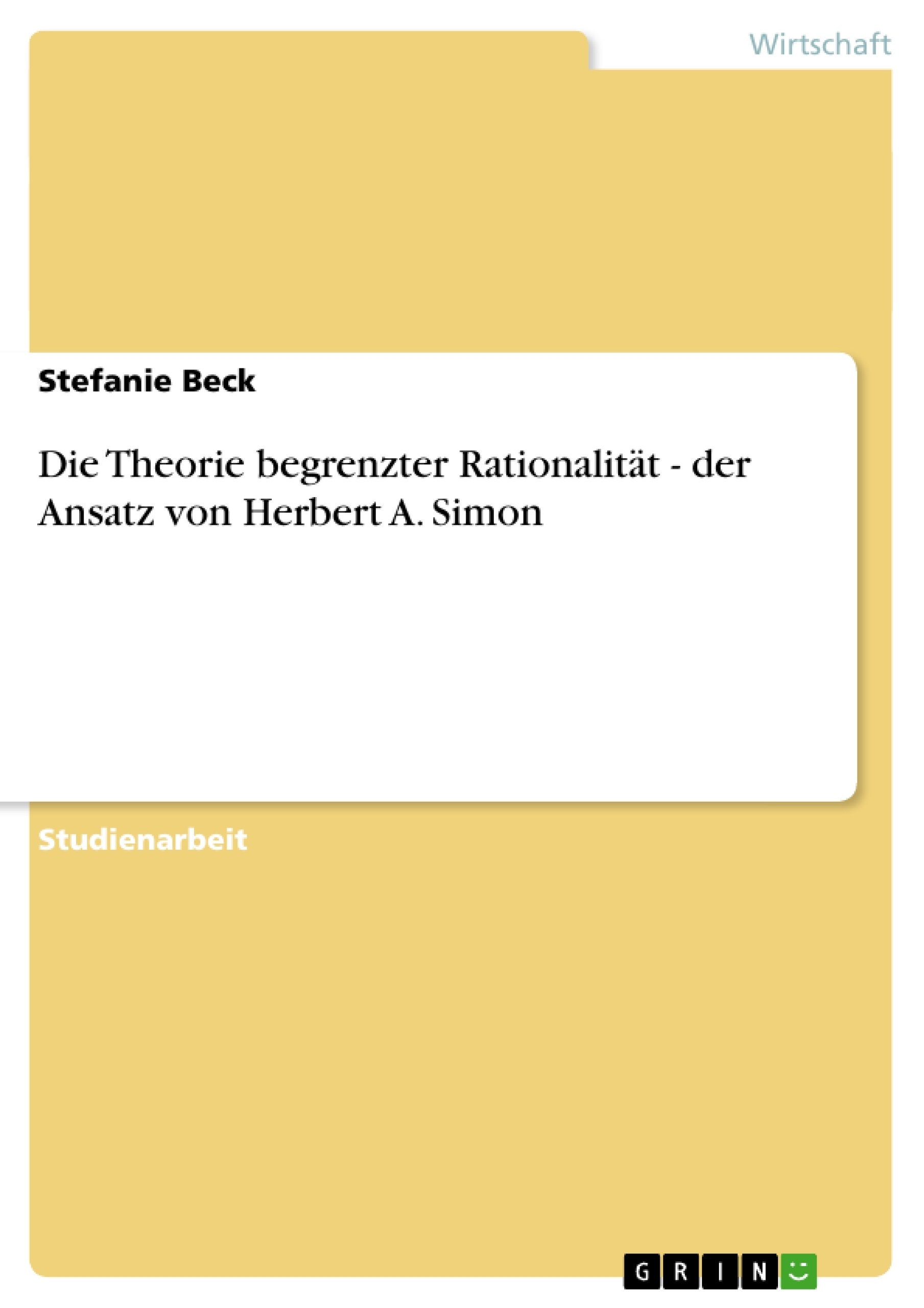Niemand kann sich in der Normalität seines Lebens den alltäglich auftauchenden Entscheidungssituationen entziehen. Man wäre beinahe versucht zu sagen, dass Entscheidungen ebenso zu den elementaren Bestandteilen des Lebens gehören, wie die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen nach Schlaf oder der Aufnahme von Nahrung. Doch in kaum einer Situation, in der wir uns der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen stellen müssen, sind die Anforderungen, die die jeweilige Entscheidung an uns stellt, gleich. Die morgendliche Wahl zwischen Kaffee und Tee fällt den meisten wohl nicht all zu schwer. Dies liegt vor allem daran, dass die Anzahl der Alternativen, zwischen denen ge wählt werden kann begrenzt ist, die Folgen der Wahl nicht all zu schwerwiegend sind, diese Situation für die meisten nicht neu ist und somit vielleicht schon der Routine entspricht. Während routinisierte Entscheidungen dem Entscheidungsträger zumeist nicht all zu viel abverlangen, gibt es eine Vielzahl von Gegebenheiten unter denen das Treffen von Entscheidungen erhebliche Anforderungen stellt. Hierzu zählen im Besonderen...
... neuartige Entscheidungssituationen, in denen der Entscheidungsträger auf
keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen kann,
... Entscheidungssituationen, die auf Grund der immensen Anzahl an Alternativen
und möglichen Folgen der Entscheidungen sehr unüberschaubar und komplex sind, ... Entscheidungen unter Unsicherheit, bei denen die möglichen Folgen nur auf
Basis von Wahrscheinlichkeiten antizipiert werden können, ... sowie Situationen in denen die Entscheidung mit großen Risiken oder
schwerwiegenden Konsequenzen verbunden sind und somit ein großes Maß an Rationalität und Voraussicht vom Entscheidungsträger fordern.
Beispielhaft seien hier strategische Entscheidungen genannt, wie sie im Rahmen von Unternehmen getroffen werden. Sie gestalten sich häufig sehr komplex und sind oftmals mit großen Ausgaben verbunden und fordern somit wohl überdachte Entscheidungen.
Unter welchen Umständen Entscheidungen im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext als rational gelten, mit welchen Hilfsmitteln die „traditionelle“ Ökonomie 1 objektive Rationalität gewährleisten will und in welchem Maße rationales Handeln in den uns Tag täglich begegnenden Entscheidungssituationen nach Herbert Simon’s Auffassung tatsächlich möglich ist, ist Gegenstand dieser Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Entscheidungssituationen prägen das Bild unseres Alltags
- Rationalitätskonzepte & das wirtschaftswissenschaftliche Menschenbild.
- Die verschiedenen Rationalitätskonzepte der Sozialwissenschaften
- Der allgemeine Begriff der Rationalität.
- Rationalität aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht.
- Abschließender Vergleich der vorgestellten Rationalitätsbegriffe
- Das Menschenbild der „traditionellen“ Ökonomie..
- Ökonomische Konzepte der rationalen Entscheidungsfindung.
- Die Maximin-Regel – „,the Max-min Rule“.
- Entscheidungen bei Unsicherheit -,,the Probabilistic Rule“.
- Herbert Simon's Theorie der begrenzten Rationalität
- Der,,Homo organisans“.
- Die Anforderungen der „traditionellen“ Ökonomie und ihre Grenzen.
- Die Grenzen menschlicher Rationalität
- Unvollständigkeit des Wissens & der Bereich der Verhaltensmöglichkeiten...
- Reaktionen aus Gewohnheit & persönliche Antizipationen
- Absolute Maximierung vs. relative Maximierung...
- Brian J. Loasby und seine Kritik an Herbert Simon's Theorie.
- Wann sind Herbert Simon's Erkenntnisse hilfreich?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Theorie der begrenzten Rationalität, die von Herbert A. Simon entwickelt wurde. Die Arbeit beleuchtet die Schwächen des traditionellen ökonomischen Menschenbildes, welches von vollständiger Rationalität ausgeht, und analysiert die Grenzen menschlichen Entscheidungsverhaltens.
- Die verschiedenen Rationalitätskonzepte der Sozialwissenschaften
- Die Grenzen menschlicher Rationalität und Entscheidungsfindung
- Der Einfluss von Gewohnheit, Wissen und Antizipation auf Entscheidungen
- Die Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Maximierung
- Die Kritik von Brian J. Loasby an Herbert Simons Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 stellt die alltägliche Bedeutung von Entscheidungssituationen heraus und verdeutlicht, wie unterschiedlich die Anforderungen an Entscheidungen sein können.
- Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Rationalitätskonzepte in den Sozialwissenschaften, insbesondere den allgemeinen und den wirtschaftswissenschaftlichen Begriff der Rationalität. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konzepte herausgearbeitet.
- Kapitel 3 beschäftigt sich mit ökonomischen Konzepten der rationalen Entscheidungsfindung und stellt die Maximin-Regel sowie die Probabilistic Rule vor.
- Kapitel 4 führt in Herbert Simons Theorie der begrenzten Rationalität ein. Es werden die zentralen Elemente der Theorie, wie der „Homo organisans“ und die Grenzen menschlicher Rationalität, erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind begrenzte Rationalität, Herbert A. Simon, Homo organisans, Entscheidungsverhalten, Rationalitätskonzepte, Wirtschaftswissenschaften, Nutzenmaximierung, Gewohnheit, Antizipation, Kritik, Brian J. Loasby.
- Quote paper
- Stefanie Beck (Author), 2003, Die Theorie begrenzter Rationalität - der Ansatz von Herbert A. Simon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27773