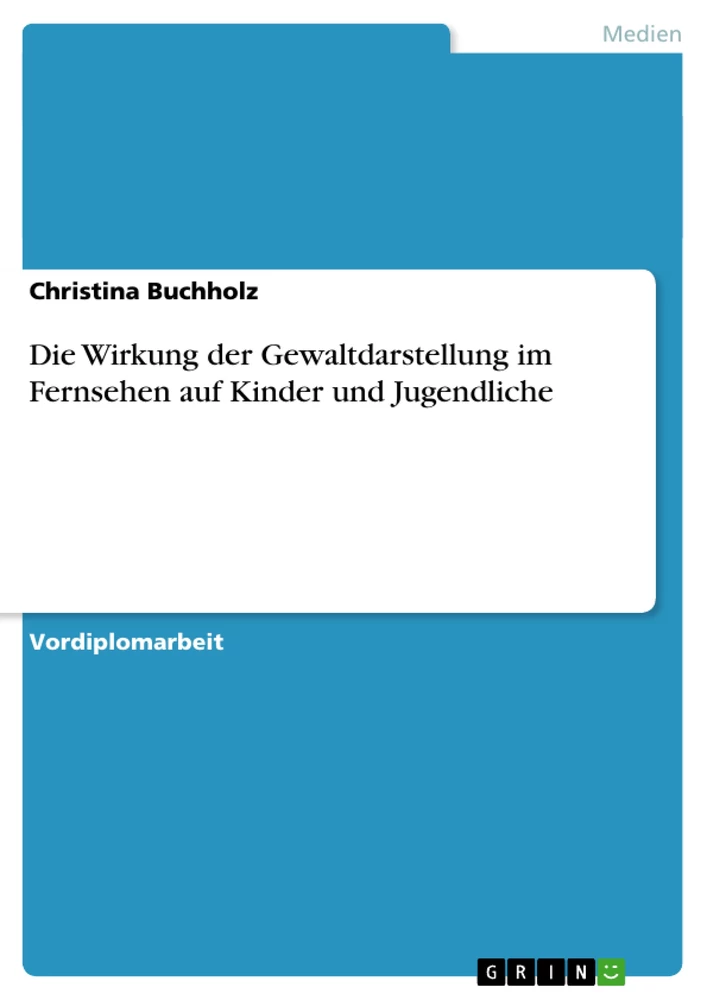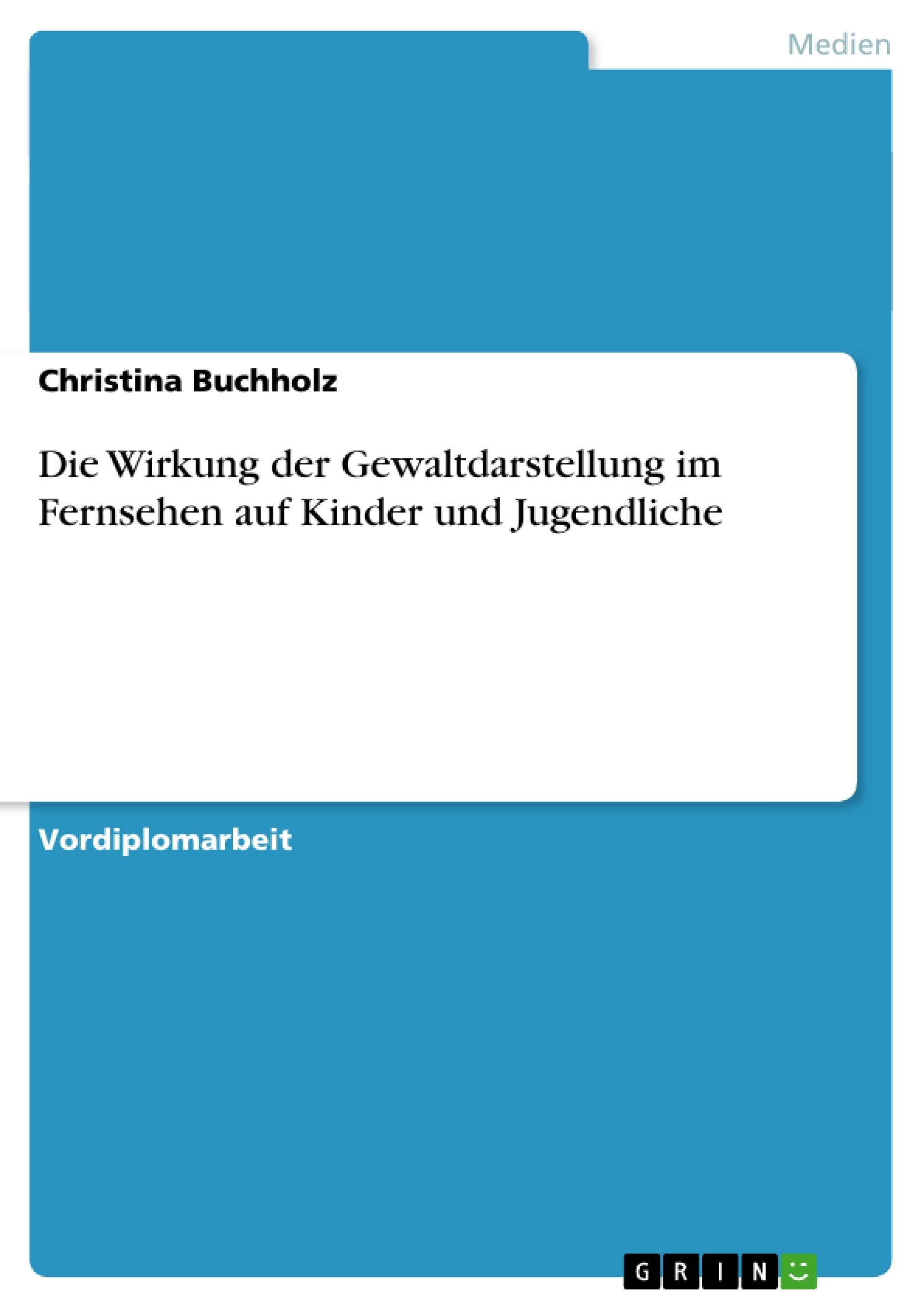Neu ist sie nicht, die Frage nach den Wirkungen von Gewaltdarstellungen, jedoch immer noch so
aktuell und kontrovers wie zu Zeiten Platons. Und obwohl zu keinem Bereich der
Medienwirkungsforschung mehr Untersuchungen vorliegen, ist die Publikations flut ungebrochen.
Bis heute wurden über 5000 Studien zu diesem Thema gezählt, wobei die Quantität angesichts der
herrschenden Uneinigkeit oder stellenweise gar Widersprüchlichkeit der Forschungsergebnisse
nicht zwangsläufig auf deren Qualität schließen lässt.
Verursacht die Gewaltdarstellung im Fernsehen reale Gewalt? Betrachtet man den öffentlichen
Diskurs, scheint diese Frage längst überflüssig. Bei jeder spektakulären Gewalttat, besonders durch
Jugendliche, entflammt die Diskussion erneut. Mangels plausibler Erklärungen wird das Fernsehen
zum Sündenbock.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden mit eben dieser Frage. Denn unter Experten
wurde der direkte Schluss vom Inhalt auf die Wirkung längst negiert. Aber auch die noch in den
70er Jahren vertretene „These der Wirkungslosigkeit“ ist heute nicht mehr haltbar.
Eine empirisch gesicherte Antwort auf diese Wirkungsfrage gibt es nicht und kann es nicht geben,
da sich nicht nur die Medienlandschaft permanent verändert, sondern auch Wirkungen an sich im
Laufe der Zeit immer wieder Veränderungen, ja gar einem „Verfallsdatum“2 unterliegen. Diese
Tatsache weist auf die Problematik der vorliegenden Arbeit hin. Sie kann aufgrund der
Komplexität keinen Anspruch auf Berücksichtigung sämtlicher Aspekte des Themengebiets
erheben. Stattdessen soll versucht werden, einen Überblick über die Thematik zu geben und auf
besonders interessante und prägnante Aspekte vertiefend einzugehen.
Als fester Teil im kindlichen Alltag kann von dem Leitmedium Fernsehen als einer neuen
Sozialisationsinstanz, neben den Eltern, gesprochen werden. Junge Rezipienten sind den Wirkungen der Fernsehinhalte besonders stark ausgesetzt, da sie bis zu einem Alter von 10 bis 11
Jahren längst nicht alle Geschehnisse auf dem Bildschirm kognitiv nachvollziehen können. 3 Aus
diesem Grund bilden sie die in dieser Arbeit untersuchte Personengruppe.
Die Einbeziehung der Wirkungen weiterer Medien mit violenten Inhalten wie Comics,
Computerspiele oder das Internet wäre in einem weiteren Rahmen ebenfalls interessant, würde hier
jedoch zu weit führen. [...]
2 Merten (1999), S. 257.
3 Vgl. Kübler (1998), S. 507.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewalt und Aggression
- Gewalt im Fernsehen
- Struktur der Gewalt des Gesamtangebotes
- Gewaltanteile der einzelnen Sender und Genres
- Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Quantitative Fernsehnutzung
- Fernsehnutzung nach Wochentagen und Tageszeiten
- Senderpräferenzen
- Programminhalte
- Gewaltrezeption und -faszination der Kinder und Jugendlichen
- Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen
- Die Katharsisthese
- Die Inhibitionsthese
- Die Stimulationsthese
- Die Habitualisierungsthese
- Die Suggestionsthese
- Die Kultivierungsthese
- Die These der Wirkungslosigkeit
- Die Theorie des sozialen Lernens
- Die Wirkungen des medialen Gewaltkonsums auf Kinder und Jugendliche
- Nachahmungstaten
- Unterschiede im Erleben medialer Gewalt von Mädchen und Jungen
- Auswirkungen auf das Aggressionsverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Interventionsmöglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf Kinder und Jugendliche. Im Zentrum steht die Frage, ob und inwiefern mediale Gewalt das Aggressionsverhalten junger Zuschauer beeinflusst. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Medienwirkungsforschung, diskutiert verschiedene Theorien und untersucht empirische Befunde zu den Wirkungen von Gewalt im Fernsehen.
- Die Präsenz von Gewalt im deutschen Fernsehprogramm
- Das Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Theorien zur Erklärung der Wirkung von medialer Gewalt
- Mögliche Auswirkungen von Gewalt im Fernsehen auf das Aggressionsverhalten von Kindern und Jugendlichen
- Pädagogische Interventionsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik dar und skizziert den Forschungsstand. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Begriffen "Gewalt" und "Aggression". Es zeigt die Komplexität dieser Begriffe auf und erläutert die Schwierigkeiten ihrer Definition.
- Kapitel 3 untersucht die Präsenz von Gewalt im deutschen Fernsehprogramm. Es analysiert die Struktur der Gewalt im Gesamtangebot sowie die Gewaltanteile der einzelnen Sender und Genres.
- Kapitel 4 beleuchtet das Fernsehverhalten von Kindern und Jugendlichen. Es untersucht die quantitative Fernsehnutzung, die Fernsehnutzung nach Wochentagen und Tageszeiten, die Senderpräferenzen und die Rezeption von Programminhalten, insbesondere von gewalttätigen Inhalten.
- Kapitel 5 stellt verschiedene Modelle zur Erklärung der Wirkung medialer Gewaltdarstellungen vor. Es präsentiert die Katharsisthese, die Inhibitionsthese, die Stimulationsthese, die Habitualisierungsthese, die Suggestionsthese, die Kultivierungsthese, die These der Wirkungslosigkeit und die Theorie des sozialen Lernens.
- Kapitel 6 analysiert die Wirkungen des medialen Gewaltkonsums auf Kinder und Jugendliche. Es untersucht, ob und inwiefern mediale Gewalt zu Nachahmungstaten führt, Unterschiede im Erleben medialer Gewalt zwischen Mädchen und Jungen sowie die Auswirkungen auf das Aggressionsverhalten junger Zuschauer.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gewaltdarstellung im Fernsehen, Medienwirkung, Kinder und Jugendliche, Aggressionsverhalten, Sozialisation, Medienkompetenz, Medienerziehung und Interventionsmöglichkeiten.
- Quote paper
- Christina Buchholz (Author), 2004, Die Wirkung der Gewaltdarstellung im Fernsehen auf Kinder und Jugendliche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27732