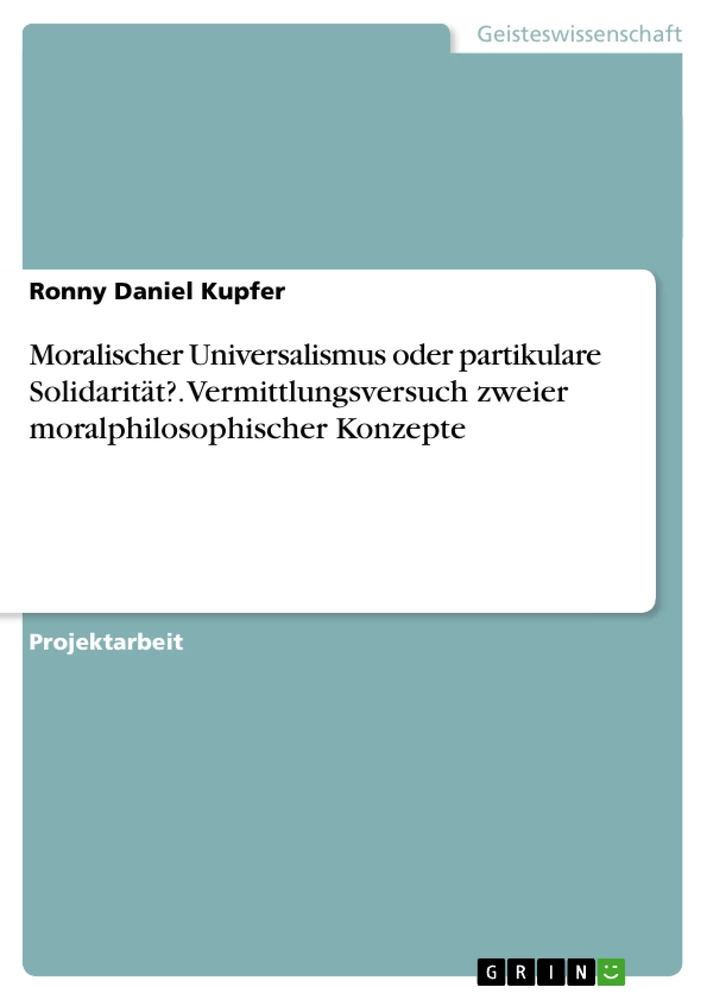Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Hausarbeit liegt auf der Untersuchung des Konfliktpotentials und einer Prüfung der Vermittlungsfähigkeit zwischen einer universalistisch ausgerichteten Ethik auf der einen Seite, und einer Freundschafts- bzw. Solidaritätsethik, welche die besonderen moralischen Verpflichtungen gegenüber bestimmten Gruppen betont, auf der anderen Seite.
Genauer hin soll aufgezeigt werden, in welchen Fällen ein solcher Konflikt sich einstellen kann, was also seine Bedingungen sind und wie eine Vermittlung zwischen beiden Ethikkonzepten aussehen könnte. Es soll dabei zunächst der allgemeine Konfliktfall erfasst werden, also das Prinzip gesucht und verhaftet1 werden, welches den Widerspruch auslöst. Zu diesem Zweck wird der moralische Universalismus mit Rückgriff auf Immanuel Kants moralphilosophische Schriften (u.a. die Metaphysik der Sitten) mit seinem formalen Kern, dem Kategorischen Imperativ und das damit konfligierende loyalitätsethische Konzept von Wolfgang Kersting (u.a. der Text: Internationale Solidarität), exemplarisch bearbeitet. Kersting argumentiert dabei für die Bedeutung und Relevanz des Solidaritätsbegriffes und positioniert sich mit seinen Einwänden kritisch gegenüber einem alle Loyalitätspflichten einebnenden Universalismus.
Diese Einwände Kerstings gegen eine Überbetonung des moralischen Universalismus werden hier zunächst angeführt und auf ihre Bedeutung und Überzeugungskraft hin untersucht, wobei sie gleichsam als eine methodische Schablone2 für eben jene Fälle dienen werden, bei denen der Konflikt mit dem moralischen Universalismus sichtbar und auf einer abstrakten (allgemeinen) Stufe diesem Vorhaben entsprechend, lösbar wird. Es soll also ein eigener Vermittlungsversuch in Form einer Synthese zwischen diesen beiden Ethikkonzepten versucht werden. Dieses Vorhaben wird im Rahmen dieser Hausarbeit freilich einige Abstriche im Umfang und Detailschärfe in Kauf nehmen müssen.
Wenn dabei eine wie auch immer geartete Auflösung des Grundkonflikts beider Ansätze auffindbar ist, dann würde dadurch die simple Frage nach der Vorzüglichkeit des einen oder des anderen Moral-Konzepts in eine meines Erachtens viel spannendere Fragestellung nach den jeweiligen Geltungsbereichen und -ansprüchen und dessen Grenzen eröffnet, die ja ohnehin schon darum im Raum steht, weil die universalistischen Moralvorstellungen in unseren Vorstellungen durchaus dominant und tonangebend sind
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der moralische Universalismus und dessen Dialektik
- Argumente für den Ansatz einer partikular ausgerichteten Solidarität
- Versuch einer Synthese beider Moralkonzepte
- Die positiven Momente beider Ansätze
- Die negativen Momente beider Ansätze
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Konfliktpotential zwischen universalistischer Ethik und einer solidaritätsethischen Perspektive, die besondere moralische Verpflichtungen gegenüber bestimmten Gruppen betont. Das Ziel ist es, die Bedingungen dieses Konflikts aufzuzeigen und einen Vermittlungsversuch zwischen beiden Konzepten zu unternehmen. Die Arbeit analysiert, wie ein solcher Konflikt entsteht und wie eine mögliche Synthese aussehen könnte.
- Der moralische Universalismus nach Kant
- Die partikulare Solidaritätsethik und ihre Argumente
- Die Dialektik zwischen Universalismus und Partikularismus
- Mögliche Synthese beider Konzepte
- Geltungsbereiche moralischer Prinzipien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Schwerpunkt der Arbeit: die Untersuchung des Konfliktpotentials zwischen universalistischer Ethik und einer auf Solidarität ausgerichteten Ethik, die besondere Verpflichtungen gegenüber bestimmten Gruppen betont. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der darin besteht, den Konfliktfall zu erfassen und eine Vermittlung zwischen beiden Konzepten zu versuchen. Immanuel Kants moralphilosophische Schriften und Wolfgang Kerstings Argumentation zur Bedeutung des Solidaritätsbegriffs werden als Ausgangspunkte genannt. Die Arbeit zielt auf einen Vermittlungsversuch ab, der die jeweiligen Geltungsbereiche beider Konzepte beleuchtet.
Der moralische Universalismus und dessen Dialektik: Dieses Kapitel analysiert den moralischen Universalismus nach Kant als scheinbaren Widerpart zu Kerstings solidaritätsethischem Konzept. Es wird betont, dass beide Ansätze nicht als komplett ausschließend betrachtet werden, sondern eine Synthese ermöglichen könnten. Der Universalismus, der auf der Verallgemeinerbarkeit von Maximen basiert, wird im Kontext des Kategorischen Imperativs erläutert. Die Kritik an der Abstraktion des Universalismus von speziellen Verbindlichkeiten wird als dialektisches Moment herausgestellt, welches sowohl Stärke als auch Schwäche des Konzepts repräsentiert.
Argumente für den Ansatz einer partikular ausgerichteten Solidarität: Dieses Kapitel greift die Nivellierung des universalen Ansatzes auf und argumentiert für eine Erweiterung des moralischen Universalismus. Es präsentiert Kerstings Plädoyer für eine Synthese von universalistischer und partikularistischer moralischer Orientierung. Die zentralen Argumente für eine partikulare Solidaritätsethik werden dargestellt, wobei betont wird, dass es nicht um die Abschaffung des Universalismus geht, sondern um die Anerkennung spezieller Geltungsbereiche für solidaritätsethische Konzepte.
Schlüsselwörter
Moralischer Universalismus, Solidaritätsethik, Immanuel Kant, Wolfgang Kersting, Kategorischer Imperativ, Verallgemeinerbarkeit, Partikularismus, Loyalitätspflichten, Synthese, Geltungsbereich, Moralphilosophie.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Universalismus vs. Solidaritätsethik
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Konflikt zwischen universalistischer Ethik (nach Kant) und einer Solidaritätsethik, die besondere moralische Verpflichtungen gegenüber bestimmten Gruppen betont. Ziel ist es, die Bedingungen dieses Konflikts aufzuzeigen und einen Vermittlungsversuch zwischen beiden Konzepten zu unternehmen.
Welche Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den moralischen Universalismus, insbesondere Kants Kategorischen Imperativ und seine Betonung der Verallgemeinerbarkeit von Maximen, mit einer partikularistischeren Solidaritätsethik, die besondere Loyalitätspflichten gegenüber bestimmten Gruppen beinhaltet. Dabei wird die Argumentation von Wolfgang Kersting berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum moralischen Universalismus und dessen Dialektik, ein Kapitel zu Argumenten für eine partikulare Solidaritätsethik, einen Abschnitt zum Versuch einer Synthese beider Konzepte (inkl. positiver und negativer Aspekte beider Ansätze) und einen Schluss. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche zentralen Argumente werden behandelt?
Zentrale Argumente umfassen die Kritik an der Abstraktion des Universalismus, die Begründung für spezielle Geltungsbereiche solidaritätsethischer Konzepte, die Suche nach einer Synthese, die beide ethischen Ansätze nicht als völlig ausschließend, sondern als komplementär betrachtet und die Definition der Geltungsbereiche moralischer Prinzipien.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Immanuel Kant und Wolfgang Kersting als zentrale Bezugspunkte für den Universalismus bzw. die Solidaritätsethik.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, den Konflikt zwischen universalistischer und solidaritätsethischer Perspektive zu analysieren und einen Weg zur Versöhnung und Integration beider Konzepte aufzuzeigen, indem die jeweiligen Geltungsbereiche beleuchtet werden.
Wie wird der Konflikt zwischen Universalismus und Partikularismus gelöst?
Die Arbeit versucht keine endgültige Lösung, sondern bietet einen Vermittlungsversuch an, der die Stärken beider Konzepte hervorgehoben und ihre jeweiligen Geltungsbereiche differenziert. Es geht nicht um die Abschaffung des Universalismus, sondern um eine Erweiterung und Nuanceirung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Moralischer Universalismus, Solidaritätsethik, Immanuel Kant, Wolfgang Kersting, Kategorischer Imperativ, Verallgemeinerbarkeit, Partikularismus, Loyalitätspflichten, Synthese, Geltungsbereich, Moralphilosophie.
- Arbeit zitieren
- Ronny Daniel Kupfer (Autor:in), 2014, Moralischer Universalismus oder partikulare Solidarität?. Vermittlungsversuch zweier moralphilosophischer Konzepte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276196