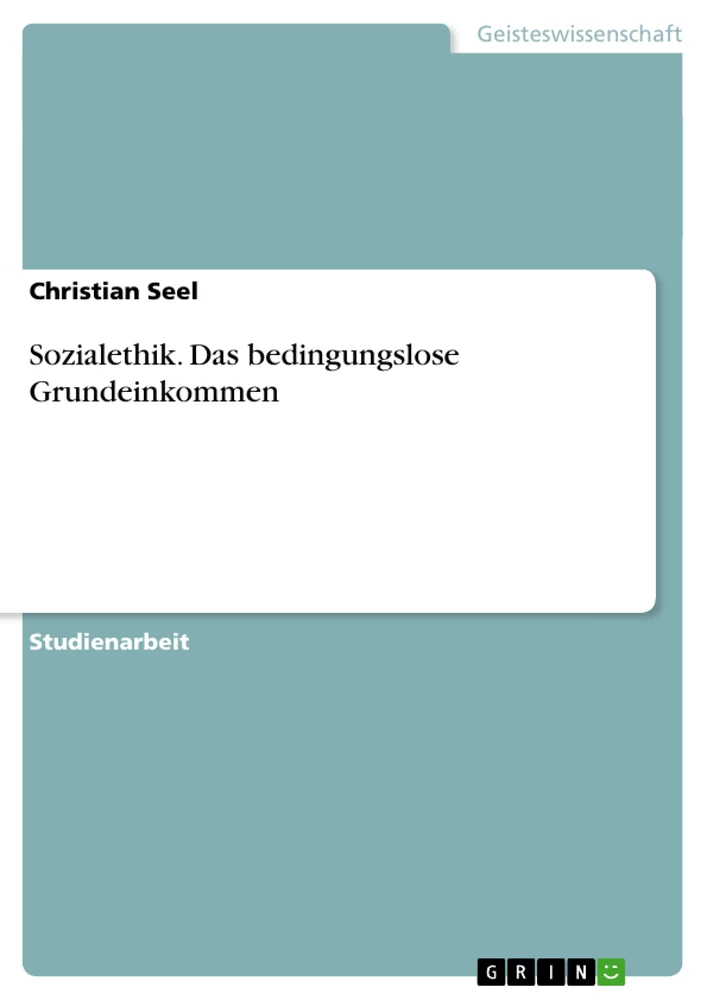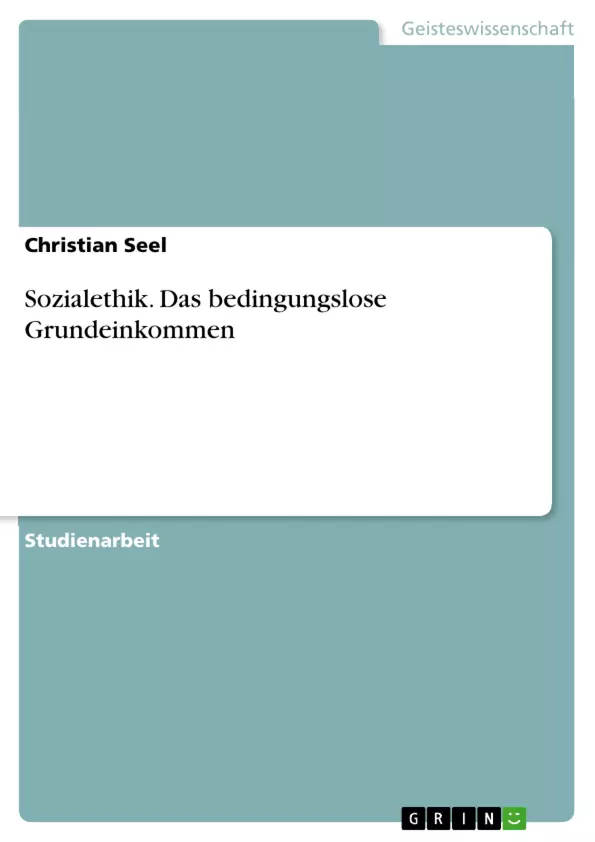Von Unternehmen bis zu Arbeitsloseninitiativen, von marktliberalen Ökonomen bis zu Attac, von der Piratenpartei bis zur Linkspartei: Unter der Bezeichnung „bedingungsloses Grundeinkommen“ fordern Befürworter aus unterschiedlichsten Kreisen nichts Geringeres als eine radikale Umgestaltung des Sozialstaats. Ein individuell ausbezahltes Einkommen für alle, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung, ist der Kern der Idee. Im Zuge hoher Unzufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung mit den Reformen des Arbeitsmarktes (Hartz I-IV) bietet diese Forderung offenbar eine potentielle Alternative.
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage: Kann das „bedingungslose Grundeinkommen“ als sozialpolitisches Instrument für die Integration der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen wirksam sein und ist es aus sozialethischertheologischer Perspektive gerechtfertigt? Dafür wird zunächst eine Eingrenzung des Begriffs „bedingungsloses Grundeinkommen“ vorgenommen und seine Entstehungsgeschichte in Grobform nachgezeichnet. Es folgt eine Situationsanalyse, in denen Kriterien für und gegen das bedingungslose Grundeinkommen gesammelt werden, die für die Beantwortung der Frage nach der Wirksamkeit und der moralischen Rechtfertigung des „bedingungslosen Grundeinkommens“ wichtig sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Begriffsbestimmung
- Die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens
- Situationsanalyse
- Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit.
- Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen zum Arbeitsethos
- Kriterien für das bedingungslose Grundeinkommen
- Kriterien gegen das bedingungslose Grundeinkommen.
- Der sozialethisch-theologische Befund
- Die Lebensdienlichkeit der Ökonomie für den Menschen.
- Gerechtigkeitsethos - Solidarität und Gleichheit
- Menschenwürde - Das Leben hat Vorrang vor aller Leistung.
- Normen, ethische Grundprinzipien, sozialethische Maximen
- Fundamentalprämissen
- Grundprinzipien der Wirtschafts- und Sozialethik.
- Sozialethische Maximen der Sozialwissenschaften
- Das bedingungslose Grundeinkommen als Bürgerrecht?
- Abgeleitete Handlungsmöglichkeiten
- Fazit
- Urteilsentscheid.
- Literaturverzeichnis
- Quellen:
- Sekundärliteratur:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Frage, ob das „bedingungslose Grundeinkommen“ als sozialpolitisches Instrument zur Integration von Arbeitslosen in Deutschland wirksam sein kann und aus sozialethisch-theologischer Perspektive gerechtfertigt ist. Dazu werden der Begriff „bedingungsloses Grundeinkommen“ definiert und seine Entstehungsgeschichte beleuchtet. Anschließend wird eine Situationsanalyse durchgeführt, die Kriterien für und gegen das bedingungslose Grundeinkommen untersucht. Die Arbeit beleuchtet den sozialenthisch-theologischen Befund im Kontext christlicher Überzeugungen und etabliert Normen und Kriterien für sozialethische Grundprinzipien, um schließlich zu konkreten Handlungsanweisungen und einem Urteilsentscheid zu gelangen.
- Wirksamkeit des bedingungslosen Grundeinkommens als sozialpolitisches Instrument zur Integration von Arbeitslosen
- Sozialethische und theologische Rechtfertigung des bedingungslosen Grundeinkommens
- Definition und Entstehungsgeschichte des bedingungslosen Grundeinkommens
- Kriterien für und gegen das bedingungslose Grundeinkommen
- Sozialethische und theologische Argumente im Kontext des bedingungslosen Grundeinkommens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die zentrale Fragestellung nach der Wirksamkeit und Rechtfertigung des bedingungslosen Grundeinkommens als Instrument zur Integration von Arbeitslosen vor. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
- Die Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel differenziert das bedingungslose Grundeinkommen von anderen Sozialleistungen und definiert seine charakteristischen Merkmale, wie z. B. existenzsichernd, individueller Rechtsanspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung und kein Zwang zur Arbeit.
- Die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des bedingungslosen Grundeinkommens von Thomas Morus bis hin zu Thomas Paine nach. Es zeigt die historischen Wurzeln der Idee und die unterschiedlichen Begründungen für die Einführung eines garantierten Einkommens.
- Situationsanalyse: Dieser Abschnitt beleuchtet die aktuelle Situation in Deutschland, die Argumente für und gegen das bedingungslose Grundeinkommen analysiert und die Kriterien für dessen Wirksamkeit und Rechtfertigung untersucht.
- Der sozialethisch-theologische Befund: Dieses Kapitel beleuchtet die ethischen und theologischen Dimensionen des bedingungslosen Grundeinkommens im Kontext christlicher Überzeugungen. Es analysiert die Lebensdienlichkeit der Ökonomie für den Menschen, das Gerechtigkeitsethos, die Solidarität und Gleichheit sowie die Bedeutung der Menschenwürde.
- Normen, ethische Grundprinzipien, sozialethische Maximen: Dieses Kapitel identifiziert und diskutiert die grundlegenden Normen, ethischen Grundprinzipien und sozialen Maximen, die für die Beurteilung des bedingungslosen Grundeinkommens relevant sind.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen als sozialpolitischem Instrument zur Integration von Arbeitslosen. Sie befasst sich mit den sozialen, ethischen und theologischen Dimensionen dieser Idee und untersucht deren Wirksamkeit und Rechtfertigung. Schlüsselbegriffe sind daher: bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitslosigkeit, Integration, Sozialpolitik, Sozialethik, Theologie, Gerechtigkeit, Solidarität, Menschenwürde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens?
Es handelt sich um ein Einkommen, das jedem Bürger individuell, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Gegenleistung staatlich ausgezahlt wird.
Ist das Grundeinkommen aus theologischer Sicht gerechtfertigt?
Die Arbeit untersucht dies anhand christlicher Werte wie Menschenwürde, Solidarität und der Überzeugung, dass das Leben Vorrang vor wirtschaftlicher Leistung hat.
Welche historischen Wurzeln hat das Grundeinkommen?
Die Geschichte reicht von den utopischen Entwürfen eines Thomas Morus bis hin zu den Forderungen von Thomas Paine nach einem gesellschaftlichen Erbe.
Was spricht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Kritiker führen oft die hohen Kosten, mögliche negative Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation und die Infragestellung des traditionellen Arbeitsethos an.
Wie verändern sich Begriffe wie 'Arbeit' durch das Grundeinkommen?
Das Konzept geht davon aus, dass Arbeit mehr ist als reine Erwerbsarbeit und auch ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Sorgearbeit gesellschaftlich aufgewertet werden müssen.
- Quote paper
- Christian Seel (Author), 2012, Sozialethik. Das bedingungslose Grundeinkommen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275743