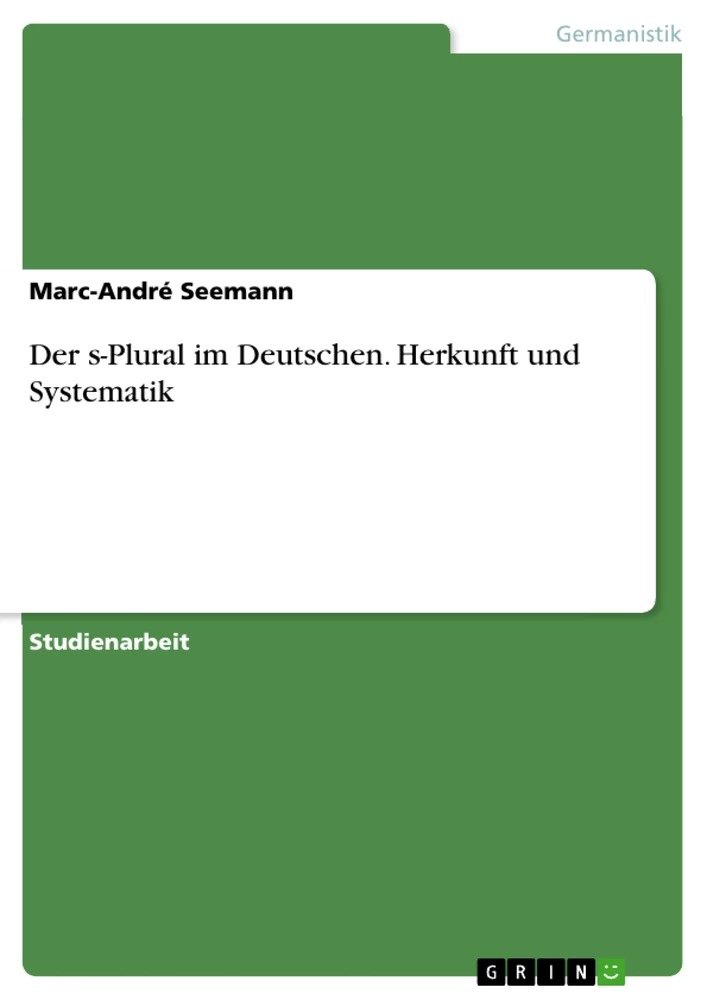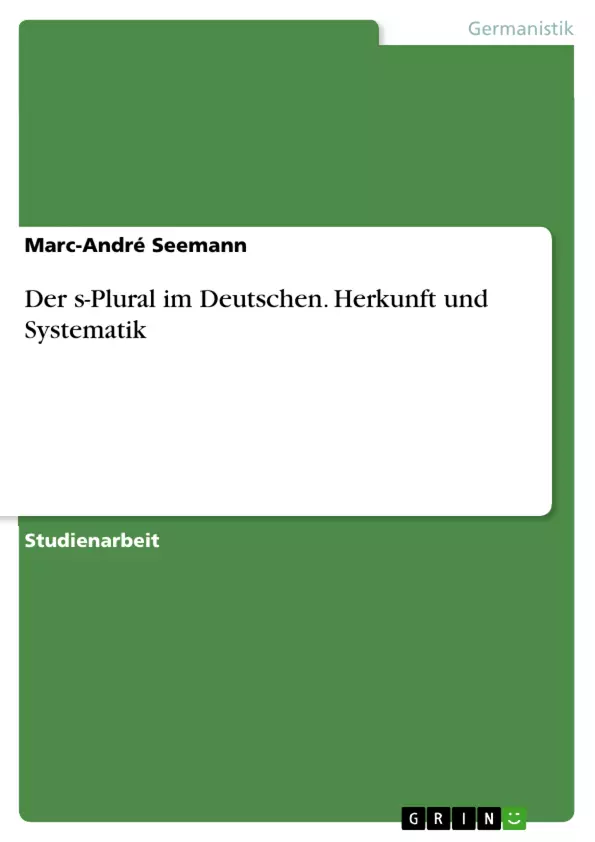Der s-Plural war und ist ein kontrovers diskutiertes Thema in der deutschen Philologie. Schon früh gab es mehrere unterschiedliche Theorien von Linguisten wie Matthias (1906), Behaghel (1916), Paul (1917), Hirt (1919) und Öhmann (1924), die über den Ursprung des s-Plurals berichteten. Jeder der oben genannten Linguisten äußerte sich dazu und stütze somit einen anderen Linguisten und dessen Theorie oder stellte seine eigene Hypothese zum Thema „Ursprung des s-Plural im Deutschen“ auf. Auch in den letzten 20 Jahren finden sich Linguisten, wie Köpcke (1993) und Nübling (2011), die sich zu diesem Thema äußerten. Insgesamt gibt es vier gute Ansätze der Linguisten, doch da es nur eine Theorie geben kann, die auch zufriedenstellend ist, werde ich mich im ersten Teil meiner Hausarbeit, mit folgender Frage beschäftigen: „Woher kommt der s-Plural im Deutschen?“
Außerdem wurde in den letzten beiden Jahrhunderten viel über die Systematik des s-Plurals gesprochen und geschrieben, also wann und wieso die Pluralbildung mit –s erfolgt und ob es dazu systematische Regeln gibt. Unter anderen haben sich die Linguisten Bornschein und Butt (1987), Wurzel (1994), Wiese (1996), Thieroff (2000), Fakhry (2008) und Eisenberg (2012) mit der Systematik des s-Plurals im Deutschen beschäftigt. Dem Nutzer des s-Plurals fällt zu Anfang auf, dass der s-Plural in allen drei Genera vorkommt (wie Uhu – Uhus, Auto – Autos, Bar – Bars). Des Weiteren stechen Fremdwörter (wie Lady – Ladys, Handy – Handys, Job – Jobs) heraus, die ihren Plural ebenfalls mit –s bilden. Doch da auch native Wörter (wie Opa – Opas, Uhu – Uhus, Auto – Autos) den Plural mit –s bilden, muss es systematische Regeln geben, die die Pluralbildung mit –s ankündigen. Somit fixiere ich mich im zweiten Teil der Hausarbeit auf die Systematik des s-Plurals und versuche zur folgender Frage Auskunft zu geben: „Wie ist die Pluralbildung mit –s im Deutschen systematisch aufgebaut?“
Einige Linguisten (u.a. Wiese 1996 und Bartke 1999) nennen den s-Plural auch „Defaultplural“, weswegen ich kurz, bevor ich meine Hausarbeit abschließe, Bezug zum Begriff „Defaultplural“ nehme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herkunft des s-Plurals
- Altsächsische Ursprungstheorie
- Französische Ursprungstheorie
- Mittelniederländische Ursprungstheorie
- Ansatz Neubildung des Deutschen
- Die Pluralbildung mit –s
- Substantive, die genusunabhängig ihren Plural mit –s bilden
- Eigennamen
- Kurzwörter und Akronyme
- Onomatopoetika und Substantivierungen
- Non-Feminina vs. Feminina
- Substantive, die genusunabhängig ihren Plural mit –s bilden
- Defaultplural
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den s-Plural im Deutschen, ein kontrovers diskutiertes Thema in der deutschen Philologie. Die Arbeit verfolgt zwei Hauptziele: Erstens, die Klärung des Ursprungs des s-Plurals im Deutschen und zweitens, die Analyse der Systematik seiner Bildung.
- Ursprung des s-Plurals im Deutschen
- Systematik der Pluralbildung mit -s
- Bewertung verschiedener linguistischer Theorien zum s-Plural
- Analyse der Anwendung des s-Plurals in verschiedenen Wortarten und Genera
- Der "Defaultplural" als Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des s-Plurals ein und beschreibt die kontroverse Debatte um seinen Ursprung und seine Systematik in der deutschen Sprachwissenschaft. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit: Woher kommt der s-Plural im Deutschen? Und wie ist die Pluralbildung mit -s systematisch aufgebaut?
Herkunft des s-Plurals: Dieses Kapitel präsentiert und bewertet vier konkurrierende Theorien zum Ursprung des s-Plurals: die altsächsische, die französische, die mittelniederländische und die Theorie der Neubildung im Deutschen. Es werden die Argumente der jeweiligen Vertreter detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt, wobei Stärken und Schwächen jeder Theorie beleuchtet werden. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Argumentationslinien und die jeweiligen Belege der Linguisten gelegt, um ein umfassendes Bild der Debatte zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung und den sprachwissenschaftlichen Methoden, die zur Begründung der jeweiligen Theorien verwendet wurden.
Die Pluralbildung mit –s: Dieses Kapitel befasst sich mit der Systematik des s-Plurals. Es analysiert die Regeln und Ausnahmen der Pluralbildung mit -s in verschiedenen Wortgruppen, wie Eigennamen, Kurzwörtern, Akronymen, Onomatopoetika und Substantivierungen. Der Vergleich zwischen der Pluralbildung bei femininen und nicht-femininen Substantiven wird ebenfalls thematisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der systematischen Muster und der Identifizierung von Ausnahmen von diesen Mustern. Die Zusammenfassung berücksichtigt die verschiedenen Ansätze zur Erklärung der Systematik und integriert die relevanten Erkenntnisse der genannten Linguisten.
Defaultplural: Dieses Kapitel bietet eine kurze Erläuterung des Begriffs "Defaultplural" im Kontext des s-Plurals und seiner Anwendung im Deutschen. Es wird die Relevanz dieses Konzepts im Hinblick auf die vorangegangenen Kapitel diskutiert, und es werden die Implikationen für das Verständnis der Systematik des s-Plurals erläutert. Die Zusammenfassung zeigt die Einordnung des Konzepts in den Gesamtkontext der Arbeit auf.
Schlüsselwörter
s-Plural, deutsche Grammatik, Pluralbildung, Sprachgeschichte, Altsächsisch, Französisch, Mittelniederländisch, Linguistik, Wortbildung, Morpheme, Defaultplural, historische Sprachwissenschaft, Lehnwörter.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Der s-Plural im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den s-Plural im Deutschen, seine Herkunft und die Systematik seiner Bildung. Es werden verschiedene linguistische Theorien dazu bewertet und analysiert, wie der s-Plural in unterschiedlichen Wortarten und Genera angewendet wird.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zwei Hauptziele: Erstens die Klärung des Ursprungs des s-Plurals im Deutschen und zweitens die Analyse der Systematik seiner Bildung. Sie bewertet verschiedene Theorien und untersucht die Anwendung des s-Plurals in der Praxis.
Welche Theorien zum Ursprung des s-Plurals werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert und bewertet vier Theorien: die altsächsische, die französische, die mittelniederländische und die Theorie der Neubildung im Deutschen. Jede Theorie wird detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt, inklusive Stärken und Schwächen.
Wie wird die Systematik der Pluralbildung mit -s analysiert?
Die Systematik wird anhand verschiedener Wortgruppen analysiert, wie Eigennamen, Kurzwörter, Akronyme, Onomatopoetika und Substantivierungen. Der Vergleich zwischen der Pluralbildung bei femininen und nicht-femininen Substantiven spielt ebenfalls eine Rolle. Ausnahmen von den Regeln werden ebenfalls berücksichtigt.
Was ist der "Defaultplural"?
Die Arbeit erläutert den Begriff "Defaultplural" im Kontext des s-Plurals und seiner Anwendung im Deutschen. Die Relevanz dieses Konzepts für das Verständnis der Systematik des s-Plurals wird diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Herkunft des s-Plurals, einem Kapitel zur Pluralbildung mit -s, einem Kapitel zum Defaultplural und einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: s-Plural, deutsche Grammatik, Pluralbildung, Sprachgeschichte, Altsächsisch, Französisch, Mittelniederländisch, Linguistik, Wortbildung, Morpheme, Defaultplural, historische Sprachwissenschaft, Lehnwörter.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in der deutschen Philologie. Sie richtet sich an Leser mit Interesse an deutscher Grammatik und Sprachgeschichte.
- Citation du texte
- Marc-André Seemann (Auteur), 2013, Der s-Plural im Deutschen. Herkunft und Systematik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275648