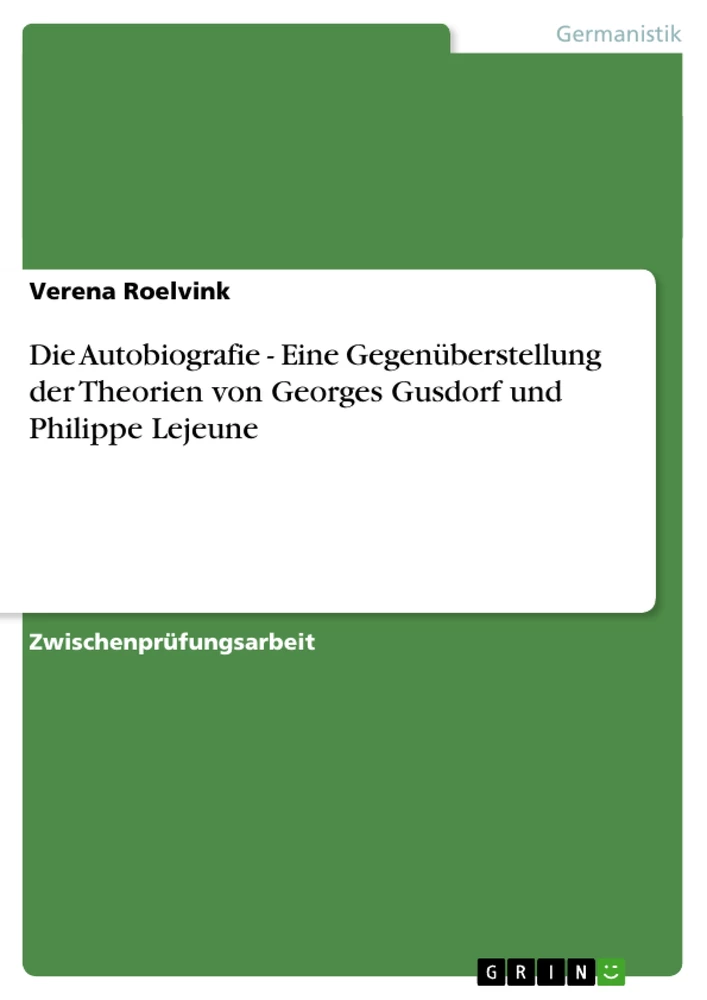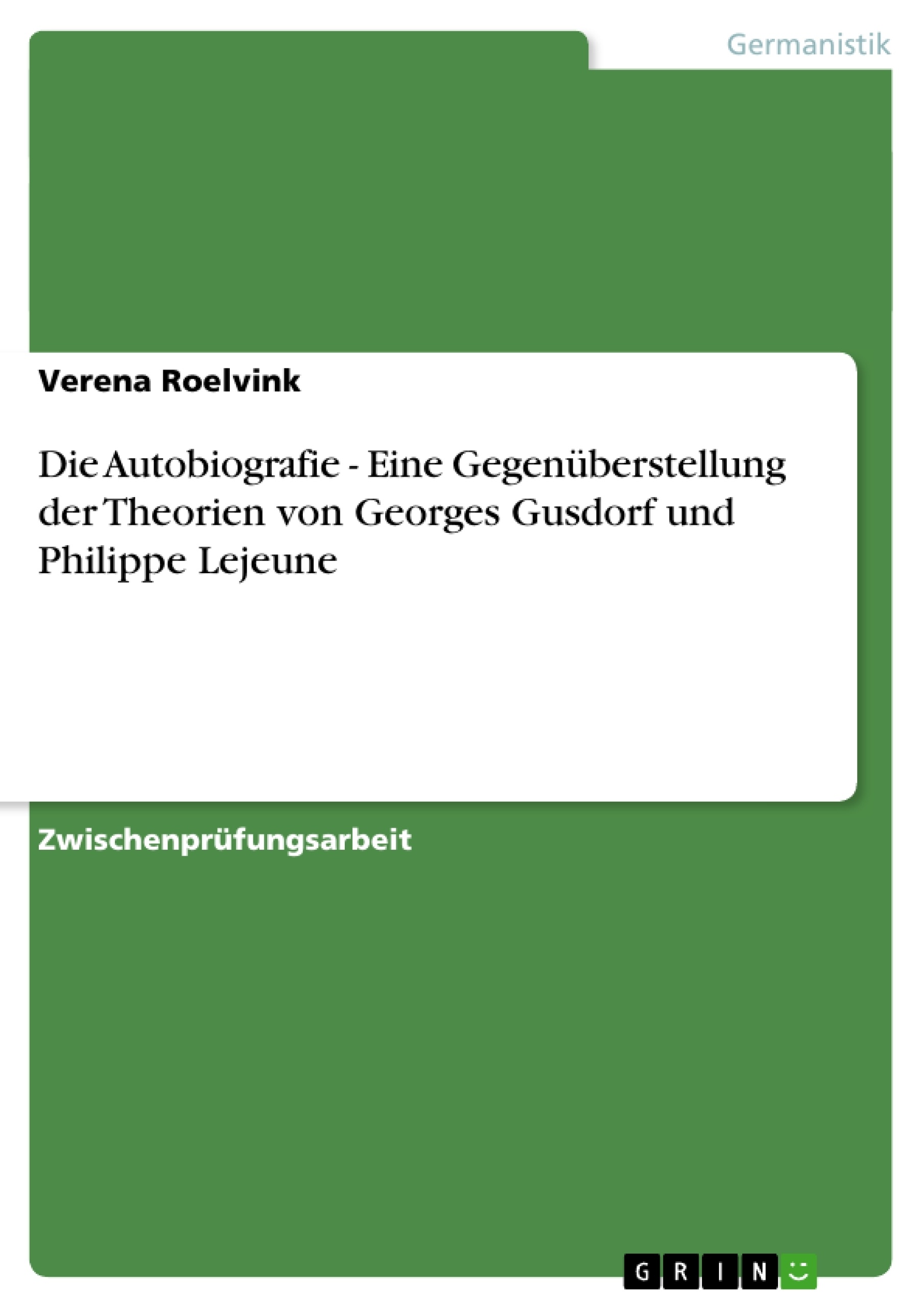[...] Die Diskussion um die
Definition dieser Kategorien und die Definition der Autobiografie selber, hat mich am
meisten interessiert. Deswegen habe ich für meine Hausarbeit zwei Aufsätze ausgesucht, die
versuchen, die Autobiografie zu definieren und die mit ihr auftauchenden Probleme
aufzuzeigen. Einer der Aufsätze ist von dem Franzosen Georges Gusdorf und trägt den Titel
„Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie.“2 Der andere Aufsatz, „Der
autobiographische Pakt“3, ist von Philippe Lejeune, ebenfalls ein Franzose. In den fünfziger
Jahren setzte eine neue Phase der Autobiografie-Forschung ein, bei der Frankreich und die
angelsächsischen Länder für längere Zeit die Führung übernahmen, vor allem in der
gattungstheoretischen Diskussion. Die Formgesetzte der Gattung traten hier erstmals in das
Blickfeld. Es wurde versucht, die Gattung der Autobiografie von anderen Selbsterzeugnissen
und von der Biografie, wie auch ihre verschiedenen Typen untereinander, formal zu
unterscheiden. Der Begriff „Kunstwerk“ tauchte im Zusammenhang mit der Autobiografie
zum ersten Mal 1956 bei Georges Gusdorf auf. Philippe Lejeune stellte in seinem Aufsatz
heraus, dass die Beziehung des Autobiografen zum Leser eine sehr wichtige Rolle spielt.
„Der autobiographische Pakt“ erschien fast zwanzig Jahre nach dem Aufsatz von Gusdorf
(nämlich 1974). In dieser Zeitspanne hat sich die Diskussion um die Autobiografie stark
weiterentwickelt und somit sind Lejeune´s Überlegungen und Gedankengänge natürlich
ausgereifter. Im ersten Kapitel meiner Hausarbeit werde ich den Aufsatz von Georges
Gusdorf mit eigenen Worten zusammenfassen und erklären und im zweiten Kapitel den von
Philippe Lejeune. Im Schlussteil werde ich dann auf Verknüpfungspunkte der beiden
Aufsätze eingehen und meine eigene Meinung darstellen.
2 Gusdorf, Georges: „Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie“ (zuerst 1956), in: Günter
Niggl (Hg.): „Die Autobiographie – Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung“,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1989, S. 121-147
Diese Quelle wird im Folgenden unter Verwendung der Sigle >GG< und Angabe der Seitenzahl
zitiert.
3 Lejeune, Philippe: „Der autobiographische Pakt“, in: Philippe Lejeune: „Der autobiographische
Pakt“ (zuerst 1975), Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1994, S. 13-51
Diese Quelle wird im Folgenden unter Verwendung der Sigle >PL< und Angabe der Seitenzahl zitiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Selbsterkenntnis eines Menschen als Kunstwerk
- 2. Eine vertragliche Gattung
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Definition der Autobiografie anhand der Theorien von Georges Gusdorf und Philippe Lejeune. Der Fokus liegt auf der Gattungsdiskussion, der Opposition zwischen Literatur und Leben sowie der Rolle des Autors und Lesers. Die Arbeit analysiert, wie beide Autoren die Autobiografie definieren und welche Probleme sie damit verbinden.
- Definition der Autobiografie als literarische Gattung
- Die Beziehung zwischen Literatur und Leben in der Autobiografie
- Die Rolle des Autors und Lesers im autobiografischen Prozess
- Die historische Entwicklung der Autobiografie
- Selbsterkenntnis und Selbstfindung als Ziele autobiografischen Schreibens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Selbsterkenntnis eines Menschen als Kunstwerk: Georges Gusdorf betrachtet die Autobiografie als eine etablierte literarische Gattung, die ein ganzes Leben ganzheitlich darstellt und vom Protagonisten selbst verfasst wird. Für Gusdorf ist die Autobiografie nicht nur ein Dokument, sondern ein Kunstwerk, das verborgene Aspekte der Persönlichkeit enthüllt und Selbsterkenntnis ermöglicht. Er betont den schöpferischen Akt des Autors, der sein eigenes Ich erschafft und seinem Leben einen Sinn verleiht. Gusdorf beleuchtet die historische Entstehung der Autobiografie, die er als räumlich und zeitlich begrenzt sieht, eng verbunden mit dem abendländischen Bewusstsein für Individualität und die Einmaligkeit des Lebens. Im Gegensatz zur Biografie, die einen zeitlichen und sozialen Abstand zwischen Autor und Subjekt aufweist, ist die Autobiografie eine Umkehrung dieser Beziehung, eine geistige Revolution, in der der Autor sich selbst zum Objekt seiner Darstellung macht. Er analysiert den Wandel im Bewusstsein, der von einer kollektivistischen hin zu einer individualistischen Sichtweise führte, mit der Beichte als wichtigem Zwischenstadium. Die Selbstdarstellung im Spiegel der Autobiografie ist für Gusdorf sowohl ein beängstigendes als auch ein bereicherndes Unterfangen, das den Autor zur Auseinandersetzung mit seiner eigenen Persönlichkeit zwingt.
Schlüsselwörter
Autobiografie, Georges Gusdorf, Philippe Lejeune, Gattungsdiskussion, Literatur und Leben, Selbsterkenntnis, Selbstdarstellung, Individualität, autobiographischer Pakt, Gattungstheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Selbsterkenntnis eines Menschen als Kunstwerk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Definition der Autobiografie anhand der Theorien von Georges Gusdorf und Philippe Lejeune. Der Fokus liegt auf der Gattungsdiskussion, der Opposition zwischen Literatur und Leben sowie der Rolle des Autors und Lesers. Die Arbeit analysiert, wie beide Autoren die Autobiografie definieren und welche Probleme sie damit verbinden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition der Autobiografie als literarische Gattung; die Beziehung zwischen Literatur und Leben in der Autobiografie; die Rolle des Autors und Lesers im autobiografischen Prozess; die historische Entwicklung der Autobiografie; Selbsterkenntnis und Selbstfindung als Ziele autobiografischen Schreibens.
Wie definiert Georges Gusdorf die Autobiografie?
Georges Gusdorf betrachtet die Autobiografie als eine etablierte literarische Gattung, die ein ganzes Leben ganzheitlich darstellt und vom Protagonisten selbst verfasst wird. Für ihn ist sie nicht nur ein Dokument, sondern ein Kunstwerk, das verborgene Aspekte der Persönlichkeit enthüllt und Selbsterkenntnis ermöglicht. Er betont den schöpferischen Akt des Autors und die historische Entstehung der Autobiografie, eng verbunden mit dem abendländischen Bewusstsein für Individualität und die Einmaligkeit des Lebens. Er sieht die Autobiografie als eine Umkehrung der Beziehung zwischen Autor und Subjekt im Vergleich zur Biografie.
Welche Rolle spielt die Selbsterkenntnis in Gusdorfs Theorie?
Für Gusdorf ist die Selbstdarstellung in der Autobiografie ein beängstigendes, aber auch bereicherndes Unterfangen, das den Autor zur Auseinandersetzung mit seiner eigenen Persönlichkeit zwingt. Die Autobiografie ermöglicht Selbsterkenntnis und verleiht dem Leben einen Sinn.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Autobiografie, Georges Gusdorf, Philippe Lejeune, Gattungsdiskussion, Literatur und Leben, Selbsterkenntnis, Selbstdarstellung, Individualität, autobiographischer Pakt, Gattungstheorie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel "Selbsterkenntnis eines Menschen als Kunstwerk", "Eine vertragliche Gattung" und einen Schlussteil. Das erste Kapitel befasst sich detailliert mit der Sichtweise von Georges Gusdorf auf die Autobiografie.
- Quote paper
- Verena Roelvink (Author), 2002, Die Autobiografie - Eine Gegenüberstellung der Theorien von Georges Gusdorf und Philippe Lejeune, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27524