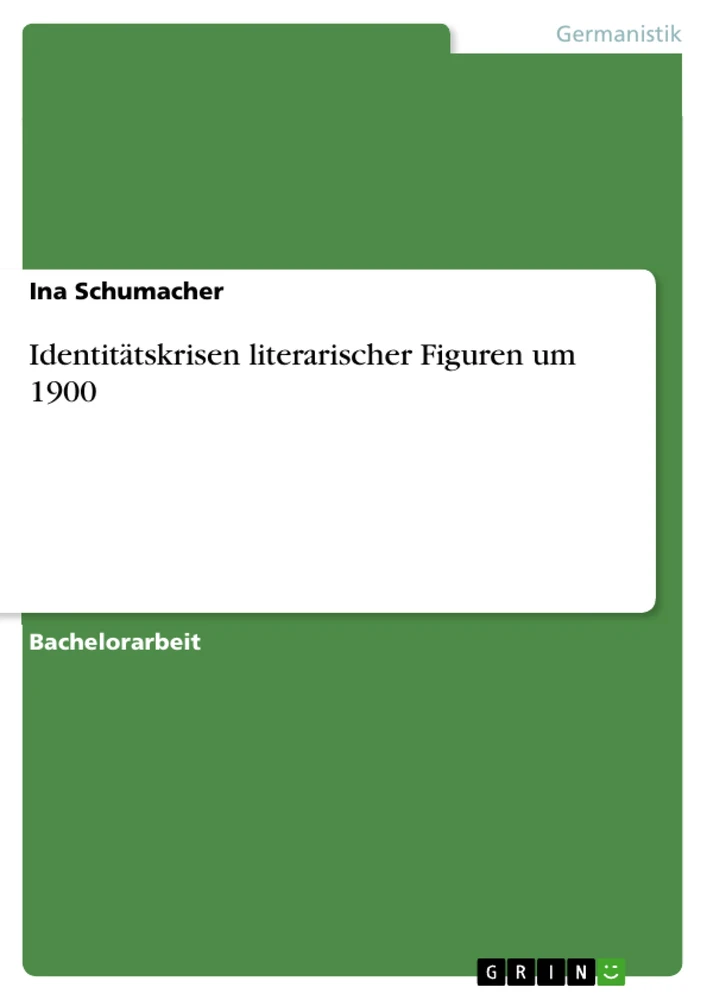Der Begriff Identität ist eines der zentralen Wörter der Moderne und besonders des 20. Jahrhunderts. Ein Grund dafür liegt vor allem in der interdiskursiven Verwendung dieses Themas, wodurch sich verschiedene Definitionsansätze ergeben. Je nach wissenschaftlicher Disziplin eröffnen sich diverse Anwendungsbereiche des Identitätsbegriffs, mit dem Probleme und wissenschaftliche Fragestellungen geklärt werden sollen und können. Auch für die Literatur bietet der Identitätsbegriff eine Fülle an Auseinandersetzungsmöglichkeiten, die es ermöglichen, gesellschaftliche, kulturelle und politische Herausforderungen im 20. Jahrhundert zu thematisieren. Identität wird gerade deshalb zu einem geflügelten Wort der Moderne, weil es die Konstellation von Bezügen eines bestimmten Subjekts zu seiner Außenwelt erfasst. Dabei sind Subjekt und Außenwelt variable Elemente, die sich mit dem Begriff der Identität erfassen lassen.
Parallel mit dem Begriff der Identität beschreibt die Identitätskrise einen dysfunktionalen Ich-Weltbezug. Diese Störung, in der ein Individuum nicht mehr fähig ist, ein funktionierendes Bezugssystem zu seiner Lebensumwelt zu schaffen, wird in zahlreichen literarischen Werken um 1900 aufgegriffen und zum Gegenstand einer differenzierten Betrachtung. Die Zeit des "Fin de Siècle", welche grob die Jahrhundertwende von "1885 bis ca. 1910" umfasst, bietet dabei einen besonders breiten Fundus an literarischen Werken, die das Thema der Identitätskrise aufgreifen. Dabei basieren die Krisen, die von den literarischen Figuren durchlebt werden, auf verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Subsystemen, welche die diskursive Vielfalt dieser "Epoche" widerspiegeln.
Um sich der Identitätskrise als charakteristisches Thema für die Zeit um 1900 zu nähern, werden in dieser Arbeit die drei Hauptprotagonisten der Erzählungen "Tod in Venedig" von Thomas Mann, "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke und "Sterben" von Arthur Schnitzler hinsichtlich der Krise analysiert, welche die Charaktere Gustav Aschenbach, Malte Laurids Brigge und Felix durchleben. Ziel ist es, die Prozesse nachvollziehbar darzustellen, die eine Identitätskrise bewirken, aber auch ihren Verlauf aufzuzeigen. Hierzu ist es notwendig, die jeweilige Krise in ihrem kulturellen Bezugssystem zu betrachten, welches eng mit dem Verlauf und dem Ausgang der Identitätskrise verknüpft ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ich-Auflösung in Thomas Manns "Tod in Venedig"
- Aschenbachs Identitätskrise im Rahmen eines Übergangs vom apollinischen zum dionysischen Weltbild
- Die Identitätsthematik im Rahmen von Décadence-Symbolen
- Die Identitätskrise im Urbanisierungsprozess des frühen 20. Jahrhunderts in Rainer Maria Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"
- Die Großstadt und das Ich
- Identitätskrise und die Rolle des Erzählers
- Autonomieverlust als Identitätskrise bei Arthur Schnitzlers „Sterben“?
- Krankheit als Identitäts- oder Ich- Krise?
- Krankheit und Tod
- "Sterben" als Identitätswechsel im Vergleich zu Mann und Rilke
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Identitätskrise als zentrales Thema der Literatur um 1900, dargestellt an den Hauptprotagonisten der Erzählungen "Tod in Venedig" von Thomas Mann, "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke und "Sterben" von Arthur Schnitzler. Ziel ist es, die Prozesse, die eine Identitätskrise bewirken und ihren Verlauf gestalten, nachvollziehbar darzustellen. Dabei wird die jeweilige Krise im Kontext des kulturellen Bezugssystems betrachtet, welches eng mit dem Verlauf und dem Ausgang der Identitätskrise verknüpft ist.
- Die Identitätskrise im Kontext des Übergangs vom apollinischen zum dionysischen Weltbild bei Thomas Mann
- Die Identitätskrise als Reaktion auf die Überpräsenz der Großstadt im urbanen Raum bei Rainer Maria Rilke
- Die Frage nach der Identitätskrise im Zusammenhang mit Krankheit und Tod bei Arthur Schnitzler
- Die Rolle der sozialen Erwartungshaltung und der kulturellen Strömungen der Zeit in der Identitätskrise
- Die Bedeutung des kulturellen Kontextes für die Interpretation der Identitätskrise
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel konzentriert sich auf Thomas Manns Novelle "Tod in Venedig", in der der Protagonist Gustav Aschenbach eine Identitätskrise durchlebt. Diese entsteht aus der Unvereinbarkeit seines bürgerlichen Standes und den damit verbundenen moralischen Wertvorstellungen mit einem neuen Künstlerideal. Mann verknüpft in seiner Novelle Nietzsche’s apollinisch-dionysisches Weltbild und Décadence-Symbole, um Aschenbachs Identitätskrise darzustellen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Rainer Maria Rilkes "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge". In diesem Werk basiert die Identitätskrise des Protagonisten Malte auf der Überpräsenz der Großstadt und den Eindrücken, die sie auf das Individuum ausübt. Die Großstadt wird in diesem Roman als ein urbaner Raum dargestellt, der Auflösungserscheinungen des Ichs hervorruft.
Das dritte Kapitel widmet sich Arthur Schnitzlers Novelle "Sterben", in der die Lebenskrise des Protagonisten Felix analysiert wird. Die Frage, ob diese Lebenskrise tatsächlich eine Identitätskrise darstellt, wird anhand der Kategorien untersucht, die in den vorherigen Kapiteln entwickelt wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Identitätskrise im Kontext der Literatur um 1900 und analysiert das Thema anhand von drei zentralen Werken der Epoche: "Tod in Venedig" von Thomas Mann, "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" von Rainer Maria Rilke und "Sterben" von Arthur Schnitzler. Die Schlüsselbegriffe der Arbeit umfassen: Identitätskrise, Ich-Auflösung, apollinisch-dionysisches Weltbild, Décadence, Großstadt, Urbanisierungsprozess, Krankheit, Tod, soziale Erwartungshaltung, kulturelle Strömungen der Zeit.
- Quote paper
- Ina Schumacher (Author), 2012, Identitätskrisen literarischer Figuren um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275249