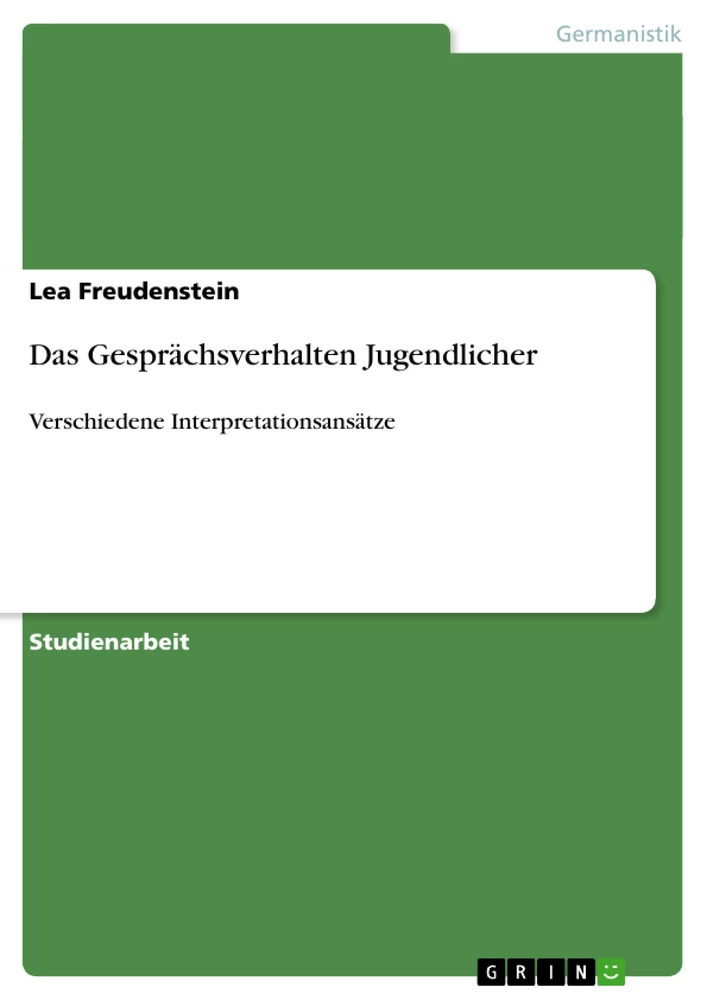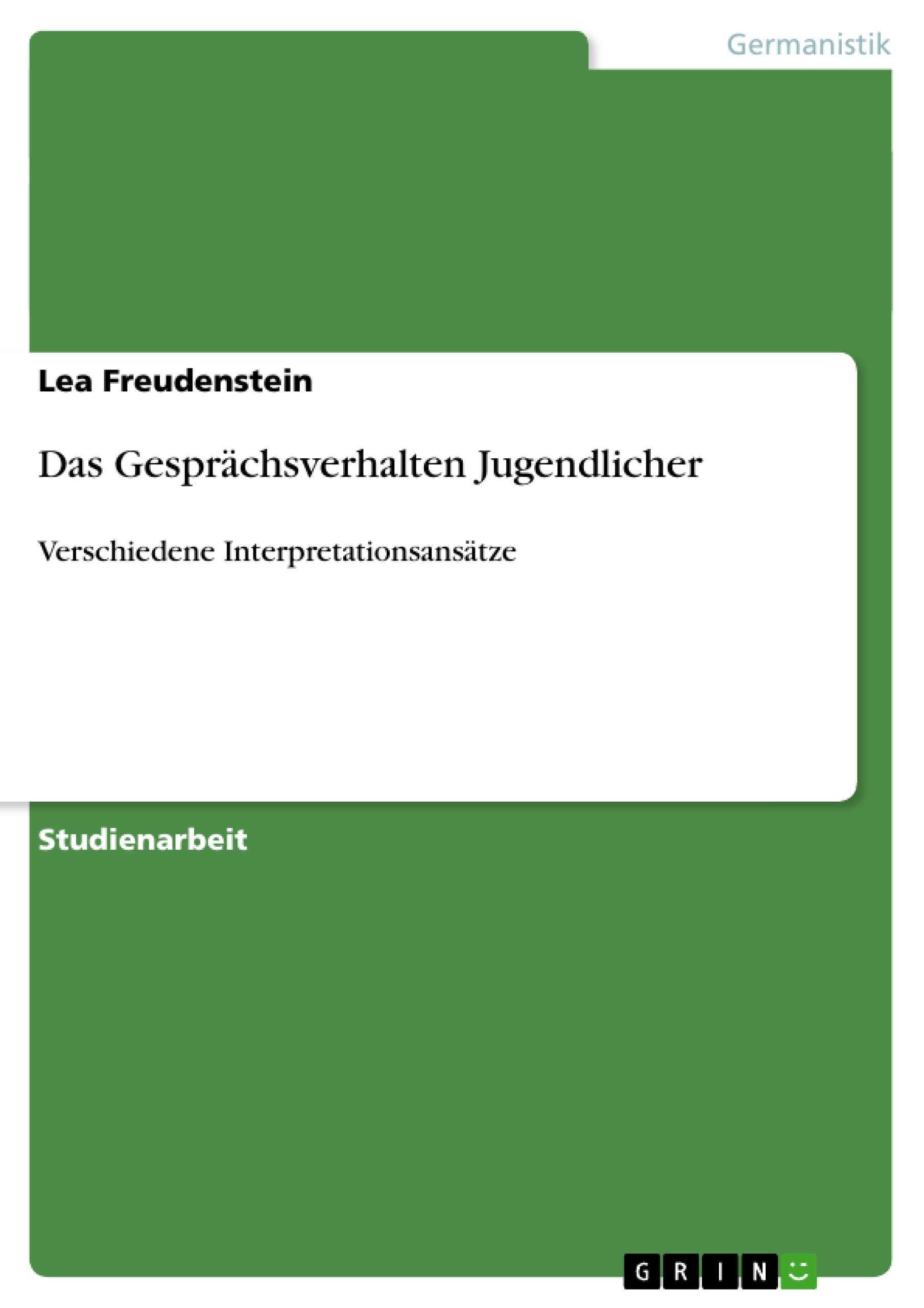Im Rahmen dieser Hausarbeit soll das Gesprächsverhalten männlicher Jugendlicher analysiert werden. Zu diesem Zweck muss zunächst einmal abgegrenzt werden, was unter „der Jugend“ zu verstehen ist und es sollte deutlich werden, dass diese auch von der Gesellschaft durch Definitionen und Institutionen konstituiert wird. Laut dem gängigen Klischee sei beim Gesprächsverhalten Jugendlicher ein Verfall der Sprachkultur zu beobachten, der maßgeblich die Beziehung zu Menschen anderer Generation störe und häufig zu Missverständnissen und Konflikten führe. Statt Takt, Höflichkeit, grammatischer Korrektheit und Angemessenheit des Ausdrucks höre man Kraftausdrücke, unvollständige Sätze und ungenaue Formulierungen (vgl. Deppermann 2001). Um diesem Klischee nachzugehen, werden im Verlauf der Arbeit drei Transkripte von Gesprächen unter männlichen Jugendlichen analysiert. Wichtig ist dabei zu betonen, dass es die eine, homogene Jugendsprache nicht gibt, weshalb in dieser Arbeit grammatischen Phänomenen oder dialektalen Besonderheiten relativ wenig Beachtung geschenkt wird. Die kommunikative Begegnung, die Themen und der Stil sollen im Vordergrund stehen. Die Mehrstimmigkeit vieler verschiedener Jugendgruppen bleibt zu beachten (vgl. Neuland 2012). Aus ökonomischen Gründen wird im Verlauf dieser Arbeit trotzdem von „der Jugendsprache“ die Rede sein, in der Hoffnung, dass eine differenzierte Betrachtungsweise trotzdem möglich ist. Betrachtet wird die intragenerationelle Kommunikation in entspanntem und spielerischem Klima. Die Tendenz, die zu untersuchende Generation isoliert zu betrachten, ist immer wieder zu erkennen. Es bleibt im Laufe dieser Arbeit zu beobachten, inwieweit diese Art der Untersuchung zielführend ist. Für die meisten Vertreter der älteren Generationen gelten, wenn auch oft unbewusst, die Grice'schen Konversationsmaximen, auf die im dritten Punkt näher eingegangen werden wird. Danach folgt die Analyse der drei Transkripte, wobei sie zuerst aus dem Blickwinkel der Erwachsenen beziehungsweise mit Blick auf die Konversationsmaximen betrachtet werden. Es folgt eine erneute Interpretation in dem Versuch eine andere, internere Sichtweise zu erlangen und der Frage nachzugehen, ob die Jugendlichen ebenfalls Maximen folgen und vor allem, was diese vorschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Generationenbegriff
- Die vier Konversationsmaxime von Paul Grice
- Interpretationen von Transkripten von Gesprächen unter Jugendlichen
- Interpretation des Transkripts „Fetter Arsch" im Sinne der Grice'schen Konversationsmaxime
- Versuch einer Reinterpretation des Transkripts „Fetter Arsch"
- Interpretation des Transkripts „Ferrero-Küsschen" im Sinne der Grice'schen Konversationsmaxime
- Versuch einer Reinterpreation des Transkripts „Ferrero-Küsschen"
- Interpretation des Transkripts JuSpiL 18-07-05 Zelt 9 innen (Index: — im Sinne der Grice'schen Konversationsmaxime
- Versuch einer Reinterpreation des Transkripts JuSpiL 18-07-05 Zelt 9 innen (Index: 0.06:02 - 0.06:29)
- Fazit
- Bibliographie
- Arbeitskorpus
- franskript 1: Fetter Arsch
- Transkript 2: Ferrero-Küsschen
- franskript 3: JuSpiL 18-07-05 zelt 9 innen (Index: 0.06:02 - 0.06:29)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Gesprächsverhalten männlicher Jugendlicher. Sie untersucht, wie die Jugendlichen in verschiedenen Situationen kommunizieren und ob sie dabei bestimmte Regeln befolgen. Die Arbeit befasst sich mit dem Generationenbegriff, den Grice'schen Konversationsmaximen und der Interpretation von drei Transkripten von Gesprächen unter Jugendlichen.
- Der Generationenbegriff und die Konstitution von Jugend
- Die Grice'schen Konversationsmaxime und ihre Anwendung in der Jugendsprache
- Die Interpretation von jugendlichem Gesprächsverhalten anhand von Transkripten
- Die Rolle von Spaß, Wettbewerb und Statusverhandlungen in der jugendlichen Kommunikation
- Die Grenzen der Interpretation von jugendlichem Gesprächsverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Gesprächsverhalten männlicher Jugendlicher. Das Kapitel „Der Generationenbegriff" befasst sich mit der Definition von Generation und den damit verbundenen Stereotypen. Der dritte Abschnitt erläutert die vier Konversationsmaxime von Paul Grice und ihre Bedeutung für die Analyse von Gesprächen.
Die Kapitel 4.1 bis 4.6 analysieren drei Transkripte von Gesprächen unter Jugendlichen. Die Transkripte „Fetter Arsch", „Ferrero-Küsschen" und „JuSpiL 18-07-05 Zelt 9 innen" werden jeweils im Sinne der Grice'schen Konversationsmaxime interpretiert und anschließend einer Reinterpretation unterzogen, die die jugendlichen Kommunikationsregeln in den Vordergrund stellt. Die Analyse der Transkripte zeigt, dass Jugendliche häufig gegen die Konversationsmaximen verstoßen, aber gleichzeitig eigene Regeln und Normen befolgen, die für Außenstehende schwer zu verstehen sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Gesprächsverhalten, die Jugendsprache, die Grice'schen Konversationsmaxime, die Interpretation von Transkripten, der Generationenbegriff, Spaß, Wettbewerb und Statusverhandlungen. Die Arbeit untersucht die kommunikativen Besonderheiten von Gesprächen unter männlichen Jugendlichen und analysiert, wie diese mit den Konventionen der Sprachkultur umgehen. Die Analyse zeigt, dass die jugendliche Kommunikation durch eigene Regeln und Normen geprägt ist, die von Erwachsenen oft als Verfall der Sprachkultur interpretiert werden.
- Quote paper
- Lea Freudenstein (Author), 2013, Das Gesprächsverhalten Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274809