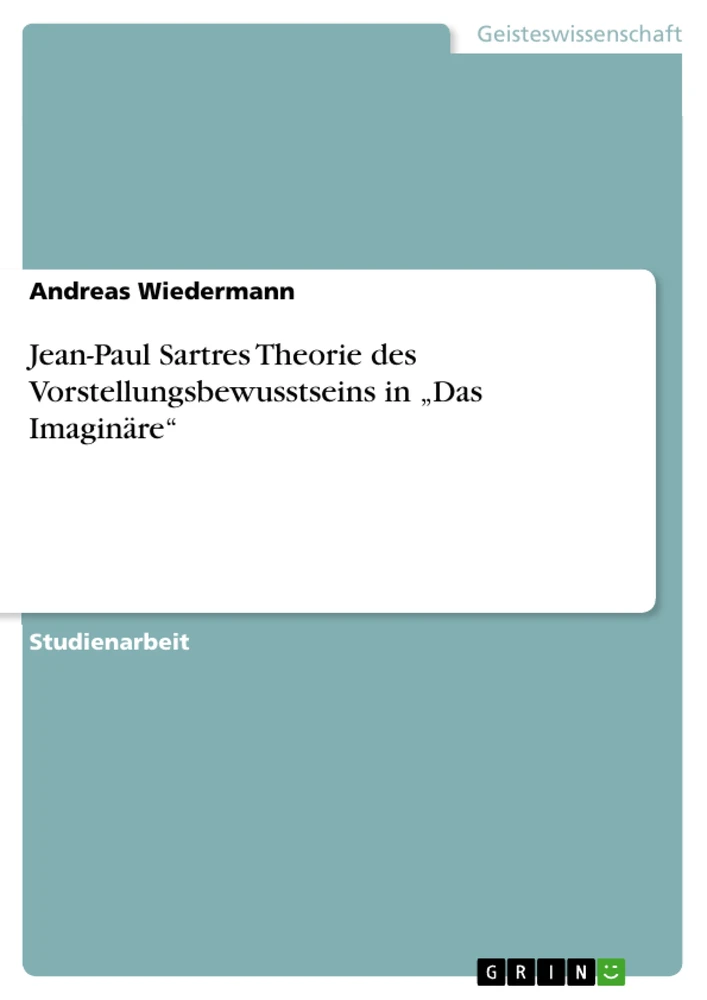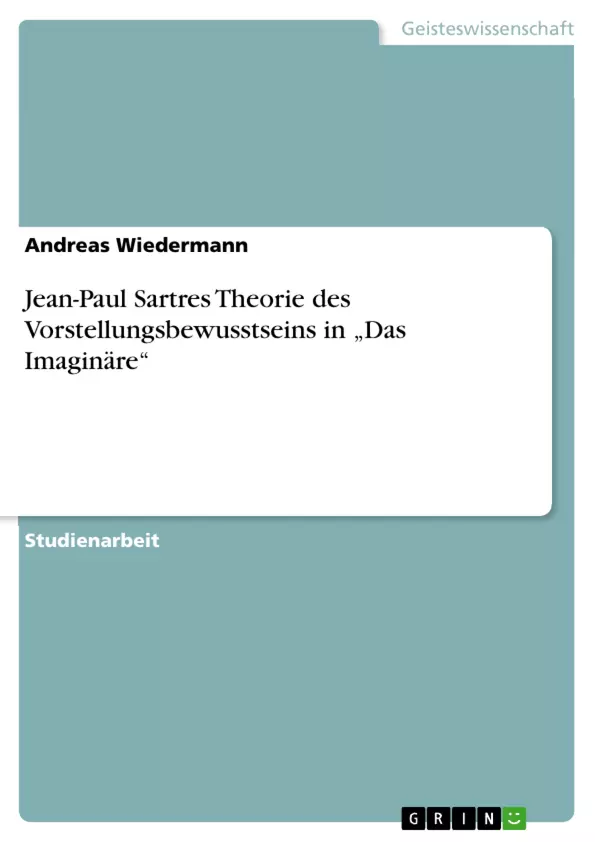Jean-Paul Sartre gab 1969 ein Interview, in dem er unter anderem erklärte, warum er an einer Biographie über den Schriftsteller Flaubert arbeite. Diese Arbeit sei für ihn eine Fortsetzung seiner frühen Studie über „Das Imaginäre“ aus den 1930er Jahren. Damit gibt Sartre dieser Schrift den Status einer theoretischen Fundierung dessen, was er einige Jahrzehnte später in seiner umfangreichen Flaubertstudie „Der Idiot der Familie“ versucht hat anzuwenden. Er weist ihr damit zugleich eine zentrale Bedeutung in seinem
Gesamtwerk zu.
Sartre verfolgt mit dieser Studie vor allem das Ziel, eine neue
Imaginationstheorie zu entwickeln, indem er versucht, über die aus seiner Sicht verbreiteten Irrtümer in Hinblick auf die Vorstellung des Imaginären aufzuklären. Er kritisiert die Psychologen seiner Zeit, die mittels wissenschaftlicher Hypothesen versuchen, die Natur der Vorstellung zu ergründen, ohne vorher durch Reflexion das Wesen der Vorstellung erfasst zu haben. Sartre stellt sich auf den Standpunkt Descartes, dass ein reflexives Bewusstsein „absolute gewisse Gegebenheiten liefert“. Wer sich etwas vorstellt, weiß durch Reflexion, dass er sich etwas vorstellt. Diese „Gewissheit“ bedarf keiner weiteren wissenschaftlichen Explikation über die
Natur der Vorstellung, die erst im Nachhinein erklären soll, warum wir eine Vorstellung als solche erkennen. Dies ist Sartres Ausgangspunkt sowohl einer Widerlegung bisheriger Imaginationstheorien als auch der Entwicklung einer neuen Theorie.
Die Studie über „Das Imaginäre“ speist sich aus zwei Quellen: der
husserlschen Phänomenologie und der Psychologie. Mit dieser Hausarbeit soll versucht werden, die phänomenologischen Ergebnisse der Studie zu rekonstruieren. Dieser Fokus hat zur Folge, dass nur die ersten Kapitel des Buches „Das Imaginäre“ betrachtet werden sowie Sekundärliteratur, die sich mit diesen Textabschnitten auseinandersetzt. Außerdem werden einige wichtige Begriffe, die Sartre in „Das Imaginäre“ ohne weitere Erklärung verwendet, wie Akt oder Nichts, vorausgesetzt. Die Gliederung der Arbeit folgt dabei weitgehend der Gliederung, die „Das Imaginäre“ vorgibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die vier Grundcharakteristika der Vorstellung
- Abkehr von der Immanenz-Illusion – Vorstellung als Bewusstseinsform
- Die Quasi-Beobachtung
- Die Setzung des Objekts als Nichts
- Spontanität
- Das Bild und die Materie
- Das Bild
- Die Materie
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Schrift „Das Imaginäre“ von Jean-Paul Sartre verfolgt das Ziel, eine neue Imaginationstheorie zu entwickeln und verbreitete Irrtümer in Hinblick auf die Vorstellung des Imaginären aufzudecken. Sartre kritisiert dabei die psychologische Erforschung der Vorstellung, die ohne vorherige reflexive Betrachtung des Wesens der Vorstellung erfolgt.
- Reflexive Betrachtung der Vorstellung als Ausgangspunkt
- Kritik an der Immanenz-Illusion in der Vorstellungstheorie
- Vorstellung als Bewusstseinsform: Intentionale Relation des Bewusstseins zu Objekten
- Das Verhältnis von physischem Bild (image physique) und Vorstellungsbild (image mentale)
- Bedeutung der Phänomenologie für Sartres Vorstellungstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten Kapitel von „Das Imaginäre“ befassen sich mit den vier Grundcharakteristika der Vorstellung. Das erste Kapitel kritisiert die Immanenz-Illusion, die Vorstellung als Inhalt im Bewusstsein begreift. Sartre argumentiert, dass die Vorstellung eine spezifische Form des Bewusstseins ist, die sich durch eine intentionale Relation zu einem Objekt außerhalb des Bewusstseins definiert. Die folgenden Kapitel analysieren die Quasi-Beobachtung als charakteristische Eigenschaft der Vorstellung, die Setzung des Objekts als Nichts und die Spontanität der Vorstellung. Diese Kapitel legen den Grundstein für Sartres Verständnis der Vorstellung als Bewusstseinsform, die sich von der Wahrnehmung durch ihre spezifische Beziehung zu einem Objekt unterscheidet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe in „Das Imaginäre“ sind Vorstellung, Bewusstsein, Immanenz-Illusion, Intention, Objekt, Nichts, Quasi-Beobachtung, Spontanität, physisches Bild, Vorstellungsbild. Die Arbeit befasst sich mit der phänomenologischen Analyse der Vorstellung, insbesondere mit der Kritik an traditionellen Imaginationstheorien und der Entwicklung einer neuen, intentionalen Vorstellungstheorie.
- Citar trabajo
- Andreas Wiedermann (Autor), 2013, Jean-Paul Sartres Theorie des Vorstellungsbewusstseins in „Das Imaginäre“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274245