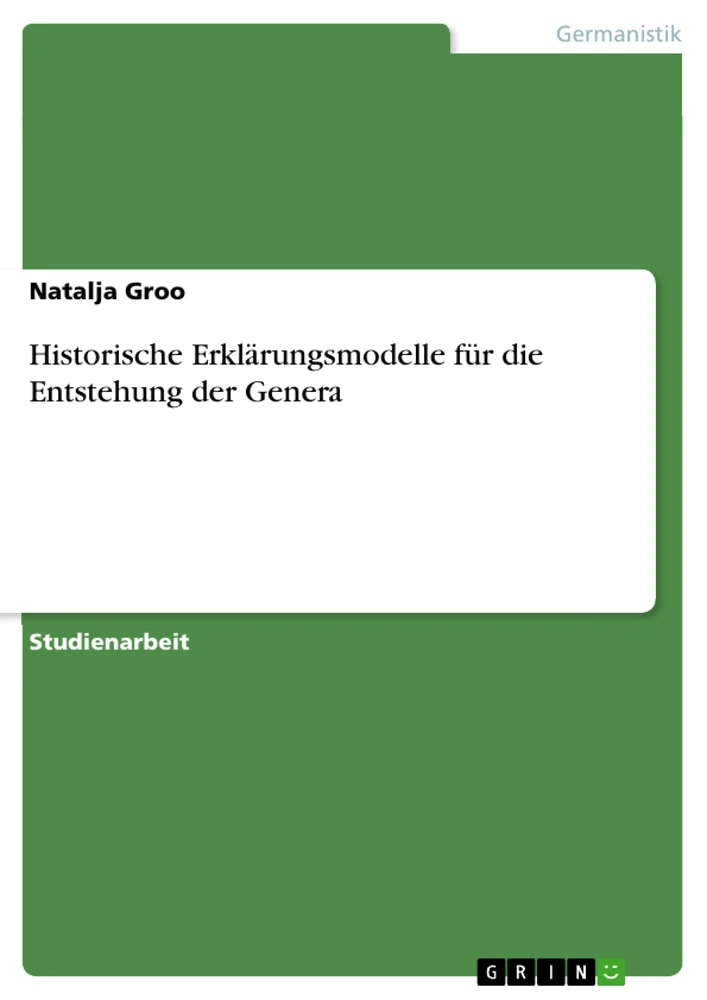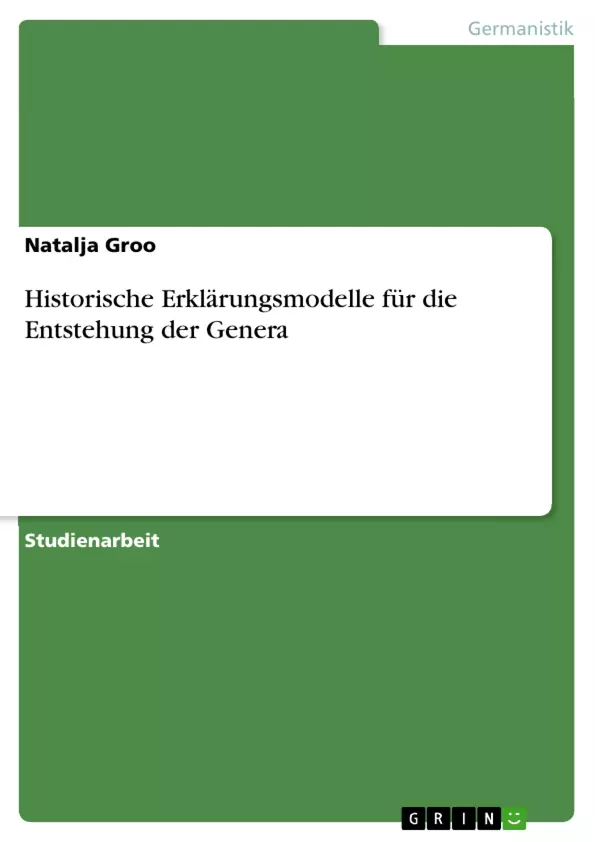Beginnen möchte ich mit einigen allgemeinen Überlegungen zum Verhältnis von Genus und Sexus. Wie allgemein bekannt ist, handelt es sich beim Sexus, dem natürlichen Geschlecht um eine Kategorie, die sich auf einen außersprachlichen Aspekt bezieht. Dem Sexus nach unterscheidet man „männliche“ und „weibliche“ Wesen. Das Genus hingegen steht für eine grammatische Kategorie, die alle Substantive des Deutschen in drei Klassen - Maskulinum/Femininum/Neutrum - teilt. Im Unterschied zu den grammatischen Kategorien „Numerus“ und „Kasus“ ist das „Genus“ eine Wortkategorie. Das heißt, dass alle Substantive im Deutschen „unabhängig vom Satz ein bestimmtes grammatisches Geschlecht besitzen“.1 Die übrigen deklinierbaren Wortarten: Artikel, Adjektive und einige Pronomen kongruieren im Satz mit dem Bezugssubstantiv, indem sie Kasus-, Numerus- und Genusform dieses Substantivs annehmen. Das Genus der Substantive kommt vor allem an der Form der vom Substantiv abhängigen Wörter zum Ausdruck. Bei einigen abgeleiteten Substantiven ist das Genus auch an Suffixen erkennbar (-heit, -keit).
Wenn wir das Genus und den Sexus auf die Saussuresche Terminologie beziehen würden, so würde das Genus dem SIGNIFIANT, der Sexus dagegen dem SIGNIFIÉ entsprechen.2 Die Natur der Genus-Sexus-Beziehungen ist aber so, dass der Sexus nur eine von mehreren SIGNIFIÉ-Aspekten des Genus ist. Ein 1:1-Verhältnis von Form und Bedeutung gibt es hier nicht. Das ergibt sich schon daraus, dass die meisten Substantive kein natürliches Geschlecht haben, sondern ihnen mehr oder weniger zufällig ein Genus zugewiesen werden muss. Und sogar bei Personenbezeichnungen, bei denen einige linguistische Forscher eine eindeutige biologische Motivation vermuten, entspricht das Genus dem natürlichen Geschlecht nicht immer: das Weib, das Kind, die Memme usw.
Die Suche nach der möglichen Bedeutung der grammatischen Kategorie „Genus“ hat zu unzähligen Auseinandersetzungen zwischen Linguisten geführt. In der Sprachgeschichte z. B. ist die Frage nach der Genusentstehung in der deutschen Sprache in den Rang der sogenannten „Huhn-Ei“ -Frage geraten. Im nächsten Kapitel wird versucht, die Debatten um die Genusentstehung näher zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- I Allgemeines
- II Historische Erklärungsmodelle für die Entstehung der Genera
- II.1 Sexus-Unterschied als primäre Ursache der Genusdifferenzierung
- II.2 Sexus als sekundärer Genusaspekt
- III Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Frage, wie die Entstehung der grammatischen Kategorie Genus in der deutschen Sprache erklärt werden kann. Die Autorin untersucht verschiedene historische Erklärungsmodelle, insbesondere den Einfluss des Sexus auf die Genusdifferenzierung. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Genus-Systems und die Rolle der romantischen Sprachauffassung in dieser Entwicklung.
- Verhältnis von Genus und Sexus
- Historische Erklärungsmodelle für die Entstehung der Genera
- Sexus als primäre bzw. sekundäre Ursache der Genusdifferenzierung
- Rolle der romantischen Sprachauffassung
- Entwicklung des Genus-Systems in der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
I Allgemeines
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die allgemeine Beziehung zwischen Genus und Sexus. Die Autorin verdeutlicht, dass Genus eine grammatische Kategorie ist, die alle Substantive des Deutschen in drei Klassen einteilt, während Sexus sich auf ein außersprachliches Merkmal bezieht. Der Text hebt die Unterschiede zwischen Genus und Sexus hervor und zeigt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen beiden Kategorien nicht gegeben ist.
II Historische Erklärungsmodelle für die Entstehung der Genera
Das zweite Kapitel befasst sich mit verschiedenen historischen Erklärungsmodellen für die Entstehung des Genus-Systems in der deutschen Sprache. Die Autorin stellt zwei gegensätzliche Ansätze vor:
II.1 Sexus-Unterschied als primäre Ursache der Genusdifferenzierung
Die erste Theorie argumentiert, dass der Sexusunterschied die Grundlage für die Entwicklung des Genus-Systems bildet. Protagoras wird als Urvater dieser Theorie vorgestellt, der die Kategorien maskulin, feminin und unbelebt als Kennzeichnungen für Substantive verwendete. Die Autorin erläutert, wie diese Theorie im 18. Jahrhundert durch romantische Strömungen beeinflusst wurde und wie Philosophen und Sprachtheoretiker wie Herder und Adelung die Entstehung der Sprache aus einer anthropologischen Perspektive betrachteten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Genus und Sexus, historische Erklärungsmodelle, romantische Sprachauffassung, Genusdifferenzierung, Anthropologie, Sprache und Sprachgeschichte. Die Arbeit untersucht insbesondere die Beziehung zwischen Genus und Sexus und die Entwicklung des Genus-Systems in der deutschen Sprache.
- Citar trabajo
- Natalja Groo (Autor), 2011, Historische Erklärungsmodelle für die Entstehung der Genera, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274061