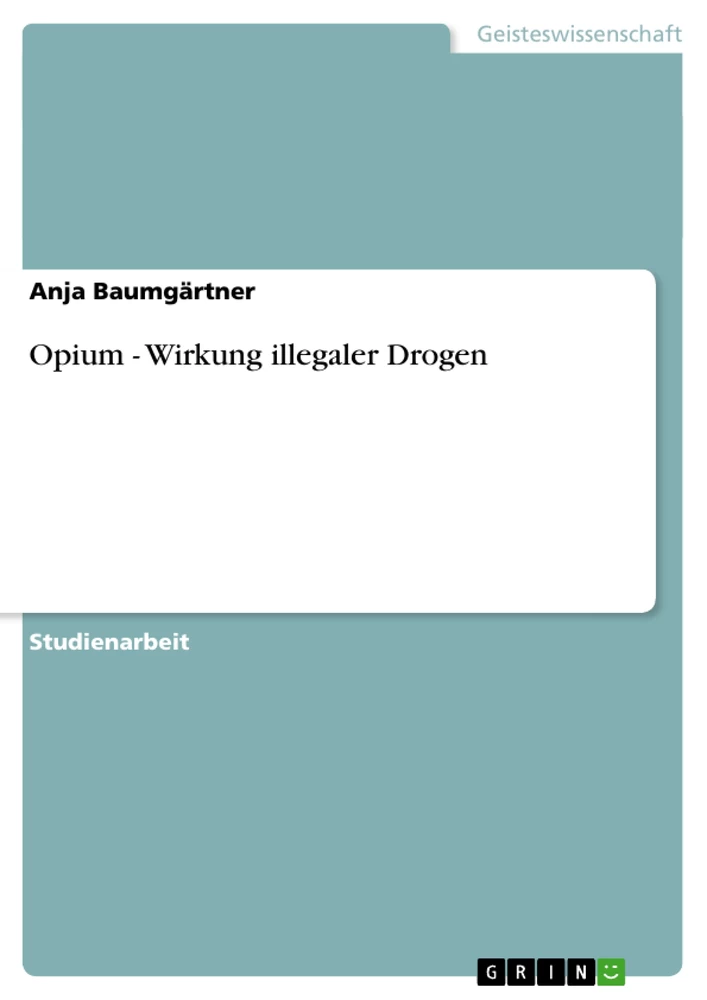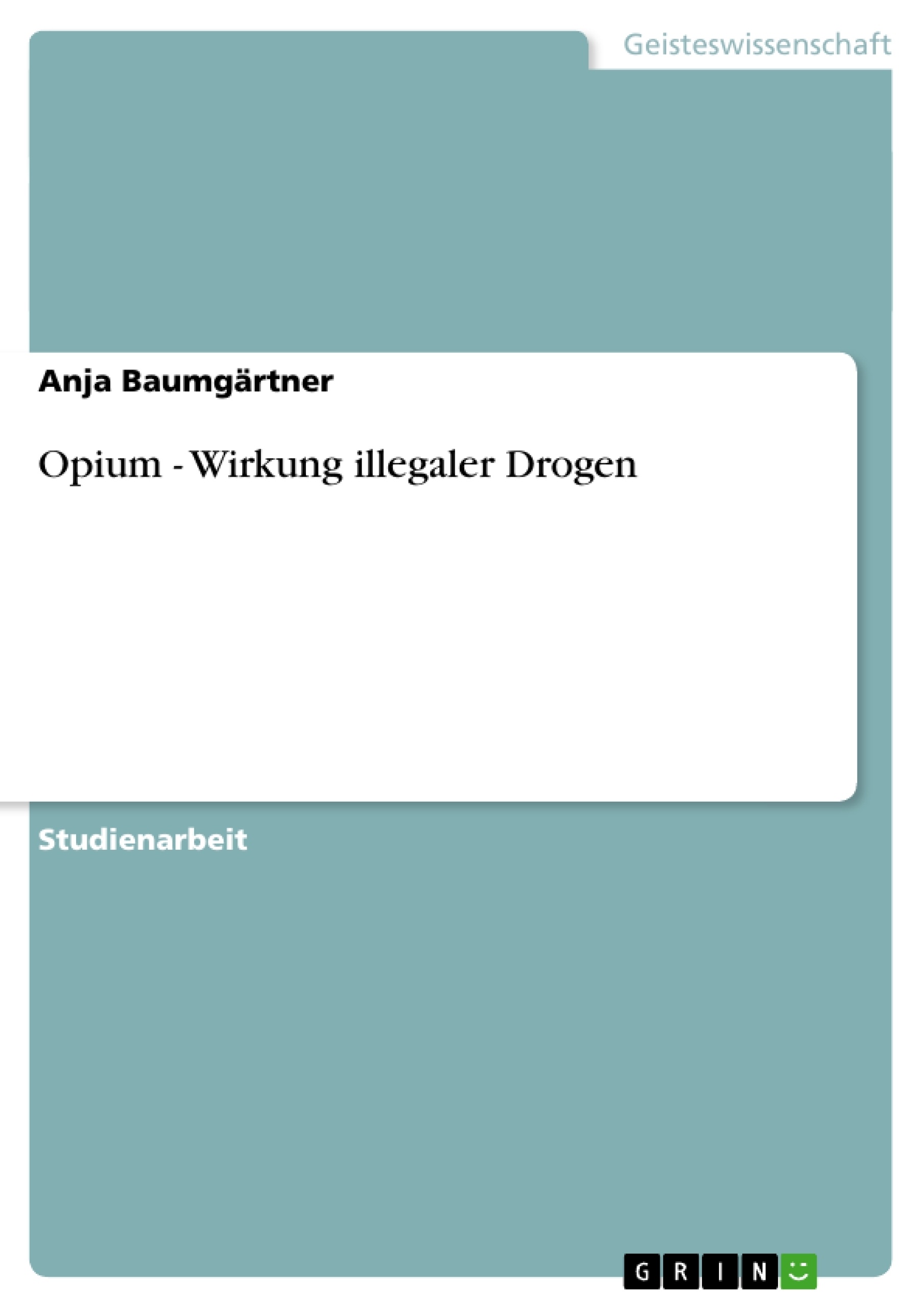Überall auf der Erde blühen Mohnfelder, von Mexiko über Kleinasien und Südasien
bis hin nach Tasmanien, überall dort, wo günstige Klimabedingungen für das Gedeihen
der narkotischen Inhaltsstoffe des Mohns herrschen. Als kultisches Symbol, als nahrhafte Speise und als heilende Pflanze trat der Mohn in die Geschichte der Völker Kleinasiens. Lange bevor die Mohnpflanze als Droge galt, gelangte der Saft des Mohns, das Opium, ins Innere Asiens und nach China. Dort
entwickelte sich eine erste Opiumsucht die zum Opiumverbot und zu den Opiumkriegen
führte. Im 19. Jahrhundert änderte sich die Anwendungsweise des Opiums:
Es wurde zu einem der wichtigsten Arzneimittel und zu einer der populärsten Drogen.
In den letzten Jahrzehnten der medizinischen und chemischen Forschung zeigt das
Opium mit seinen Derivaten immer mehr sein wahres Janusköpfiges Gesicht: als
Schmerzmittel und als Droge. Die Gattung des Mohns ist über die ganze Welt verstreut, dessen botanische Systematik kennt heute ca. 700 Arten. Aber die einzige Gattung, die in seiner noch nicht
reifen Kapselwand den begehrten Saft enthält, der Schlaf bringt und Schmerz lindert,
ist der Papaver somniferum1. Der in Europa einheimische Klatschmohn ist psychisch
vollkommen wirkungslos. Mohn verfügt über ölreiche Samen, die nicht opiumhaltig sind. Wirksam ist alleine der
Saft, was auch die Gewinnung von Opium sehr schwierig und aufwendig macht.
Zur Gewinnung des Opiums wird die äußere Kapselwand behutsam mit einem mehrklingigen
Spezialmesser angeritzt.2 Die austretende Mohnmilch verfärbt sich sofort
braun und trocknet ein. Am nächsten Tag schabt man die verdickte Masse ab und
sammelt sie in Gefäßen. Pro Kapsel erhält man ca. 0,5 Gramm Rohopium. [...]
1 lat. = Schlafmohn
2 Angeritzte Mohnkapsel: siehe Anhang, S.11, Abb. 2
Inhaltsverzeichnis
- 1 Schlafmohn
- 2 Opium
- 2.1 Die Pflanze
- 2.2 Opium in verschiedenen Kulturen
- 2.3 Opium in China
- 3 Chemische und physiologische Wirkung von Opium
- 3.1 Chemische Verbindung von Opium
- 3.1.1 Morphin
- 3.1.2 Heroin
- 3.1.3 Kodein
- 3.2 Ein Opiumrausch
- 3.3 Nebenwirkungen
- 4 Gesetzliche Lage
- 5 Opium in der heutigen Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte und Wirkung von Opium. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Pflanze, ihre Verwendung in verschiedenen Kulturen, ihre chemische Zusammensetzung und ihre physiologische Wirkung zu geben. Die gesetzliche Lage wird ebenfalls kurz betrachtet.
- Die Geschichte des Opiums von der Antike bis zur Neuzeit
- Die Rolle des Opiums in verschiedenen Kulturen
- Die chemische Zusammensetzung und die Wirkstoffe des Opiums
- Die physiologische Wirkung von Opium und seine Nebenwirkungen
- Die Bedeutung des Opiums im Kontext der Opiumkriege
Zusammenfassung der Kapitel
1 Schlafmohn: Der Schlafmohn, Papaver somniferum, wird weltweit angebaut, wo günstige klimatische Bedingungen herrschen. Seine Geschichte ist eng mit Kleinasiens Kulturen verbunden, wo er zunächst als kultisches Symbol, Nahrungsmittel und Heilpflanze diente. Später, in Asien und China, entstand daraus eine weitverbreitete Sucht, die zu Verboten und den Opiumkriegen führte. Im 19. Jahrhundert fand Opium als Arzneimittel und Droge breite Anwendung, wobei die Forschung seine Janusköpfigkeit als Schmerzmittel und Suchtmittel immer deutlicher aufzeigt.
2 Opium: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Opiumgewinnung. Es beschreibt den Anbau und die Verarbeitung des Schlafmohns, wobei die Gewinnung des Opiums als aufwändig und schwierig dargestellt wird. Der Text betont, dass nur der Saft der unreifen Kapsel opiumhaltig ist und die Samen diesbezüglich unwirksam sind. Detailliert wird der Prozess der Gewinnung aus den Mohnkapseln geschildert, einschließlich der benötigten Mengen an Kapseln für eine bestimmte Menge an Rohopium.
2.2 Opium in verschiedenen Kulturen: Die Verwendung von Opium lässt sich bis zu den Sumerern und Assyrern zurückverfolgen, die es als „Pflanze der Freude“ bezeichneten. Über Ägypten und Griechenland verbreitete sich die Kenntnis und Verwendung des Opiums weiter nach Westen, wo im römischen Reich erste Anzeichen von Opiumsucht auftraten. Araber verbreiteten die Droge während ihrer Kreuzzüge weiter nach Persien, Indien und China. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem rituellen Opiumrauchen bei den Arabern, das einen sozialen und hygienischen Kontext besaß.
2.3 Opium in China: In China erlangte Opium größte Bedeutung als Rauschmittel. Zunächst wurde es gegessen, es spielte auch eine negative Rolle in Zeiten des Hungers, da es den Appetit dämpft. Der Import von Opium aus Indien, insbesondere durch die East India Company, führte zu politischen Konflikten und den Opiumkriegen. Diese Kriege waren zwar auch mit anderen wirtschaftlichen und politischen Zielen verbunden, aber der Opiumhandel bildete einen wichtigen Anlasspunkt für die gewaltsame Öffnung Chinas für den Westen.
3 Chemische und physiologische Wirkung von Opium: Rohopium enthält etwa 25 Alkaloide, wobei Morphin den Hauptbestandteil mit 10-12% ausmacht. Der Text deutet die komplexen chemischen und physiologischen Wirkungen von Opium und seinen Derivaten an, ohne explizit auf Details der Wirkungsmechanismen einzugehen.
Schlüsselwörter
Opium, Schlafmohn, Papaver somniferum, Opiumkriege, Morphin, Sucht, China, Geschichte, Kultur, Wirkung, Alkaloide.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Opium – Geschichte, Wirkung und gesetzliche Lage
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über Opium, beginnend mit dem Schlafmohn (Papaver somniferum) als Ursprungspflanze. Er behandelt die Geschichte des Opiums in verschiedenen Kulturen, seine chemische Zusammensetzung (insbesondere Morphin, Heroin und Kodein), seine physiologische Wirkung und Nebenwirkungen, sowie die rechtliche Situation und seine Bedeutung im Kontext der Opiumkriege. Es werden Kapitelzusammenfassungen, die Zielsetzung und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Worum geht es in Kapitel 1 „Schlafmohn“?
Kapitel 1 beschreibt den Schlafmohn als Ursprungspflanze des Opiums, seinen weltweiten Anbau und seine historische Bedeutung in kleinasiatischen Kulturen, wo er zunächst kultisch, als Nahrungsmittel und Heilpflanze genutzt wurde. Später führte sein Gebrauch in Asien und China zu weitverbreiteter Sucht, Verboten und schließlich zu den Opiumkriegen. Im 19. Jahrhundert fand Opium breite Anwendung als Arzneimittel und Droge.
Was wird in Kapitel 2 „Opium“ behandelt?
Kapitel 2 befasst sich detailliert mit der Opiumgewinnung aus dem Schlafmohn, dem Anbau und der Verarbeitung. Es betont, dass nur der Saft der unreifen Kapsel opiumhaltig ist und beschreibt den Prozess der Gewinnung und die benötigten Mengen an Kapseln.
Welche Informationen liefert Kapitel 2.2 „Opium in verschiedenen Kulturen“?
Dieses Unterkapitel verfolgt die Geschichte der Opiumverwendung von den Sumerern und Assyrern bis in die Neuzeit. Es beschreibt die Verbreitung von Opium über Ägypten, Griechenland und das Römische Reich bis nach Persien, Indien und China, wobei das rituelle Opiumrauchen bei den Arabern besonders hervorgehoben wird.
Worüber informiert Kapitel 2.3 „Opium in China“?
Kapitel 2.3 konzentriert sich auf die Bedeutung von Opium als Rauschmittel in China. Es beleuchtet den Import von Opium aus Indien durch die East India Company und die daraus resultierenden politischen Konflikte und Opiumkriege. Der Opiumhandel wird als wichtiger Auslöser für die gewaltsame Öffnung Chinas für den Westen dargestellt.
Was sind die Inhalte von Kapitel 3 „Chemische und physiologische Wirkung von Opium“?
Kapitel 3 beschreibt die chemische Zusammensetzung von Rohopium, insbesondere den Hauptbestandteil Morphin (10-12%). Es deutet die komplexen chemischen und physiologischen Wirkungen von Opium und seinen Derivaten an, ohne detailliert auf Wirkungsmechanismen einzugehen.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Text verbunden?
Die Schlüsselwörter umfassen Opium, Schlafmohn (Papaver somniferum), Opiumkriege, Morphin, Sucht, China, Geschichte, Kultur, Wirkung und Alkaloide.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Wirkung von Opium zu geben. Er soll Informationen über die Pflanze, ihre Verwendung in verschiedenen Kulturen, ihre chemische Zusammensetzung und ihre physiologische Wirkung liefern. Die gesetzliche Lage wird ebenfalls kurz betrachtet.
- Quote paper
- Anja Baumgärtner (Author), 2002, Opium - Wirkung illegaler Drogen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27395