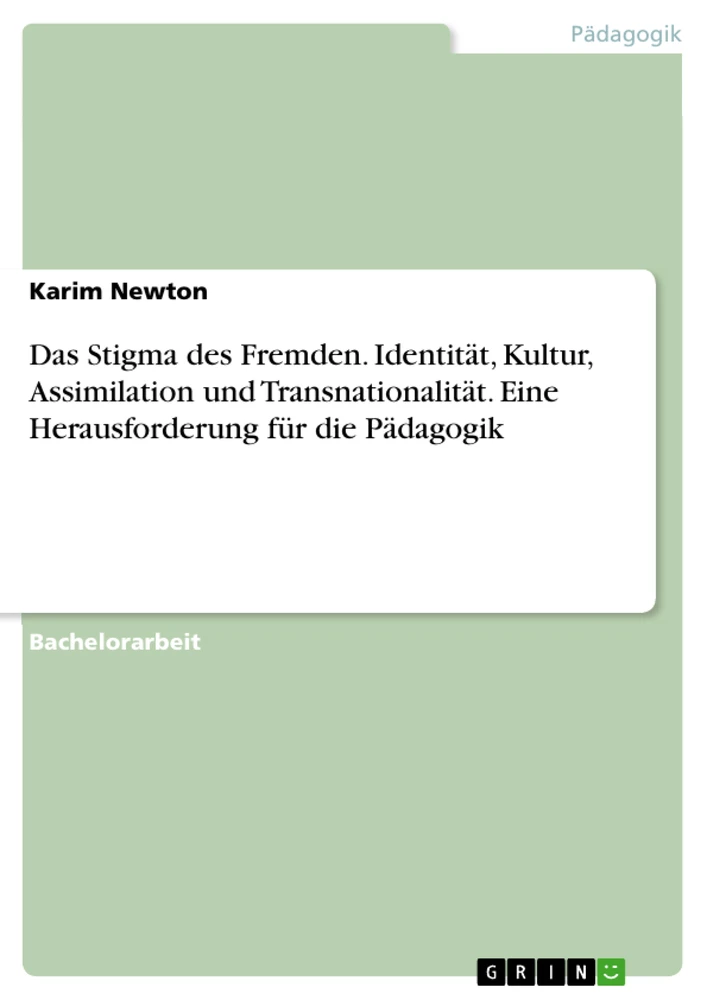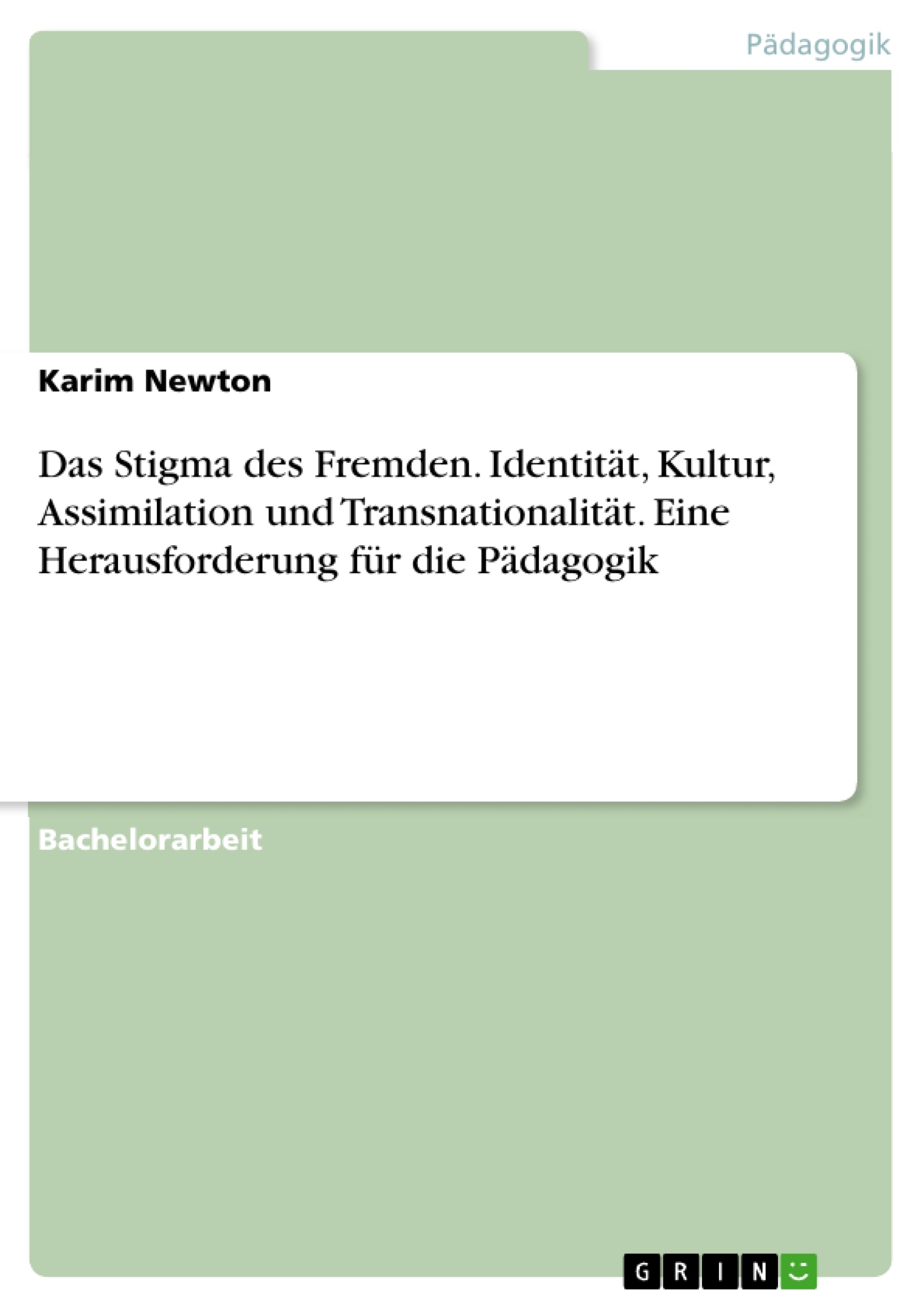Fremdheit oder das „Sich-fremd-fühlen“ sind keinesfalls ausschließlich Phänomene unserer modernen, pluralen und multikulturellen Gesellschaft. Durch Expansion, Handel, Krieg, Vertreibung und Eroberung war der oder das Fremde schon immer präsent und ist somit Teil der Menschengeschichte. Die Erscheinung des Fremden schlägt sich bis heute, auf unterschiedlichste Formen und mit differenzierten Schwerpunktsetzungen, auf viele Teilbereiche der Gesellschaft nieder. Weil Fremdheit ein globales Phänomen ist, das nicht nur den Fremden, der auch in der Fremde verkehrt, sondern auch und überwiegend jenen der in seinem gewohnten und vertrauten Lebensraum verharrt, unweigerlich betrifft, ist sie auch beispielsweise für Pädagogik, Politik, Psychologie und Soziologie von großem Interesse. Nicht zu Letzt durch die aktuell viel diskutierte Leitkulturdebatte, Armutszuwanderung aus der EU und Asylproblematik ist die Frage danach, was Fremdheit bedeutet, wie sie sich anfühlt, welche Emotionen sie auszulösen vermag und wie bzw. ob und wie weit diese überhaupt überwunden werden können. Alldem zufolge ist die Aktualität und Wichtigkeit des Themas durch die permanente, direkte oder indirekte Konfrontation mit dem Fremden immer wiederkehrend, neu begründet. Die Konfrontation mit dem Fremden, dem Unbekannten, führt gewiss auch nicht selten zu Konflikten. Aus diesem Grund sind auch Ressentiments gegenüber Unbekanntem, vermutlich so alt wie die Menschheit. Doch wie haben es Animosität, Ethnozentrismus, und eine stets von Skepsis und Pessimismus geprägte Haltung gegenüber all dem was einem Fremd erscheint, geschafft, sich als ein derart fester, wenn auch oftmals bloß latenter, Bestandteil der Gesellschaft zu manifestieren und bis heute Bestand zu haben. In Zeiten, lange nach der Aufklärung, Weltkriegen, Revolutionen, Pazifismus und vielen weiteren historischen Ereignissen, die gezeigt haben sollten, dass die Menschen sich näher stehen als sie von vornherein glaubten, sind die Termini Fremdenfeindlichkeit, Vorurteile und die Stigmatisierung von Unbekanntem (/-n), häufig debattierte Themen und bilden Mauern im Zusammenleben der Menschen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Fremde
- 1.1 Theorie des „Fremden“
- 1.2 Die Soziologie des Fremden
- 1.2.1 Georg Simmel über die Soziologie des Fremden
- 1.2.2 Alfred Schütz über die Soziologie des Fremden
- 1.2.3 Abschließende Betrachtung beider Theorien
- 1.3 Die soziale Wahrnehmung des Fremden
- 1.4 Vom Unbekannten zum Vorurteil
- 2. Kultur
- 2.1 Was hält eine Gesellschaft zusammen?
- 2.2 Wieviel Vielfalt und Multikulturalität verträgt eine Gesellschaft?
- 2.3 Kulturrelativismus und Universalismus
- 2.4 Von der Kultur zur Identität: Kulturelle Identität
- 3. Identität
- 3.1 Erikson: Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
- 3.1.1 Identität versus Identitätsdiffusion
- 3.2 Die Identität des Fremden
- 3.2.1 Exkurs: Migration
- 3.3 Identität und Migration
- 3.1 Erikson: Das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung
- 4. Herausforderungen für die Pädagogik
- 4.1 Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik
- 4.2 Herausforderungen, Lösungsansätze und Aufgaben der Pädagogik
- 4.2.1 Vorurteile in der pädagogischen Arbeit
- 4.3 Antirassismus-Training: Der Workshop „Blue Eyed“ von Jane Elliott
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Stigma des Fremden im Kontext von Identität, Kultur, Assimilation und Transnationalität und deren Herausforderungen für die Pädagogik. Ziel ist es, die komplexen Interaktionen zwischen Fremdheit, kultureller Identität und pädagogischen Ansätzen zu analysieren.
- Die soziologische Betrachtung des Fremden und die damit verbundenen Theorien.
- Der Einfluss von Kultur und kultureller Identität auf die Wahrnehmung des Fremden.
- Die Herausforderungen der Migration und deren Auswirkungen auf die Identitätsbildung.
- Die Entwicklung der Pädagogik im Umgang mit dem Fremden, von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik.
- Die Rolle von Vorurteilen und die Bedeutung von Antirassismus-Training in der pädagogischen Praxis.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort thematisiert die historische Präsenz von Fremdheit in der Gesellschaft und deren Relevanz für verschiedene Disziplinen, insbesondere die Pädagogik. Es hebt die aktuelle Bedeutung des Themas im Kontext von Leitkulturdebatten, Migration und Asylpolitik hervor und betont die Notwendigkeit, mit dem Phänomen Fremdheit und den damit verbundenen Konflikten und Ressentiments auseinanderzusetzen. Die Arbeit untersucht, wie Animosität und Vorurteile gegenüber dem Fremden trotz der Fortschritte der Menschheitsgeschichte bestehen bleiben.
1. Fremde: Dieses Kapitel befasst sich mit theoretischen und soziologischen Ansätzen zur Betrachtung des „Fremden“. Es analysiert die Theorien von Georg Simmel und Alfred Schütz, um die soziale Wahrnehmung des Fremden und den Übergang vom Unbekannten zum Vorurteil zu beleuchten. Die Kapitel untersuchen, wie der Fremde sozial wahrgenommen wird und wie aus Unbekanntheit Vorurteile entstehen können. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion der sozialen Konstruktion von Fremdheit und der Analyse der damit verbundenen Prozesse.
2. Kultur: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Vielfalt, Multikulturalität, und Kultur. Es befasst sich mit der Frage, was eine Gesellschaft zusammenhält und wie viel kulturelle Vielfalt eine Gesellschaft tolerieren kann. Die Konzepte des Kulturrelativismus und des Universalismus werden diskutiert, und der Zusammenhang zwischen Kultur und Identität, insbesondere kultureller Identität wird analysiert.
3. Identität: Dieses Kapitel analysiert die Identitätsentwicklung nach Erikson und betrachtet die spezifische Identität des Fremden im Kontext von Migration. Es untersucht den Prozess der Identitätsbildung, insbesondere die Herausforderungen der Identitätsfindung für Migranten und die Wechselwirkungen zwischen Identität und Migration. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Integration und die Entwicklung einer neuen Identität in einer fremden Kultur.
4. Herausforderungen für die Pädagogik: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung pädagogischer Ansätze im Umgang mit dem Fremden, von der Ausländerpädagogik hin zur interkulturellen Pädagogik. Es analysiert die Herausforderungen, Lösungsansätze und Aufgaben der Pädagogik im Umgang mit Vorurteilen und zeigt am Beispiel des „Blue Eyed“-Workshops von Jane Elliott praktische Ansätze zur Bekämpfung von Vorurteilen auf.
Schlüsselwörter
Fremdenfeindlichkeit, Identität, Kultur, Assimilation, Transnationalität, Migration, Interkulturelle Pädagogik, Vorurteile, Soziologie des Fremden, Identitätsbildung, Multikulturalität, Kulturrelativismus, Universalismus, Antirassismus-Training.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Das Stigma des Fremden
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Stigma des Fremden im Kontext von Identität, Kultur, Assimilation und Transnationalität und deren Herausforderungen für die Pädagogik. Der Fokus liegt auf der Analyse der komplexen Interaktionen zwischen Fremdheit, kultureller Identität und pädagogischen Ansätzen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt soziologische Theorien des Fremden (Simmel, Schütz), den Einfluss von Kultur und kultureller Identität auf die Wahrnehmung des Fremden, die Herausforderungen der Migration und deren Auswirkungen auf die Identitätsbildung, die Entwicklung der Pädagogik im Umgang mit dem Fremden (von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik), die Rolle von Vorurteilen und die Bedeutung von Antirassismus-Training in der pädagogischen Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort und vier Hauptkapitel: Kapitel 1 ("Fremde") befasst sich mit soziologischen Theorien und der sozialen Wahrnehmung des Fremden. Kapitel 2 ("Kultur") untersucht den Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Vielfalt und kultureller Identität. Kapitel 3 ("Identität") analysiert die Identitätsentwicklung, insbesondere im Kontext von Migration. Kapitel 4 ("Herausforderungen für die Pädagogik") untersucht die Entwicklung pädagogischer Ansätze im Umgang mit dem Fremden und die Bedeutung von Antirassismus-Training.
Welche soziologischen Theorien werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Theorien von Georg Simmel und Alfred Schütz zur Soziologie des Fremden, um die soziale Wahrnehmung des Fremden und den Übergang vom Unbekannten zum Vorurteil zu beleuchten.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Kultur und Identität dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kultur und Identität, insbesondere kultureller Identität, und diskutiert die Konzepte des Kulturrelativismus und des Universalismus im Kontext von gesellschaftlicher Vielfalt und Multikulturalität.
Welche Rolle spielt Migration in der Arbeit?
Migration spielt eine zentrale Rolle, da sie die Identitätsbildung des Fremden und die Herausforderungen der Integration in einer neuen Kultur beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Migration auf die Identitätsfindung und die Wechselwirkungen zwischen Identität und Migration.
Wie wird die Entwicklung der Pädagogik im Umgang mit dem Fremden dargestellt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung pädagogischer Ansätze vom Umgang mit "Ausländern" hin zur interkulturellen Pädagogik. Sie analysiert die Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit Vorurteilen.
Welche praktische Beispiele werden genannt?
Als praktisches Beispiel zur Bekämpfung von Vorurteilen wird der "Blue Eyed"-Workshop von Jane Elliott vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fremdenfeindlichkeit, Identität, Kultur, Assimilation, Transnationalität, Migration, Interkulturelle Pädagogik, Vorurteile, Soziologie des Fremden, Identitätsbildung, Multikulturalität, Kulturrelativismus, Universalismus, Antirassismus-Training.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Interaktionen zwischen Fremdheit, kultureller Identität und pädagogischen Ansätzen zu analysieren und das Stigma des Fremden im Kontext von Identität, Kultur, Assimilation und Transnationalität zu untersuchen.
- Citation du texte
- Karim Newton (Auteur), 2014, Das Stigma des Fremden. Identität, Kultur, Assimilation und Transnationalität. Eine Herausforderung für die Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273799