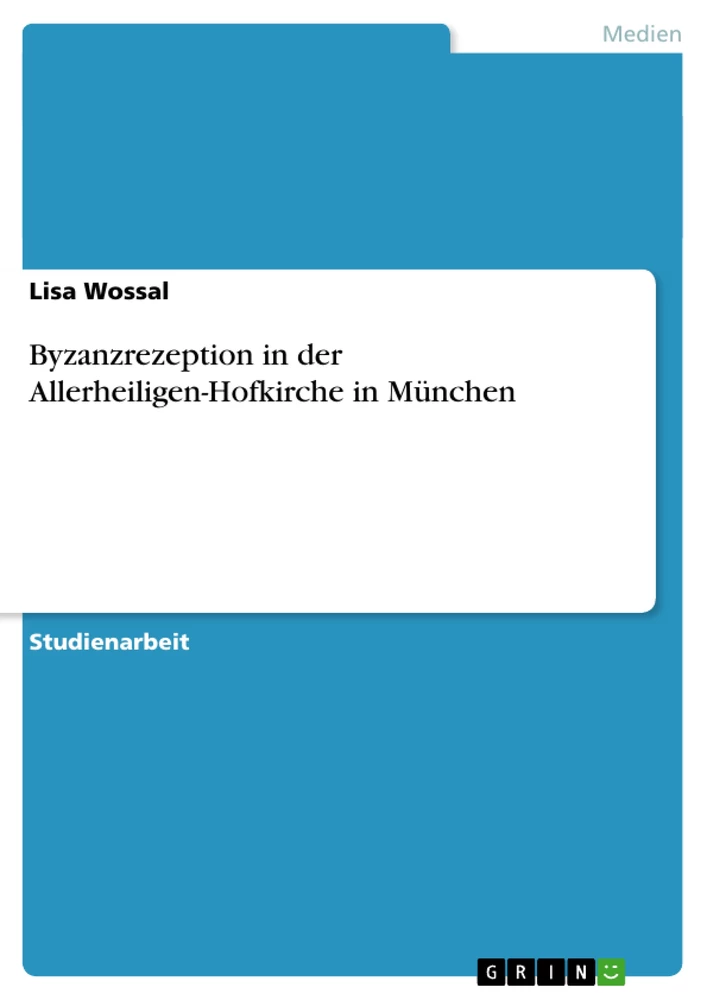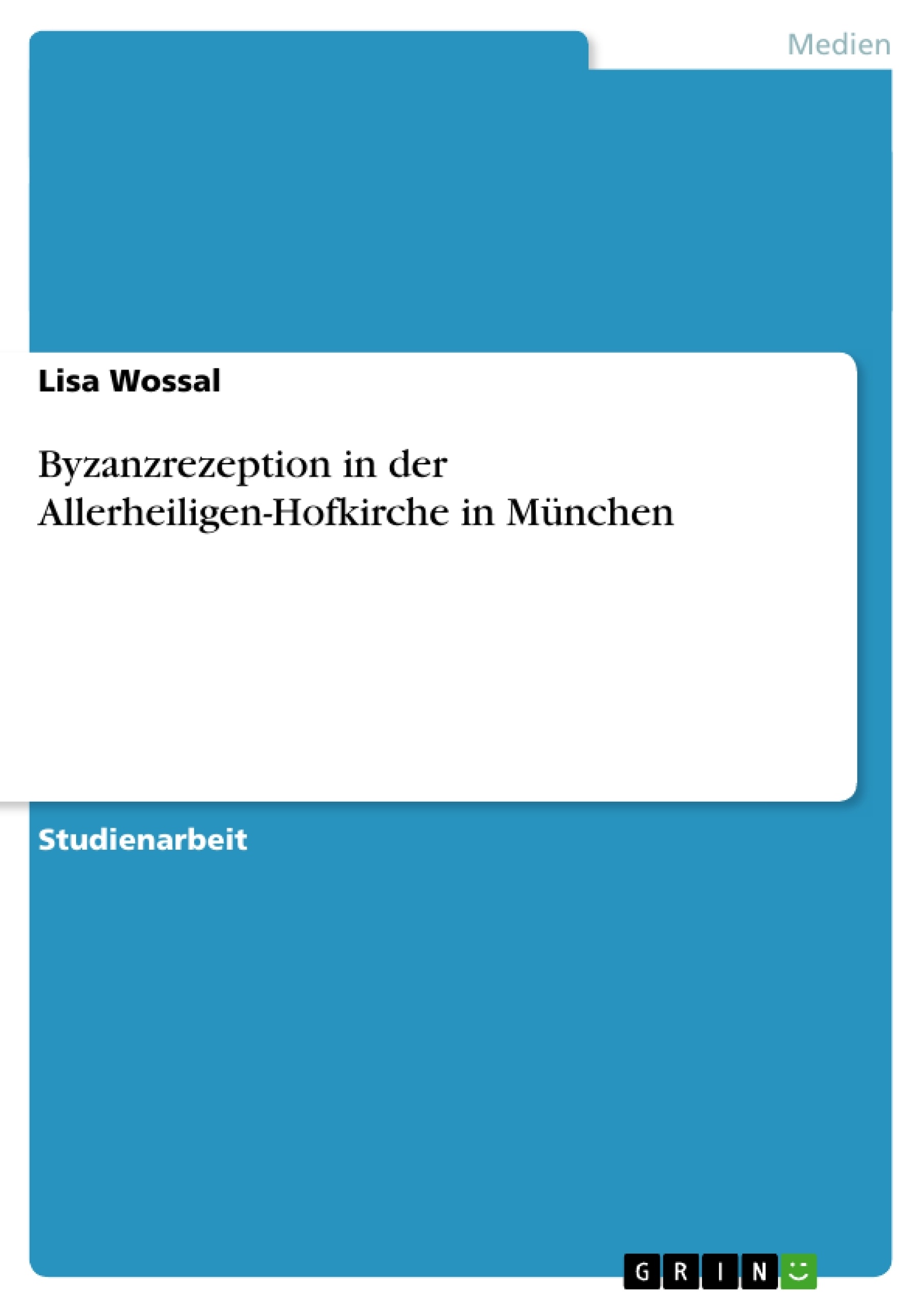Die Zitate aus verschiedensten Zeitepochen machen es deutlich: byzantinische oder Byzanz-rezipierende Kirchengebäude haben seit jeher eine außerordentliche Wirkung auf ihre Besucher. So kam es am Anfang des 19. Jahrhunderts dazu, dass Ludwig I. von Bayern den Plan fasste, in seiner Heimat eine ebensolche Kirche nach byzantinischem Vorbild zu errichten. Zu dieser Zeit entwickelt sich der Historismus in Architektur und Kunst, bei dem Stilelemente vergangener Epochen wieder verwendet, vermischt, kopiert oder neu interpretiert werden. Ludwig Wamser sieht diese Neu- oder, je nach Sichtweise, Rückentwicklung als Reaktion auf die neuen zeitlichen Umstände. Mit der wachsenden Industrialisierung zeigt sich eine Umverteilung in der Gesellschaft; es entsteht eine größer werdende Arbeiterschicht, die ein demokratisches System verlangt. Nun lassen die Herrscher Gebäude errichten, die stilistisch aus Zeiten stammen, in denen eine Person, oft in Einklang mit der Kirche, von Gott gewollt, allein und unangefochten herrschte. So versuchten sie wohl „auch mit Mitteln der Kunst die alten Zustände zu erhalten oder ein Ausgleich zu schaffen“, wie es Wamser formuliert. Dabei entwickelte sich unter Ludwig I. zum ersten Mal eine Vorliebe für den „byzantinischen Stil“. Die Vorstellung dieses Stils unterscheidet sich jedoch in der damaligen Zeit stark von unserer heutigen, da die Bauten des heutigen Griechenlands und der Türkei noch kaum bekannt, vor allem nicht untersucht waren. Wohl bekannt waren dagegen die vom byzantinischen Reich beeinflussten Bauten in Italien, wie die Capella Palatina in Palermo. Diese besuchte Ludwig I. zur Weihnachtsmesse im Jahr 1823 auf seiner Italienreise. Die Wirkung dieser Kirche, mit ihrer Mosaikausstattung und Kuppelgewölben, die am Weihnachtsabend von Kerzen erleuchtet wurden, muss einen enormen Eindruck auf Ludwig gemacht haben. Besonders deutlich wird das in einem Zitat von Leo von Klenze, der später als Hofarchitekt Ludwigs I. galt und auch mit dem Bau der neuen, von Palermo beeinflussten Kirche beauftragt wurde: „Der Goldgrund dieser Gemälde, das sonderbare, phantastische Verhältnis des Ganzen, der Rost eines ehrwürdigen Alterthums, die geschichtlichen Erinnerungen, welche sich daran knüpften, und die heilige Handlung bei mitternächtlicher Beleuchtung hatten auf den Kronprinzen so gewaltigen Eindruck gemacht, dass er nicht Worte finden konnte, mir denselben zu beschreiben.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Wirkung des Goldes
- 2. Leo von Klenze und die Vorbereitungen
- 3. Der Kirchenbau in München
- 3.1 Innenbau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entstehung der Allerheiligen-Hofkirche in München unter König Ludwig I. Der Fokus liegt auf den Einflüssen byzantinischer Architektur, der Rolle des Architekten Leo von Klenze und den Kompromissen zwischen dessen klassizistischer Präferenz und den Wünschen des Königs nach einer byzantinisch inspirierten Kirche. Die Arbeit analysiert den Bauprozess, die Gestaltung des Innenraums und die künstlerische Ausgestaltung.
- Die Wirkung byzantinischer Kirchenarchitektur auf Ludwig I.
- Der Gestaltungsprozess der Allerheiligen-Hofkirche und die Auseinandersetzung zwischen König und Architekt.
- Der Einfluss italienischer Kirchenbauten (Capella Palatina, San Marco) auf die Gestaltung der Allerheiligen-Hofkirche.
- Die künstlerische Ausgestaltung des Kircheninneren, insbesondere die Fresken von Heinrich Hess.
- Die Synthese von klassizistischen und byzantinischen Stilelementen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Wirkung des Goldes: Dieses Kapitel untersucht die nachhaltige Wirkung byzantinischer und byzanz-reziperierender Kirchengebäude auf ihre Besucher, wie sie durch historische Zitate belegt wird. Es beleuchtet den historischen Kontext der Entstehung der Allerheiligen-Hofkirche im Kontext des Historismus und der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts. Die Reise Ludwig I. nach Italien und sein Besuch der Capella Palatina in Palermo wird als entscheidender Impuls für den Bau einer ähnlichen Kirche in München dargestellt. Der enorme Eindruck der Capella Palatina, insbesondere ihrer Mosaik-Ausstattungen und der Beleuchtung, wird hervorgehoben und durch Zitate von Zeitgenossen belegt, die die überwältigende Wirkung des Goldgrundes und der geschichtsträchtigen Atmosphäre betonen. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der Motivation hinter dem Bauvorhaben.
2. Leo von Klenze und die Vorbereitungen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle des Hofarchitekten Leo von Klenze und seine Vorbereitung auf den Bau der Allerheiligen-Hofkirche. Es beschreibt Klenzes Person und seinen Einfluss auf das klassizistische Stadtbild Münchens sowie das Spannungsfeld zwischen seinen eigenen Vorstellungen und den Wünschen Ludwig I. Klenzes Sizilienreise und seine detaillierten Studien byzantinischer Kirchen werden beschrieben, ebenso seine kritische Auseinandersetzung mit den "artistischen Unvollkommenheiten" mittelalterlicher Bauwerke. Seine bevorzugte Referenz, die Markuskirche in Venedig, wird als Gegenpol zur Capella Palatina vorgestellt, was auf einen Interessenskonflikt zwischen König und Architekt hindeutet. Das Kapitel verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Klenze stand, um die Vision Ludwigs I. mit seinen eigenen architektonischen Idealen zu vereinen.
3. Der Kirchenbau in München (Innenbau): Dieses Kapitel beschreibt den Bau und die Gestaltung des Innenraums der Allerheiligen-Hofkirche. Es beginnt mit der Grundsteinlegung und dem relativ kurzen Bauzeitraum. Die unterschiedliche Gestaltung von Außen- und Innenraum wird angekündigt, wobei der Fokus auf dem Innenraum liegt. Die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und der damit verbundene Verlust der Fresken von Heinrich Hess werden bedauert. Die architektonische Struktur des Innenraums, die sich durch zwei hintereinanderliegende Kuppelräume auszeichnet, wird detailliert beschrieben, wobei die räumliche Verbindung, die Lichtführung und die Anlehnung an San Marco in Venedig hervorgehoben werden. Die Kombination aus klaren Formen und der reichen Ausstattung mit Marmor, Ornamenten und Gold wird analysiert, wobei der Ausgleich zwischen strenger Architektur und opulentem Dekor betont wird. Die Entscheidung für Fresken statt Mosaiken wird erläutert, und die Gestaltung der Fresken durch Heinrich Hess, deren Stil und Themen, wird im Detail besprochen. Die bewusste Platzierung von Heiligenfiguren, insbesondere die Darstellung Ludwigs I. direkt unter Christus, wird als Ausdruck der Macht des Königs interpretiert. Die Skepsis Klenzes gegenüber dem Projekt und die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der königlichen Vision werden deutlich.
Schlüsselwörter
Allerheiligen-Hofkirche, München, Ludwig I., Leo von Klenze, Byzantinische Architektur, Historismus, Klassizismus, Capella Palatina, San Marco, Heinrich Hess, Fresken, Goldgrund, Mosaik, Kirchenbau, Architekturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen: Entstehung der Allerheiligen-Hofkirche in München
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Allerheiligen-Hofkirche in München unter König Ludwig I. Der Fokus liegt auf den Einflüssen byzantinischer Architektur, der Rolle des Architekten Leo von Klenze und den Kompromissen zwischen dessen klassizistischer Präferenz und den Wünschen des Königs nach einer byzantinisch inspirierten Kirche. Analysiert werden der Bauprozess, die Gestaltung des Innenraums und die künstlerische Ausgestaltung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wirkung byzantinischer Kirchenarchitektur auf Ludwig I., den Gestaltungsprozess und die Auseinandersetzung zwischen König und Architekt, den Einfluss italienischer Kirchenbauten (Capella Palatina, San Marco), die künstlerische Ausgestaltung des Kircheninneren (insbesondere die Fresken von Heinrich Hess) und die Synthese von klassizistischen und byzantinischen Stilelementen.
Welche Rolle spielte König Ludwig I. bei der Entstehung der Kirche?
König Ludwig I. war der maßgebliche Impulsgeber für den Bau der Allerheiligen-Hofkirche. Seine Reise nach Italien und der Besuch der Capella Palatina in Palermo beeindruckten ihn nachhaltig und führten zu dem Wunsch nach einer ähnlichen Kirche in München. Er prägte maßgeblich die Gestaltungsrichtlinien, obwohl es zu Spannungen mit dem Architekten Leo von Klenze kam.
Welche Rolle spielte Leo von Klenze beim Bau der Allerheiligen-Hofkirche?
Leo von Klenze war der Hofarchitekt und somit für die Planung und Umsetzung des Baus verantwortlich. Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen seinen klassizistischen Präferenzen und den Wünschen Ludwigs I. nach einer byzantinisch inspirierten Kirche. Klenzes Sizilienreise und seine Studien byzantinischer Kirchen werden ebenso behandelt wie seine kritische Auseinandersetzung mit mittelalterlichen Bauwerken.
Welche Einflüsse sind an der Architektur der Allerheiligen-Hofkirche erkennbar?
Die Architektur der Allerheiligen-Hofkirche zeigt deutliche Einflüsse byzantinischer Kirchenbauten, insbesondere der Capella Palatina in Palermo und der Markuskirche in Venedig. Gleichzeitig sind klassizistische Elemente erkennbar, die den Kompromiss zwischen den Wünschen Ludwigs I. und den architektonischen Vorstellungen Klenzes widerspiegeln.
Wie ist der Innenraum der Allerheiligen-Hofkirche gestaltet?
Der Innenraum zeichnet sich durch zwei hintereinanderliegende Kuppelräume aus. Die Beschreibung umfasst die räumliche Verbindung, die Lichtführung und die Anlehnung an San Marco in Venedig. Die Kombination aus klaren Formen und reicher Ausstattung mit Marmor, Ornamenten und Gold wird ebenso analysiert wie die Fresken von Heinrich Hess und deren Stil und Themen. Die bewusste Platzierung von Heiligenfiguren wird im Kontext der Macht des Königs interpretiert.
Welche Bedeutung hat die Verwendung von Gold in der Allerheiligen-Hofkirche?
Das Kapitel "Die Wirkung des Goldes" untersucht die nachhaltige Wirkung byzantinischer und byzanz-reziperierender Kirchengebäude und betont den überwältigenden Eindruck, den die Goldgrundausstattung und die Beleuchtung auf die Besucher machten. Der Goldgrund wird als zentrales Element der Wirkung und als Ausdruck der königlichen Macht interpretiert.
Welche Bedeutung haben die Fresken von Heinrich Hess?
Die Fresken von Heinrich Hess waren ein integraler Bestandteil der künstlerischen Ausgestaltung des Kircheninneren. Ihr Stil, ihre Themen und ihre bewusste Platzierung werden detailliert besprochen. Der Verlust der Fresken durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wird bedauert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Allerheiligen-Hofkirche, München, Ludwig I., Leo von Klenze, Byzantinische Architektur, Historismus, Klassizismus, Capella Palatina, San Marco, Heinrich Hess, Fresken, Goldgrund, Mosaik, Kirchenbau, Architekturgeschichte.
- Citation du texte
- Lisa Wossal (Auteur), 2014, Byzanzrezeption in der Allerheiligen-Hofkirche in München, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273697