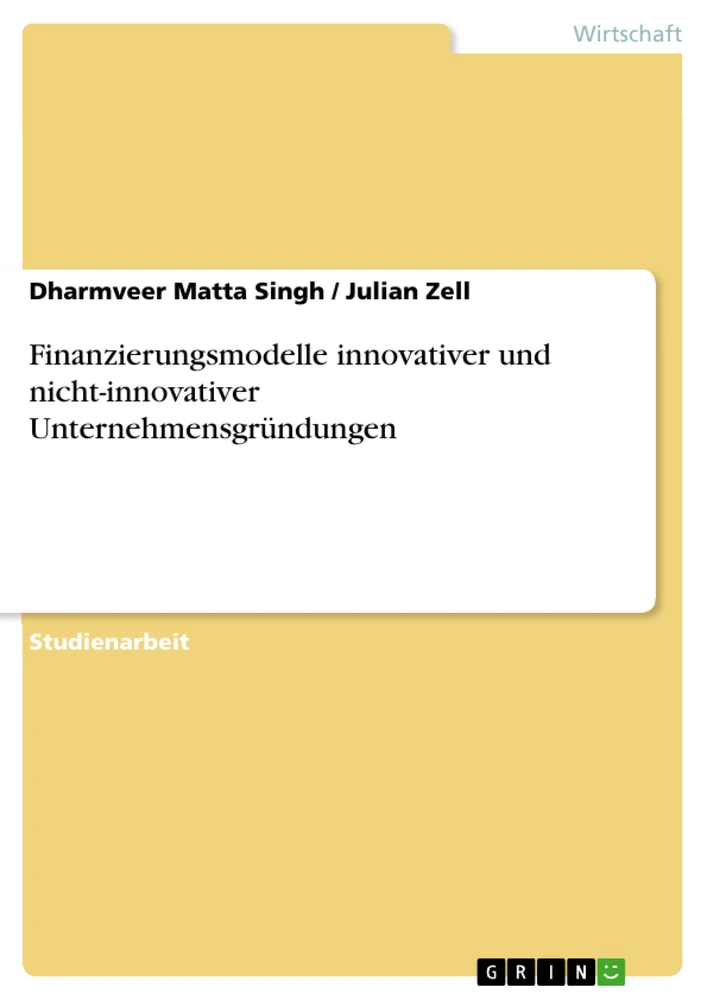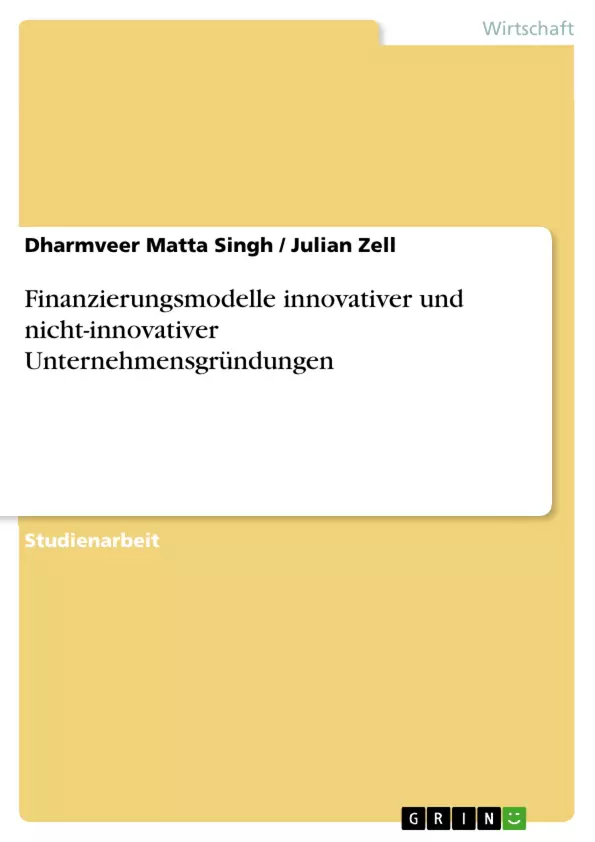Die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft hängt stark von der Leistungsfähigkeit seiner Unternehmen ab. Großunternehmen stellen immer noch den Hauptteil der Wirtschaftskraft einer Nation dar. Sie schaffen Arbeitsplätze, sorgen für Kapitalzuflüsse und prägen das Image der Nation im Ausland.
Doch jedes Großunternehmen hat einmal klein angefangen, daher ist es für eine Volkswirtschaft unerlässlich die richtigen Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen zu bilden. In Deutschland wurden im Jahr 2011 nach Angaben des Statistischen Bundesamts 144.000 Betriebe, „deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen“ gegründet.
Damit aber aus solchen Unternehmensgründungen später gehobene Mittelständler oder größere Konzerne werden, müssen die Unternehmensgründer einige Herausforderungen meistern. Neben den bürokratischen Hürden und einer tragfähigen Idee, welche wirtschaftliche Aussichten hat, stellt die Kapitalbeschaffung eine große Herausforderung dar. Für einen Unternehmensgründer existieren dabei verschiedene Möglichkeiten. Abhängig von der Geschäftsidee, der Branche und den persönlichen Präferenzen kann der Unternehmensgründer aus einer Reihe von Finanzierungsmodellen wählen.
In der vorliegenden Facharbeit werden verschiedene Finanzierungsmodelle für Unternehmensgründungen dargestellt. Dabei wird zwischen innovativen und nicht-innovativen Unternehmensgründungen unterschieden, wobei der Fokus auf Finanzierungsmodelle für innovative Unternehmensgründungen liegt.
Zunächst werden die relevanten Begriffe im Bezug auf das Thema abgegrenzt. Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Finanzierungsmodelle für innovative Unternehmensgründungen erklärt. Hierbei wird auf die Finanzierung von Business Angels, über Crowdfunding-Plattformen und Venture Capital-Gesellschaften näher eingegangen. Unterstützend wurde hierfür eine empirische Analyse zum Thema Crowdfunding und deren Investoren durchgeführt. Im letzten beiden Kapiteln wird auf Öffentliche Fördermittel und Bankkredite eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche und inhaltliche Abgrenzungen zu Unternehmensgründungen und Finanzierungsarten
- 2.1 Innovative und nicht-innovative Unternehmensgründung
- 2.1.1 Risikounterschiede bei innovativen und nicht-innovativen Unternehmensgründungen
- 2.2 Finanzierungsphasen einer Unternehmensgründung
- 2.3 Eigen-, Fremdkapital- und Mezzanine Kapitalfinanzierung
- 2.4 Außen- und Innenfinanzierung
- 3. Finanzierungsmodelle für innovative Unternehmensgründungen
- 3.1 Crowdfunding
- 3.1.1 Definition des Begriff Crowdfunding
- 3.1.2 Crowdfunding Phasen
- 3.1.3 Der IKEA Effekt bei Crowdfunding Projekten
- 3.1.4 Risiken des Crowdfundings
- 3.1.5 Vorbemerkungen zur empirischen Erhebung
- 3.1.6 Ergebnisse der empirischen Erhebung
- 3.2 Business Angels
- 3.3 Venture Capital
- 3.3.1 Definition Venture Capital
- 3.3.2 Die vier Phasen des Investmententscheidungsprozesses
- 3.1 Crowdfunding
- 4. Finanzierungsmodelle für Mischmodelle und nicht-innovative Unternehmensgründungen
- 4.1 Öffentliche Fördermittel
- 4.2 Kredit bei einem Kreditinstitut
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene Finanzierungsmodelle für innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen. Ziel ist es, die jeweiligen Modelle zu beschreiben, ihre Vor- und Nachteile zu beleuchten und die Unterschiede zwischen der Finanzierung innovativer und nicht-innovativer Unternehmen aufzuzeigen. Eine empirische Analyse des Crowdfundings im deutschen Markt ergänzt die theoretischen Ausführungen.
- Definition und Abgrenzung innovativer und nicht-innovativer Unternehmensgründungen
- Unterschiede in den Finanzierungsansätzen für innovative und nicht-innovative Unternehmen
- Detaillierte Beschreibung verschiedener Finanzierungsmodelle (Crowdfunding, Business Angels, Venture Capital, Bankkredite, öffentliche Fördermittel)
- Analyse der Vor- und Nachteile der einzelnen Finanzierungsmodelle
- Empirische Untersuchung des Crowdfundings im deutschen Markt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Finanzierungsmodelle für innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Unterschieden in der Finanzierung beider Unternehmensformen dar und skizziert den methodischen Ansatz.
2. Begriffliche und inhaltliche Abgrenzungen zu Unternehmensgründungen und Finanzierungsarten: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe. Es definiert den Innovationsbegriff im Kontext von Unternehmensgründungen und unterscheidet zwischen innovativen und nicht-innovativen Gründungen anhand von Risikoprofilen. Die verschiedenen Finanzierungsphasen einer Unternehmensgründung werden erläutert, ebenso wie die Unterscheidung zwischen Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital sowie Außen- und Innenfinanzierung. Die Kapitel untermauert seine Argumentation durch eine differenzierte Darstellung der verschiedenen Finanzierungsarten und deren jeweiliger Charakteristika.
3. Finanzierungsmodelle für innovative Unternehmensgründungen: Dieses Kapitel befasst sich mit Finanzierungsmodellen, die speziell für innovative Unternehmen relevant sind. Es analysiert detailliert Crowdfunding, inklusive einer empirischen Untersuchung des deutschen Marktes, Business Angels und Venture Capital. Für jedes Modell werden die jeweiligen Phasen, Risiken und Erfolgsfaktoren erörtert. Die empirische Analyse des Crowdfundings liefert wertvolle Einblicke in die Praxis dieses Finanzierungsmodells.
4. Finanzierungsmodelle für Mischmodelle und nicht-innovative Unternehmensgründungen: Dieses Kapitel beschreibt Finanzierungsoptionen für nicht-innovative Unternehmensgründungen und Mischformen. Im Fokus stehen öffentliche Fördermittel und Bankkredite. Es werden die spezifischen Bedingungen, Voraussetzungen und Prozesse dieser Finanzierungsarten erläutert, einschließlich der jeweiligen Vor- und Nachteile. Die Kapitel betont die Unterschiede zu den im vorherigen Kapitel beschriebenen Modellen für innovative Unternehmen.
Schlüsselwörter
Finanzierungsmodelle, Unternehmensgründungen, innovative Unternehmensgründung, nicht-innovative Unternehmensgründung, Crowdfunding, Business Angels, Venture Capital, Bankkredite, öffentliche Fördermittel, Risikokapital, Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine-Kapital, empirische Analyse, deutscher Markt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Finanzierungsmodelle für innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht verschiedene Finanzierungsmodelle für innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen. Sie beschreibt die jeweiligen Modelle, beleuchtet deren Vor- und Nachteile und zeigt die Unterschiede zwischen der Finanzierung innovativer und nicht-innovativer Unternehmen auf. Eine empirische Analyse des Crowdfundings im deutschen Markt ergänzt die theoretischen Ausführungen.
Welche Finanzierungsmodelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Finanzierungsmodelle: Crowdfunding (inkl. einer empirischen Untersuchung des deutschen Marktes), Business Angels, Venture Capital, Bankkredite und öffentliche Fördermittel.
Welche Aspekte des Crowdfundings werden untersucht?
Die Arbeit definiert Crowdfunding, beschreibt dessen Phasen und Risiken und beinhaltet eine empirische Erhebung mit den dazugehörigen Ergebnissen. Der "IKEA-Effekt" im Kontext von Crowdfunding Projekten wird ebenfalls thematisiert.
Wie werden innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen unterschieden?
Die Arbeit definiert den Innovationsbegriff im Kontext von Unternehmensgründungen und unterscheidet zwischen innovativen und nicht-innovativen Gründungen anhand von Risikoprofilen. Die verschiedenen Finanzierungsphasen werden erläutert und die Unterschiede in den Finanzierungsansätzen für beide Typen von Unternehmen werden herausgestellt.
Welche weiteren Finanzierungsphasen und -arten werden erklärt?
Neben den einzelnen Finanzierungsmodellen werden grundlegende Finanzierungsarten wie Eigenkapital, Fremdkapital und Mezzanine-Kapital sowie Außen- und Innenfinanzierung erklärt und abgegrenzt. Die verschiedenen Finanzierungsphasen einer Unternehmensgründung werden ebenfalls detailliert beschrieben.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Kapitelzusammenfassung, welche die zentralen Inhalte jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfasst. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über den gesamten Inhalt der Arbeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Finanzierungsmodelle, Unternehmensgründungen, innovative Unternehmensgründung, nicht-innovative Unternehmensgründung, Crowdfunding, Business Angels, Venture Capital, Bankkredite, öffentliche Fördermittel, Risikokapital, Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine-Kapital, empirische Analyse, deutscher Markt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung ist die Beschreibung verschiedener Finanzierungsmodelle für innovative und nicht-innovative Unternehmensgründungen, die Beleuchtung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle und die Aufdeckung der Unterschiede zwischen der Finanzierung innovativer und nicht-innovativer Unternehmen.
- Citation du texte
- Dharmveer Matta Singh (Auteur), Julian Zell (Auteur), 2012, Finanzierungsmodelle innovativer und nicht-innovativer Unternehmensgründungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273331