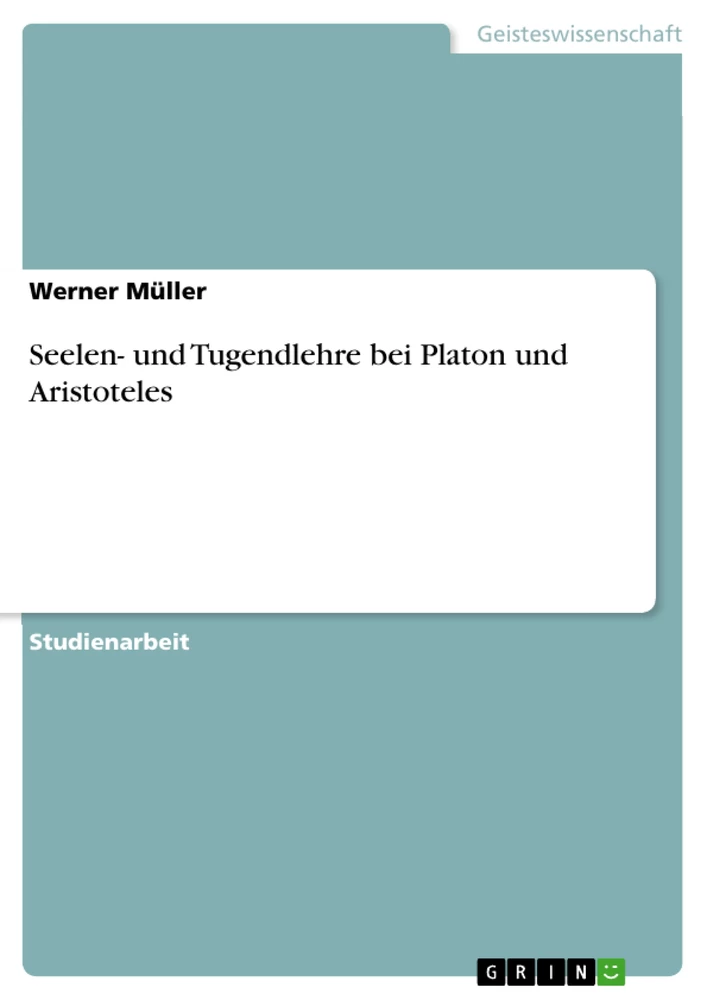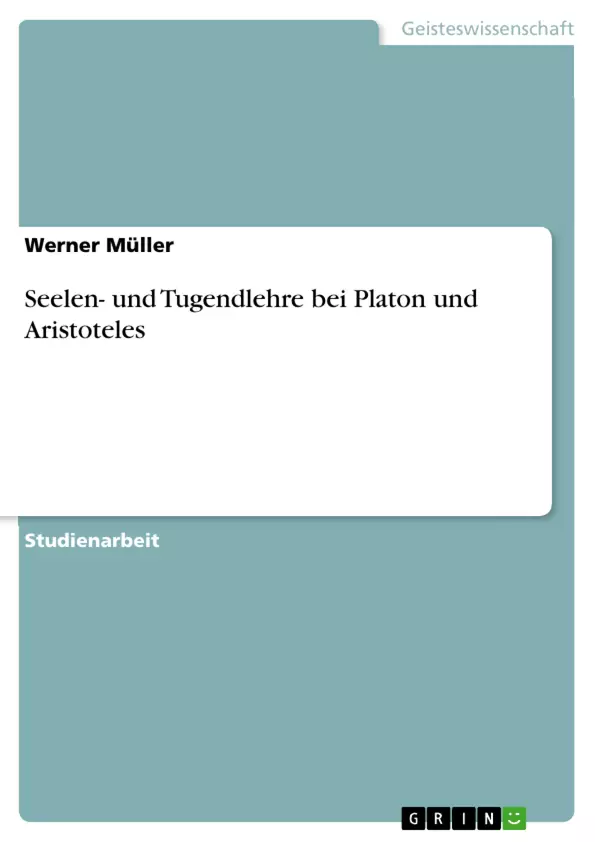Ziel der Hausarbeit ist die Erörterung der platonischen Seelen- und Tugendlehre und der Aufweis von Bezügen zur Mesotes-Lehre des Aristoteles. Dazu wird zunächst Platons These diskutiert, wonach die Seele die ihr eigentümliche Aufgabe, ein glückliches Lebens zu führen nur dann realisieren kann, wenn sie gerecht ist. In diesem Zusammenhang werden auch Überlegungen zu den zentralen Begriffen „Tugend“ und „Gerechtigkeit“ angestellt. Im Anschluss daran wird die Seelenlehre Platons, wie sie schwerpunktmäßig im 4. Buch der Politeia ausgearbeitet ist, erörtert. Es wird gezeigt, wie Platon die Tugenden und die Teile der Seele aus dem Modell eines zuvor konstruierten gerechten Staates ableitet. Die Seelenteile werden anhand des Modells der Polisentstehung (368b-372c) erläutert und es wird auf Schwierigkeiten bei der Interpretation des zweiten Seelenteils (der thymoeides) hingewiesen. Es wird vorgeschlagen, thymoeides als Aggressivität aufzufassen und dieser Vorschlag wird anhand der in 440b bis 441b angeführten Kriterien überprüft.
Im zweiten Teil wird zunächst das Verhältnis der Seelenteile untereinander erörtert. Dabei wird die Rolle der Vernunft, die Platon als praktisches Wissen dessen, wie man mit sich selbst und anderen am besten umgeht (428d) gedeutet als die Kenntnis des rechten Maßes derjenigen Handlungsdispositionen (Charaktereigenschaften), die in einer konkreten Situation entscheidungsrelevant sind. Im Weiteren wird der Begriff des rechten Maßes näher bestimmt. Platon scheint eine Art von Fließgleichgewicht im Sinne zu haben, wenn man z.B. 470a-471c zugrundelegt, wo er je nach den herrschenden Umständen (Krieg gegen Hellenen vs. Krieg gegen Barbaren) unterschiedliche Ausprägungen von Aggressivität als tugendhaft ausweist. Diese Auffassung als Fließgleichgewicht impliziert die Möglichkeit verschiedener Schwerpunkte: so kann eine Handlung auch dann tugendhaft sein, wenn einer der "niederen" Seelenteile überwiegt, sofern die konkreten Umstände es erfordern. An dieser Stelle kann ein Bezug zur Mesotes-Lehre hergestellt werden, denn Aristoteles denkt in seinem Begriff des „Mittleren“ (mesotes) die äußeren Umstände mit: das Mittlere ist kein arithmetische Wert, sondern das Beste, was man in einer konkreten Situation erreichen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Seelenlehre im vierten Buch der Politeia
- 3. Schwierigkeiten bei der Übersetzung des dritten Seelenteils
- 4. Die Doppelnatur des Menschen
- 5. Aristoteles' Lehre vom mittleren Maß
- 6. Wurzeln der mesotes-Lehre bei Platon
- 7. Das vernünftige Maß
- 8. Zusammenfassung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit vergleicht die platonische und aristotelische Sicht auf den gerechten und tugendhaften Menschen und die Rolle der Vernunft. Im Mittelpunkt steht die platonische Seelenlehre aus der Politeia, um zu untersuchen, wie Vernunft und andere Seelenteile interagieren. Die Arbeit erörtert die zentralen Begriffe der platonischen Tugendlehre, insbesondere Gerechtigkeit, und untersucht, warum ein tugendhafter Mensch ein besseres Leben führt. Schließlich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Platon und Aristoteles beleuchtet.
- Vergleich der platonischen und aristotelischen Konzepte von Gerechtigkeit und Tugend
- Analyse der platonischen Seelenlehre und des Verhältnisses von Vernunft zu anderen Seelenteilen
- Erörterung der zentralen Begriffe der platonischen Tugendlehre (Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit)
- Untersuchung der Rolle der Vernunft im guten Leben
- Beziehung zwischen Platons Konzept der doppelten Natur des Menschen und der aristotelischen Tugendlehre
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach dem guten Leben und dessen Verbindung zu innerer Begrenzung im Gegensatz zur äußeren Vermehrung dar. Sie verortet diesen Gedanken im antiken Denken, speziell bei Platon und Aristoteles, die ein eudämonisches Leben als oberstes Ziel sahen. Die Arbeit fokussiert den Vergleich der platonischen und aristotelischen Positionen bezüglich des gerechten und tugendhaften Menschen und der Rolle der Vernunft in der Erreichung von Eudämonie. Es wird auf die Problematik des Verhältnisses der Vernunft zu den übrigen Seelenteilen hingewiesen, da der Mensch kein reines Vernunftwesen ist. Die Arbeit konzentriert sich auf Platons Seelenlehre in der Politeia und untersucht die zentralen Begriffe der platonischen Tugendlehre, insbesondere Gerechtigkeit, um zu erklären, warum ein tugendhafter Mensch ein besseres Leben führt als ein nicht tugendhafter. Schließlich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Platon und Aristoteles hervorgehoben, mit der zentralen These, dass Platons Konzept der doppelten Natur des Menschen die Grundlage der aristotelischen Tugendlehre bildet.
2. Die Seelenlehre im vierten Buch der Politeia: Dieses Kapitel erläutert Platons Darstellung grundlegender Begriffe seiner praktischen Philosophie – Gerechtigkeit, Tugend und Eudämonie – zunächst am Modell des idealen Staates und überträgt diese dann auf die Individualseele. Platons Sicht der seelischen Verfassung des Menschen als konfliktreich wird hervorgehoben, wobei das Streben der „niederen“ Seelenteile nach Erweiterung als Ursache identifiziert wird. Der ideale Staat dient als Analogie für die Einzelseele. Die Tugenden Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit werden den Ständen (Philosophenherrscher, Wächter, Produzenten) zugeordnet. Die Gerechtigkeit wird als das Nützliche für die Gemeinschaft definiert, welches durch die Erfüllung der individuellen Aufgabe gemäß der Idiopragieformel erreicht wird. Die Analyse der Tugenden im Staat legt den Grundstein für das Verständnis der Seelenstruktur.
Schlüsselwörter
Platon, Aristoteles, Seelenlehre, Tugendlehre, Gerechtigkeit, Eudämonie, Vernunft, Begehren, mesotes-Lehre, doppelte Natur des Menschen, Politeia, Idiopragieformel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Platon und Aristoteles - Gerechtigkeit, Tugend und die Rolle der Vernunft
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit vergleicht die platonische und aristotelische Sicht auf den gerechten und tugendhaften Menschen und die Rolle der Vernunft. Der Fokus liegt auf Platons Seelenlehre in der Politeia und untersucht, wie Vernunft und andere Seelenteile interagieren, um ein gutes Leben (Eudämonie) zu erreichen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Philosophen werden beleuchtet.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Begriffe der platonischen und aristotelischen Ethik, darunter Gerechtigkeit, Tugend (Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit), Eudämonie und die Bedeutung der Vernunft. Sie analysiert Platons Seelenlehre (Triebseele, Begehrungsseele, Vernunftseele) und deren Verhältnis zueinander. Ein weiterer Schwerpunkt ist die „mesotes-Lehre“ (Lehre vom goldenen Mittelweg) bei Aristoteles und deren mögliche Wurzeln bei Platon. Die „doppelte Natur des Menschen“ wird ebenfalls diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Seelenlehre im vierten Buch der Politeia, Schwierigkeiten bei der Übersetzung des dritten Seelenteils, Die Doppelnatur des Menschen, Aristoteles' Lehre vom mittleren Maß, Wurzeln der mesotes-Lehre bei Platon, Das vernünftige Maß und Zusammenfassung und Diskussion. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Die folgenden Kapitel behandeln die einzelnen Aspekte der platonischen und aristotelischen Philosophie im Detail. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die gewonnenen Erkenntnisse.
Wie wird Platons Seelenlehre in der Hausarbeit behandelt?
Platons Seelenlehre, insbesondere wie sie im vierten Buch der Politeia dargestellt wird, bildet einen zentralen Bestandteil der Hausarbeit. Die Arbeit analysiert das Verhältnis der drei Seelenteile (Vernunft, Begehrung, Wille/Mut) zueinander und deren Rolle für die Gerechtigkeit im Individuum und im Staat. Die Analogie zwischen dem idealen Staat und der individuellen Seele wird erläutert.
Welche Rolle spielt die Vernunft in der Hausarbeit?
Die Rolle der Vernunft in der Erreichung eines guten Lebens (Eudämonie) ist ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird untersucht, wie die Vernunft die anderen Seelenteile (Begehren und Wille) steuert und wie sie zur Gerechtigkeit und Tugend beiträgt. Der Vergleich mit Aristoteles' Sicht auf die Vernunft wird ebenfalls gezogen.
Wie werden Platon und Aristoteles in der Hausarbeit verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht die Konzepte von Gerechtigkeit und Tugend bei Platon und Aristoteles. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren ethischen Ansätzen herausgearbeitet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Beziehung zwischen Platons Konzept der doppelten Natur des Menschen und der aristotelischen Tugendlehre.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Platon, Aristoteles, Seelenlehre, Tugendlehre, Gerechtigkeit, Eudämonie, Vernunft, Begehren, mesotes-Lehre, doppelte Natur des Menschen, Politeia, Idiopragieformel.
Wofür ist diese Zusammenfassung gedacht?
Diese Zusammenfassung dient als umfassende Übersicht über den Inhalt der Hausarbeit und soll ein schnelles und einfaches Verständnis der zentralen Themen und Argumentationen ermöglichen.
- Quote paper
- Werner Müller (Author), 2012, Seelen- und Tugendlehre bei Platon und Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271746