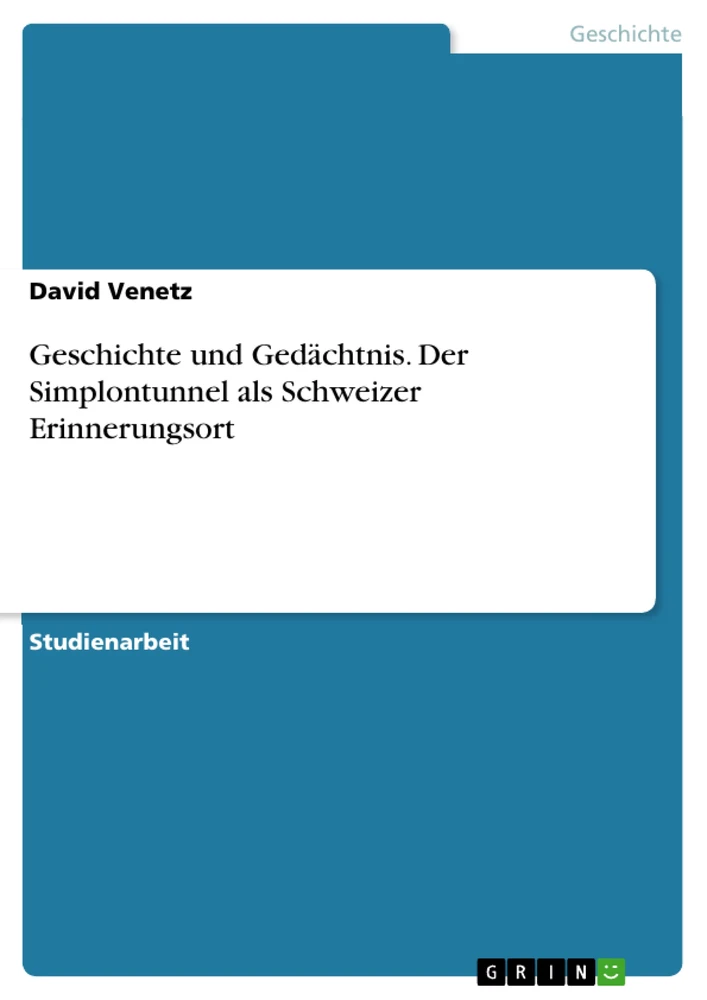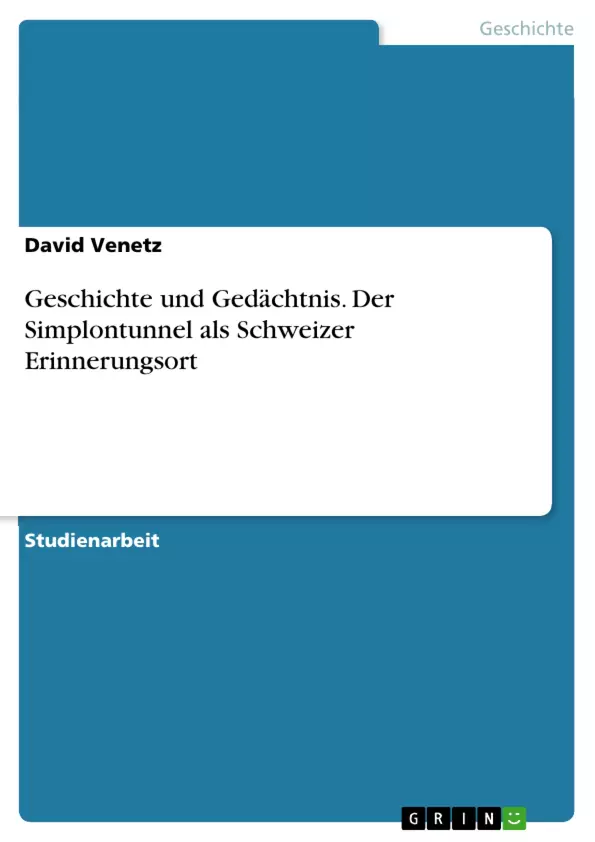Die vorliegende Arbeit befasst sich auf einer ersten, grundlegenden Ebene mit den Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis. Insbesondere die Funktionsprinzipien von überindividueller Erinnerung, von gemeinschaftlichem Gedächtnis sollen dabei genauer beleuchtet werden. Darüber hinaus wird auch versucht, die möglichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen dem Erinnerungsgut eines sozialen Kollektives und dessen Selbstverständnis, dessen Identität zu skizzieren.
Dabei steht das Verhältnis der einzelnen Menschen, aber insbesondere einer Gemeinschaft zu ihrer Vergangenheit im Zentrum. Die Fragen, wie gemeinschaftliche Erinnerung, eine gemeinsame Geschichte entstehen, wie sie sich auch entwickeln, und inwiefern sie sich auf Individuen oder auch Kollektive letztlich auch auswirken kann, werden in einem ersten Teil auf einer theoretischen Ebene behandelt, und vor den Hintergrund der Erkenntnisse aus der Gedächtnis- oder Erinnerungsforschung gestellt.
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Seminars über das kollektive Gedächtnis der Schweiz und bestimmte Orte dieser Erinnerung, also Träger und Symbole der gemeinschaftlichen, nationalen Geschichte und Identität. Diese konzeptionelle Ausgangslage wird nachfolgend noch eingehender erläutert werden, und stellt am Ende der theoretischen Grundlagen die thematische Überleitung hin zu einem konkreten Fallbeispiel dar.
An diesem Fallbeispiel sollen anschliessend in einem zweiten Teil die zuvor theoretisch umrissenen Prinzipien und Funktionen sozialer Gedächtnis- und Erinnerungskultur nachgezeichnet werden. Exemplarisch für einen Schweizer Erinnerungsort wird dabei die Geschichte und die Wahrnehmung des Simplontunnels genauer betrachtet werden. Der Fokus wird auch auf der Wahrnehmungsgeschichte liegen, wobei diese schwerlich vollständig gesondert vom eigentlichen Objekt an sich betrachtet werden kann. Deshalb werden alle, während der historischen Betrachtung des Simplontunnels angesprochenen Elemente, die in Bezug auf die Wahrnehmung des Bauwerkes stehen, gegen Ende dieser Arbeit in einer kurzen Perzeptionsgeschichte noch einmal zusammengefasst und in einen Zusammenhang gestellt. Nach dieser umfassenden Betrachtung werden die Auswirkungen des Simplontunnels auf die Fundierung einer gemeinschaftlichen, nationalen Geschichte und Identität geklärt sein. Dadurch sollte schliesslich auch die Frage, ob der Simplontunnel als Schweizer Erinnerungsort gelten kann, abschliessend beantwortet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erinnerung und Gedächtnis: Theoretisches Konzept
- 2.1. Das kollektive Gedächtnis
- 2.2. Kommunikatives und Kulturelles Gedächtnis
- 2.3. Gedächtnis und Identität
- 2.4. Pierre Nora und „Les lieux de mémoire“
- 2.5. Definitorische Umrisse
- 3. Der Simplontunnel: Historische Betrachtung
- 3.1. Das moderne Gedächtnis der Schweiz
- 3.2. Geostrategische Bedeutung des Simplontunnels
- 3.3. Früher Transit
- 3.4. Neuzeitlicher Transit
- 3.5. Die Moderne hält Einzug
- 3.6. Die Eisenbahn
- 3.7. Die Idee eines Tunnels
- 3.8. Der Tunnelbau
- 3.9. Nach der Eröffnung
- 4. Der Simplontunnel: Perzeptionsgeschichte
- 4.1. Projektphase
- 4.2. Bauphase
- 4.3. Betriebsphase
- 5. Analyse und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis, insbesondere überindividueller Erinnerung und gemeinschaftliches Gedächtnis. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen dem kollektiven Erinnerungsbesitz einer Gesellschaft und ihrer Identität. Die Arbeit analysiert, wie gemeinschaftliche Erinnerung entsteht, sich entwickelt und auf Individuen und Kollektive wirkt. Dies geschieht zunächst auf theoretischer Ebene, basierend auf Erkenntnissen der Gedächtnisforschung. Im zweiten Teil wird anhand des Simplontunnels als Fallbeispiel gezeigt, wie diese theoretischen Prinzipien in der Praxis funktionieren.
- Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis
- Kollektives Gedächtnis und Identität
- Der Simplontunnel als Schweizer Erinnerungsort
- Wahrnehmungsgeschichte des Simplontunnels
- Der Einfluss des Simplontunnels auf die nationale Identität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung. Sie skizziert den Fokus auf die Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis, insbesondere im kollektiven Kontext, und die Bedeutung des Verhältnisses einer Gemeinschaft zu ihrer Vergangenheit. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung gemeinschaftlicher Erinnerung und deren Auswirkungen. Sie kündigt die theoretische Auseinandersetzung mit Gedächtnisforschung an und die anschließende Fallstudie am Beispiel des Simplontunnels an, welcher als potentieller Schweizer Erinnerungsort untersucht werden soll. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende Analyse.
2. Erinnerung und Gedächtnis: Theoretisches Konzept: Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des kollektiven Gedächtnisses. Es erläutert die Konzepte von Maurice Halbwachs, der den Begriff des kollektiven Gedächtnisses prägte, und betont die soziale Dimension von Erinnerung und Gedächtnisbildung. Das Kapitel skizziert die Rolle der Gesellschaft bei der Definition und Fixierung von Erinnerungsrahmen und die Bedeutung der Kommunikation von Erinnerungen für die Konstitution des kollektiven Gedächtnisses. Es werden ferner die Beiträge von Pierre Nora und den Assmanns erwähnt, deren Theorien zur Untersuchung der Thematik herangezogen werden.
3. Der Simplontunnel: Historische Betrachtung: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Simplontunnels im Kontext des modernen Gedächtnisses der Schweiz. Es analysiert die geostrategische Bedeutung des Tunnels, die verschiedenen Phasen des Transits (früher und neuzeitlicher) und die Rolle der Eisenbahn und der Idee eines Tunnels selbst. Das Kapitel beschreibt den Tunnelbau und die Zeit nach der Eröffnung, wobei die verschiedenen Perspektiven und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Bauwerks berücksichtigt werden. Die Darstellung ist umfassend und setzt den Simplontunnel in einen größeren historischen Kontext ein.
4. Der Simplontunnel: Perzeptionsgeschichte: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Wahrnehmungsgeschichte des Simplontunnels, unterteilt in Projekt-, Bau- und Betriebsphase. Es analysiert, wie der Tunnel in den verschiedenen Phasen wahrgenommen wurde und welche Bedeutung er für die Gesellschaft hatte. Diese Analyse verknüpft die subjektiven Wahrnehmungen mit dem objektiven Verlauf der historischen Entwicklung des Tunnels. Es wird explizit darauf eingegangen, dass Wahrnehmung und Objekt schwerlich getrennt betrachtet werden können, was die Komplexität des Forschungsgegenstandes unterstreicht.
Schlüsselwörter
Kollektives Gedächtnis, Erinnerung, Identität, Simplontunnel, Schweizer Geschichte, Wahrnehmungsgeschichte, Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Erinnerungsorte, Geostrategie, Transit, Moderne.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Simplontunnel - Ein Erinnerungsort der Schweiz?"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis, insbesondere im kollektiven Kontext, am Beispiel des Simplontunnels. Sie analysiert, wie gemeinschaftliche Erinnerung entsteht, sich entwickelt und auf Individuen und Kollektive wirkt, und beleuchtet den Zusammenhang zwischen kollektivem Erinnerungsbesitz und Identität.
Welche theoretischen Konzepte werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien des kollektiven Gedächtnisses, insbesondere von Maurice Halbwachs und Pierre Nora. Es werden Konzepte wie kommunikatives und kulturelles Gedächtnis, sowie die Bedeutung von Erinnerungsorten ("Lieux de mémoire") behandelt.
Was ist die Bedeutung des Simplontunnels in dieser Arbeit?
Der Simplontunnel dient als Fallbeispiel. Die Arbeit analysiert seine historische Entwicklung, seine geostrategische Bedeutung und seine Wahrnehmungsgeschichte in verschiedenen Phasen (Projekt-, Bau- und Betriebsphase), um die theoretischen Konzepte des kollektiven Gedächtnisses zu veranschaulichen und dessen Einfluss auf die nationale Identität der Schweiz zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Erinnerung und Gedächtnis (theoretisches Konzept), Der Simplontunnel: Historische Betrachtung, Der Simplontunnel: Perzeptionsgeschichte, und Analyse und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Thematik.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Zentrale Fragen sind: Wie entsteht und entwickelt sich kollektive Erinnerung? Welchen Einfluss hat der Simplontunnel auf das kollektive Gedächtnis der Schweiz? Wie spiegelt sich die Geschichte des Tunnels in seiner Wahrnehmung wider? Wie beeinflusst der Simplontunnel die nationale Identität?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kollektives Gedächtnis, Erinnerung, Identität, Simplontunnel, Schweizer Geschichte, Wahrnehmungsgeschichte, Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Erinnerungsorte, Geostrategie, Transit, Moderne.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Mechanismen von Erinnerung und Gedächtnis zu untersuchen und deren Auswirkungen auf die Identität einer Gesellschaft aufzuzeigen. Der Simplontunnel dient dabei als exemplarischer Fall, um die theoretischen Konzepte zu illustrieren und zu veranschaulichen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für die Themen kollektives Gedächtnis, Geschichtswissenschaft und die Geschichte der Schweiz interessiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Zielsetzung erläutert. Es folgt ein Kapitel mit der theoretischen Grundlage, bevor der Simplontunnel als Fallbeispiel in zwei Kapiteln (historische und perzeptionelle Betrachtung) analysiert wird. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Schlussfolgerung.
- Quote paper
- Master of Arts David Venetz (Author), 2008, Geschichte und Gedächtnis. Der Simplontunnel als Schweizer Erinnerungsort, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271475