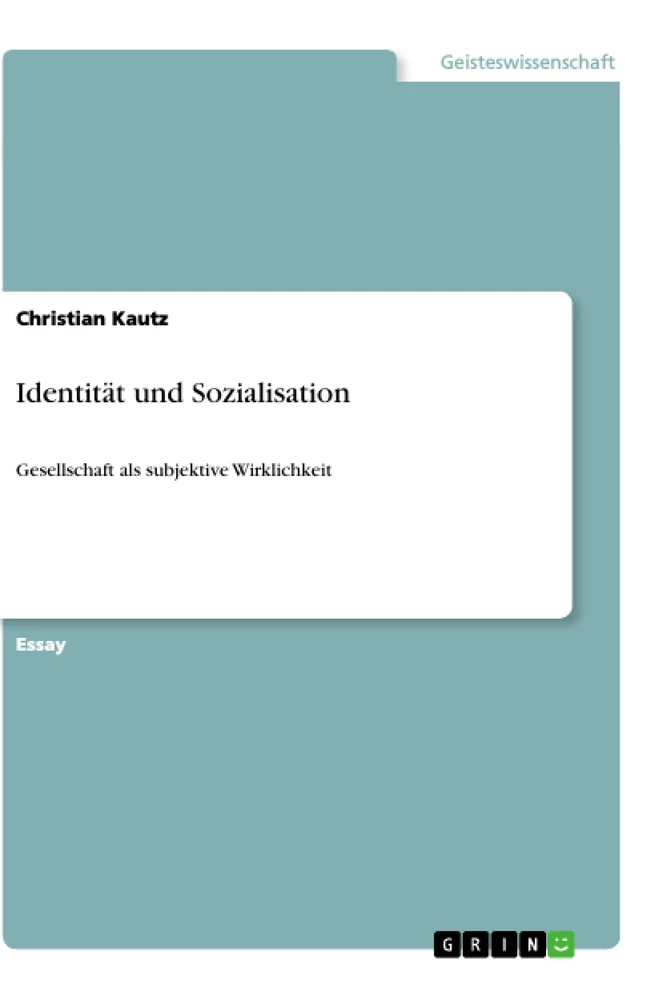Die Soziologie als genereller Begriff befasst sich in ihren diversen Aufgabenbereichen sowohl mit der Gesellschaftsbildung und ihrer Analyse als auch mit der Einbindung des Individuums in die Gesellschaft. Des Weiteren existiert eine große Anzahl an Teilgebieten wie beispielsweise die Sozialpsychologie, welche die Auswirkungen der von anderen Menschen konstruierten Realität auf das Erleben und Verhalten des Individuums erforscht (Smith/Mackie 1999: S. 14ff.), oder auch die Politische Soziologie, welche die Wechselwirkungen zwischen Politik und Gesellschaft untersucht. Ein weiterer Teilbereich ist die Wissenssoziologie, welche sich mit der Entstehung und Verbreitung sowie der Bewahrung von Wissen und Erkenntnis innerhalb von Gruppen und Gesellschaften beschäftigt. Sie geht davon aus, dass jedes Wissen und jede Erkenntnis sozial konstruiert ist und nur in diesem Kontext erschlossen werden kann (Maasen 2009: S. 34). Viele Soziologen und Theoretiker publizierten Arbeiten zu diesem Thema, wobei sich im Laufe der Zeit eine Abkehr von der „klassischen“ Wissenssoziologie Karl Mannheims oder auch Max Schelers bemerken ließ. (Maasen 2009: S. 9f.) Ihr Gegenstand galt der Untersuchung des Geistes, also dem menschlichen Sein und Bewusstsein, sowie unterschiedlicher Weltanschauungen in Bezug auf die Gesellschaftsbildung (Maasen 2009: S. 18). Vorreiter des „neuen“ Verständnisses der Wissenssoziologie sind dagegen Peter L. Berger und Thomas Luckmann, die in ihrem Werk „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie“ von 1969 fordern, die Wissenssoziologie von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Sie kritisieren die Engstirnigkeit ihrer Vorläufer bezüglich des eingeengten Untersuchungsgegenstandes. Ihrer Meinung nach solle der Blick viel mehr auf alltägliches Wissen als auf theoretisches Wissen gerichtet werden, da Alltagswissen den wichtigeren Teil der gesellschaftlichen Konstruktion der Realität ausmache als Theorien und Weltanschauungen (Berger/Luckmann 1969: S. 16). Gesellschaft an sich ist nach Berger und Luckmann als Produkt des dialektischen Prozesses zwischen Externalisierung, Objektivation und Internalisierung zu verstehen (Maasen 2009: S. 43). Eine zentrale These ihrer Arbeit lautet dabei wie folgt:
„Identität ist also objektiv als Ort in einer bestimmten Welt gegeben, kann aber subjektiv nur zusammen mit dieser Welt erworben werden.“ (Berger/Luckmann 1969: 142f.)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identität und Sozialisation - Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit
- Sozialisation: Definitionen und Perspektiven
- Objektive und subjektive Wirklichkeit
- Identität als Prozess der Internalisierung
- Primäre und sekundäre Sozialisation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Prozesse der Sozialisation und der daraus resultierenden Identitätsbildung. Er beleuchtet die Konzepte der objektiven und subjektiven Wirklichkeit nach Berger und Luckmann und integriert dabei die Perspektiven von Mead und Abels. Das Ziel ist es, die Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft im Kontext von Identitätsentwicklung zu erklären.
- Sozialisationsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Identitätsbildung
- Die Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit
- Die Rolle sozialer Interaktion und Internalisierung
- Das Konzept der signifikanten Anderen in der primären Sozialisation
- Die Bedeutung von Rollen und Normen in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Soziologie und ihrer Teilgebiete ein, mit besonderem Fokus auf die Wissenssoziologie und die Abkehr von der "klassischen" Wissenssoziologie hin zu einem alltagswissenorientierten Ansatz. Sie stellt die zentrale These von Berger und Luckmann vor, wonach Identität objektiv und subjektiv im Zusammenhang mit der Welt erworben wird, und kündigt die Auseinandersetzung mit den Begriffen Identität und Sozialisation an, unter Einbezug der Werke von Mead und Abels. Die Grenzen des Essays bezüglich der Detailtiefe werden definiert, wobei der Fokus auf der Erläuterung von Sozialisationsprozessen und Identitätsbildung liegt.
Identität und Sozialisation - Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Verständnis von Sozialisation. Es präsentiert verschiedene Definitionen aus der Psychologie und Soziologie, wobei der lebenslange Prozess der Aneignung von Verhaltensmustern, Werten und Normen hervorgehoben wird. Berger und Luckmanns Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit steht im Mittelpunkt. Die objektive Wirklichkeit wird als Produkt habitualisierten Handelns und Institutionalisierung beschrieben, während die subjektive Wirklichkeit durch Internalisierung entsteht. Die Rolle des Individuums in der Gesellschaft, die Bedeutung von sozialen Rollen und die Legitimation der objektiven Wirklichkeit, beispielsweise durch symbolische Sinnwelten, werden erläutert. Identität wird als prozessuales Produkt von Interaktionen und als untrennbar mit Gesellschaft und Wirklichkeit verbunden dargestellt. Der Prozess der Internalisierung, die Bedeutung der signifikanten Anderen und die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Sozialisation werden detailliert behandelt. Die Rolle der Interaktion und wechselseitigen Beeinflussung von Wahrnehmung und Identität wird betont. Die primäre Sozialisation und die Rolle der signifikanten Anderen bei der Vermittlung von Werten und Normen wird im Detail erklärt, mit Beispielen, wie die Mutter-Kind-Beziehung. Das Kind internalisiert Normen durch Beobachtung, Vergleich und Anpassung an das Verhalten der signifikanten Anderen.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Identität, Objektive Wirklichkeit, Subjektive Wirklichkeit, Internalisierung, Externalisierung, Objektivation, Soziale Rollen, Signifikante Andere, Primäre Sozialisation, Sekundäre Sozialisation, Berger und Luckmann, George Herbert Mead, Heinz Abels, Wissenssoziologie, Alltagwissen.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Identität und Sozialisation
Was ist der Gegenstand des Essays?
Der Essay untersucht die Prozesse der Sozialisation und der daraus resultierenden Identitätsbildung. Im Mittelpunkt steht die Interaktion zwischen Individuum und Gesellschaft im Kontext der Identitätsentwicklung, unter Berücksichtigung der Konzepte der objektiven und subjektiven Wirklichkeit nach Berger und Luckmann sowie der Perspektiven von Mead und Abels.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die Sozialisationsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Identitätsbildung, die Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit, die Rolle sozialer Interaktion und Internalisierung, das Konzept der signifikanten Anderen in der primären Sozialisation und die Bedeutung von Rollen und Normen in der Gesellschaft. Er beleuchtet die Wissenssoziologie und den alltagswissenorientierten Ansatz.
Welche Autoren werden im Essay zitiert?
Der Essay bezieht sich auf die Werke von Berger und Luckmann, George Herbert Mead und Heinz Abels. Die Theorien dieser Autoren bilden die Grundlage für die Analyse der Sozialisationsprozesse und der Identitätsbildung.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Identität und Sozialisation - Gesellschaft als subjektive Wirklichkeit") und Abschnitte zu Zielsetzung/Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Ansatz des Essays. Das Hauptkapitel behandelt detailliert die Konzepte der Sozialisation und Identitätsbildung.
Was wird unter "objektiver" und "subjektiver" Wirklichkeit verstanden?
Der Essay erläutert die Unterscheidung zwischen objektiver und subjektiver Wirklichkeit nach Berger und Luckmann. Die objektive Wirklichkeit wird als Produkt habitualisierten Handelns und Institutionalisierung beschrieben, während die subjektive Wirklichkeit durch Internalisierung entsteht. Der Essay beleuchtet, wie diese beiden Wirklichkeiten zusammenhängen und die Identität beeinflussen.
Welche Rolle spielt die Internalisierung?
Die Internalisierung spielt eine zentrale Rolle im Essay. Sie beschreibt den Prozess, durch den Individuen die objektive Wirklichkeit in ihre subjektive Wirklichkeit integrieren und so ihre Identität entwickeln. Der Essay betont die Bedeutung der Internalisierung von Normen und Werten, insbesondere in der primären Sozialisation.
Welche Bedeutung haben die "signifikanten Anderen"?
Die "signifikanten Anderen", vor allem in der primären Sozialisation, spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Werten und Normen. Der Essay erläutert, wie Kinder durch Beobachtung und Interaktion mit diesen Personen ihre Identität entwickeln. Die Mutter-Kind-Beziehung wird als Beispiel angeführt.
Was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Sozialisation?
Der Essay unterscheidet zwischen primärer und sekundärer Sozialisation. Die primäre Sozialisation findet in der frühen Kindheit statt und umfasst die Internalisierung grundlegender Normen und Werte. Die sekundäre Sozialisation umfasst die spätere Aneignung von Rollen und Normen in spezifischen sozialen Kontexten.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Essay verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Sozialisation, Identität, objektive Wirklichkeit, subjektive Wirklichkeit, Internalisierung, Externalisierung, Objektivation, soziale Rollen, signifikante Andere, primäre Sozialisation, sekundäre Sozialisation, Berger und Luckmann, George Herbert Mead, Heinz Abels, Wissenssoziologie und Alltagwissen.
- Arbeit zitieren
- Christian Kautz (Autor:in), 2012, Identität und Sozialisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271261