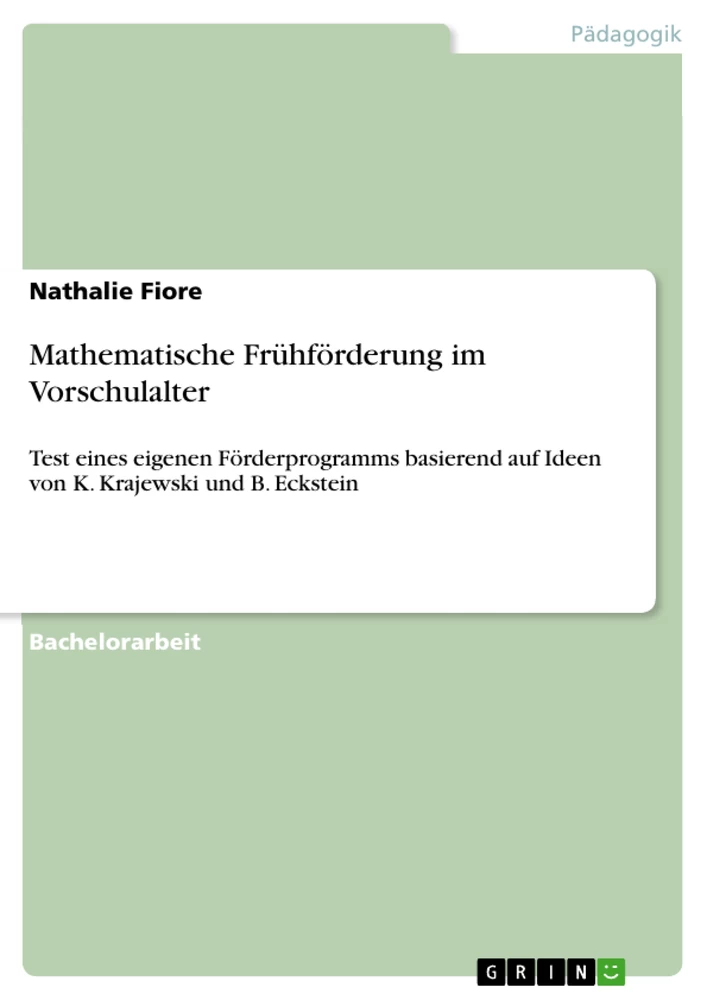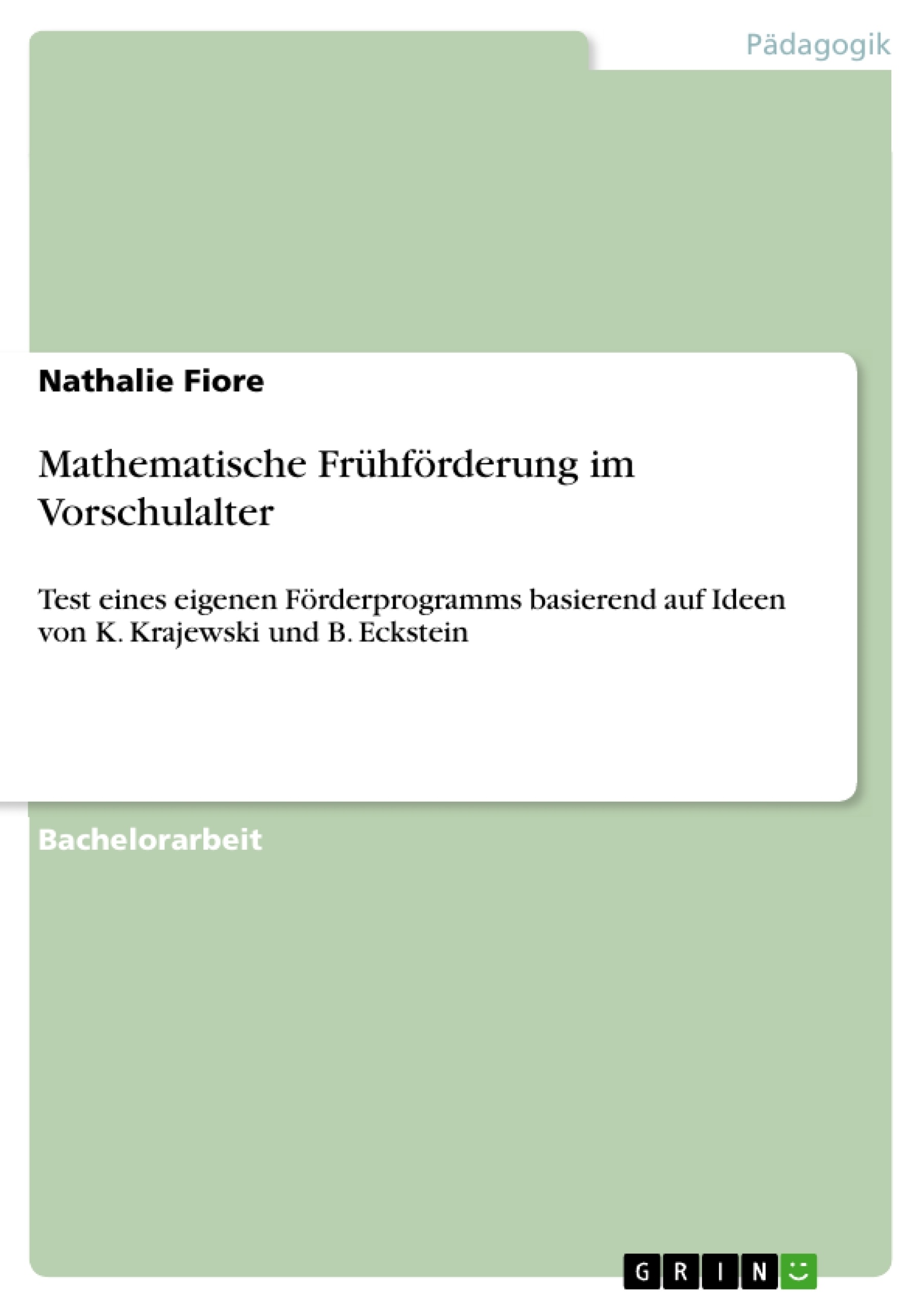Rechnen gilt neben Lesen und Schreiben als grundsätzliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
Schullaufbahn. Dazu schrieben Lorenz und Radatz schon im Jahre 1993 im „Handbuch
des Förderns im Mathematikunterricht“, dass 6 Prozent aller Schülerinnen und Schüler
der Grundschule extrem rechenschwach sind und 15 Prozent eine mindestens förderungsbedürftige
Rechenschwäche aufweisen (vgl. Lorenz/Radatz 1993, S. 15). Dabei sollte
sich die Frage gestellt werden, was getan werden kann, um diesem Prozentsatz entgegenzuwirken.
Um ein grundlegendes Verständnis für Rechenoperationen entwickeln zu können,
müssen bereits im Vorschulalter mathematische Kompetenzen entfaltet werden.
Genau mit diesem Thema werde ich mich in dieser Arbeit auseinandersetzen. Im ersten
Teil werde ich drei verschiedene Modelle vorstellen, die von der Entwicklung von mathematischen
Kompetenzen im Vorschulalter handeln. Hierbei orientiere ich mich an dem
„Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen“ von Prof. Dr. Kristin
Krajewski, an dem „fünfstufigen Entwicklungsmodell“ von Annemarie Fritz und Gabi Ricken
und ebenso an dem Modell der „Entwicklung von Zählfertigkeiten durch Fingerbilder“
von Berthold Eckstein. Des Weiteren werde ich kurz auf Entwicklungsstörungen im
Vorschulbereich eingehen, indem ich Ursachen benennen und den Begriff der Rechenschwäche,
auch bekannt als „Dyskalkulie“, definieren werde.
Im zweiten Teil werde ich näher auf die Frühförderung und ihre Umsetzung in der Praxis
eingehen. Dazu stelle ich zuerst zwei Förderprogramme „Mengen, zählen, Zahlen“ von
K. Krajewski sowie „Mit 10 Fingern zum Zahlenverständnis“ von B. Eckstein vor. Im Anschluss
daran komme ich zum Hauptteil dieser Arbeit, der aus einem eigenen Förderprojekt,
entwickelt auf Grundlage von den beiden oben genannten Programmen, besteht. Zu Beginn
werde ich in Form eines Vorwortes die Entstehung, Entwicklung, Bedingungen und wichtige
Aspekte zur Durchführung des Förderprojektes erklären. Darüber hinaus wird eine
kurze Beschreibung der beiden Kinder folgen, mit denen das Förderprojekt durchgeführt
wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklung von mathematischen Kompetenzen im Vorschulalter
- 2.1. Fünfstufiges Entwicklungsmodell nach A. Fritz / G. Ricken
- 2.2. Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen nach K. Krajewski
- 2.3. Entwicklung von Zählfertigkeiten durch Fingerbilder
- 3. Entwicklungsstörungen im Vorschulbereich
- 3.1. Definition von Dyskalkulie
- 3.2. Ursachen
- 4. Frühförderung
- 4.1. Existierende Förderprogramme
- 4.1.1. „Mengen, zählen, Zahlen“ von K. Krajewski
- 4.1.2. „Mit 10 Fingern zum Zahlverständnis“ von B. Eckstein
- 4.2. Entwicklung eines eigenen Förderprogramms basierend auf Ideen von K. Krajewski und B. Eckstein
- 4.2.1. Vorwort
- 4.2.2. Beschreibung der Kinder
- 4.3. Durchführung des eigenen Förderprogramms
- 4.3.1. Zahlen als Anzahlen
- 4.3.2. Anzahlordnung
- 4.3.3. Teil-Ganzes-Beziehungen und Anzahlunterschiede
- 4.4. Ergebnis
- 4.1. Existierende Förderprogramme
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mathematische Frühförderung im Vorschulalter und evaluiert ein selbst entwickeltes Förderprogramm, das auf den Konzepten von Krajewski und Eckstein basiert. Ziel ist es, die Wirksamkeit des Programms anhand praktischer Anwendung zu überprüfen und die Relevanz verschiedener theoretischer Modelle zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter zu beleuchten.
- Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter
- Analyse bestehender Förderprogramme (Krajewski, Eckstein)
- Entwicklung und Durchführung eines eigenen Förderprogramms
- Evaluation der Wirksamkeit des eigenen Förderprogramms
- Bedeutung der Frühförderung zur Prävention von Dyskalkulie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der mathematischen Frühförderung ein und hebt die Bedeutung frühkindlicher mathematischer Kompetenzen für den späteren Schulerfolg hervor. Sie verweist auf die hohe Prävalenz von Rechenschwäche und begründet die Notwendigkeit von Interventionen im Vorschulalter. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Forschungsmethodik, welche die Vorstellung verschiedener Entwicklungsmodelle mathematischer Kompetenzen, die Definition von Dyskalkulie, die Präsentation bestehender Förderprogramme sowie die detaillierte Beschreibung und Auswertung eines eigens entwickelten Förderprogramms beinhaltet.
2. Entwicklung von mathematischen Kompetenzen im Vorschulalter: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Modelle zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter. Es stellt das fünfstufige Entwicklungsmodell von Fritz und Ricken, das Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen von Krajewski und das Modell zur Entwicklung von Zählfertigkeiten durch Fingerbilder von Eckstein vor. Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung und Entwicklung mathematischer Fähigkeiten und bilden die theoretische Grundlage für die spätere Entwicklung und Evaluation des eigenen Förderprogramms.
3. Entwicklungsstörungen im Vorschulbereich: Dieses Kapitel befasst sich mit Entwicklungsstörungen im Vorschulbereich, mit Fokus auf Dyskalkulie. Es definiert den Begriff der Dyskalkulie und diskutiert mögliche Ursachen. Die Informationen in diesem Kapitel betonen die Bedeutung von frühzeitiger Förderung zur Prävention und Intervention bei Rechenschwäche und schaffen einen Kontext für die Bedeutung des eigenen Förderprogramms.
4. Frühförderung: Dieses Kapitel präsentiert zunächst zwei existierende Förderprogramme, „Mengen, zählen, Zahlen“ von Krajewski und „Mit 10 Fingern zum Zahlenverständnis“ von Eckstein. Es beschreibt im Anschluss die Entwicklung und Durchführung eines eigenen Förderprogramms, das auf den Ideen dieser beiden Programme aufbaut. Es enthält ein Vorwort zum eigenen Förderprogramm, die Beschreibung der teilnehmenden Kinder und eine detaillierte Darstellung der Durchführung des Programms, untergliedert in die Schwerpunkte „Zahlen als Anzahlen“, „Anzahlordnung“ und „Teil-Ganzes-Beziehungen und Anzahlunterschiede“. Die Kapitel beschreibt die einzelnen Förderstunden und integriert die während der Durchführung gemachten Beobachtungen.
Schlüsselwörter
Mathematische Frühförderung, Vorschulalter, Dyskalkulie, Förderprogramme, Krajewski, Eckstein, Zahlverständnis, Mengen, Zählen, Anzahlordnung, Teil-Ganzes-Beziehungen, Entwicklungsmodelle, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Mathematische Frühförderung im Vorschulalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die mathematische Frühförderung im Vorschulalter. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung und Evaluierung eines eigenen Förderprogramms, basierend auf bestehenden Konzepten von Krajewski und Eckstein. Die Arbeit analysiert zudem verschiedene theoretische Modelle zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen und beleuchtet die Bedeutung der Frühförderung zur Prävention von Dyskalkulie.
Welche theoretischen Modelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das fünfstufige Entwicklungsmodell von Fritz und Ricken, das Entwicklungsmodell früher mathematischer Kompetenzen von Krajewski und ein Modell zur Entwicklung von Zählfertigkeiten durch Fingerbilder (wahrscheinlich von Eckstein). Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten und bilden die Grundlage für die Bewertung des eigenen Förderprogramms.
Welche bestehenden Förderprogramme werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt die Förderprogramme „Mengen, zählen, Zahlen“ von Krajewski und „Mit 10 Fingern zum Zahlenverständnis“ von Eckstein vor. Diese Programme dienen als Grundlage für die Entwicklung des eigenen Förderprogramms.
Wie ist das eigene Förderprogramm aufgebaut?
Das eigene Förderprogramm baut auf den Ideen von Krajewski und Eckstein auf. Es beinhaltet die Schwerpunkte „Zahlen als Anzahlen“, „Anzahlordnung“ und „Teil-Ganzes-Beziehungen und Anzahlunterschiede“. Die Arbeit beschreibt detailliert die Durchführung des Programms, inklusive der Beobachtungen während der Förderstunden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit des selbst entwickelten Förderprogramms zu überprüfen und die Relevanz verschiedener theoretischer Modelle zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter zu beleuchten. Ein weiteres Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Frühförderung zur Prävention von Dyskalkulie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Entwicklung mathematischer Kompetenzen im Vorschulalter, Entwicklungsstörungen im Vorschulbereich, Frühförderung (inkl. des eigenen Förderprogramms) und Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was ist Dyskalkulie und welche Rolle spielt sie in der Arbeit?
Die Arbeit definiert Dyskalkulie und diskutiert mögliche Ursachen. Die Bedeutung frühzeitiger Förderung zur Prävention und Intervention bei Rechenschwäche wird hervorgehoben, wodurch der Kontext für die Relevanz des eigenen Förderprogramms geschaffen wird.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Durchführung des eigenen Förderprogramms. Eine detaillierte Auswertung und Interpretation der Ergebnisse wird im Kapitel „Frühförderung“ und im Fazit gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Mathematische Frühförderung, Vorschulalter, Dyskalkulie, Förderprogramme, Krajewski, Eckstein, Zahlverständnis, Mengen, Zählen, Anzahlordnung, Teil-Ganzes-Beziehungen, Entwicklungsmodelle, empirische Untersuchung.
- Quote paper
- Nathalie Fiore (Author), 2013, Mathematische Frühförderung im Vorschulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271144