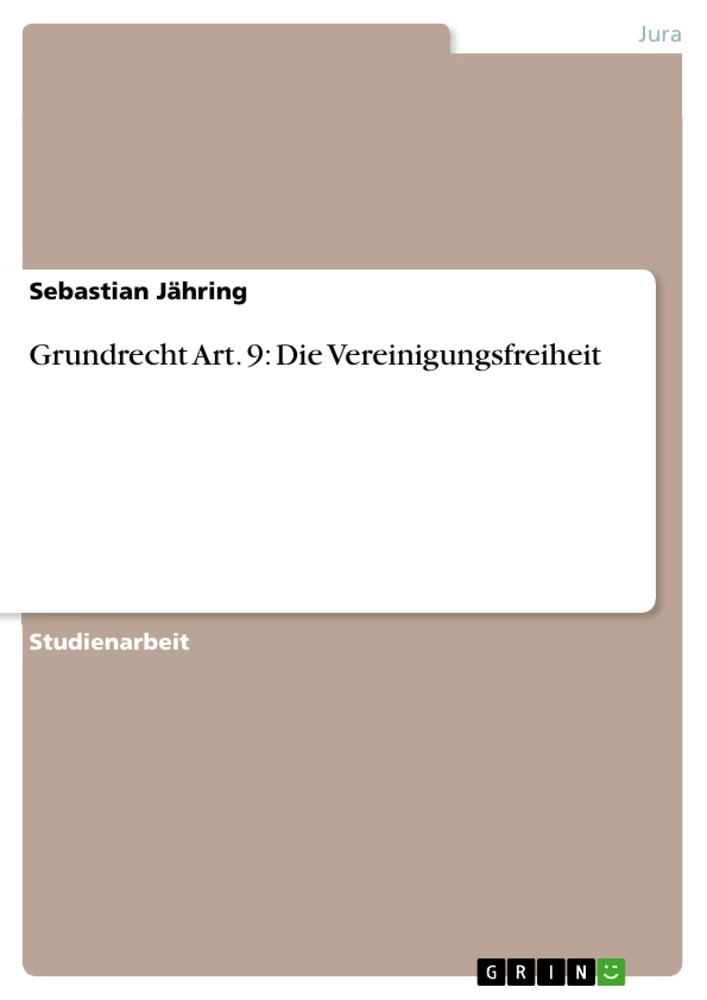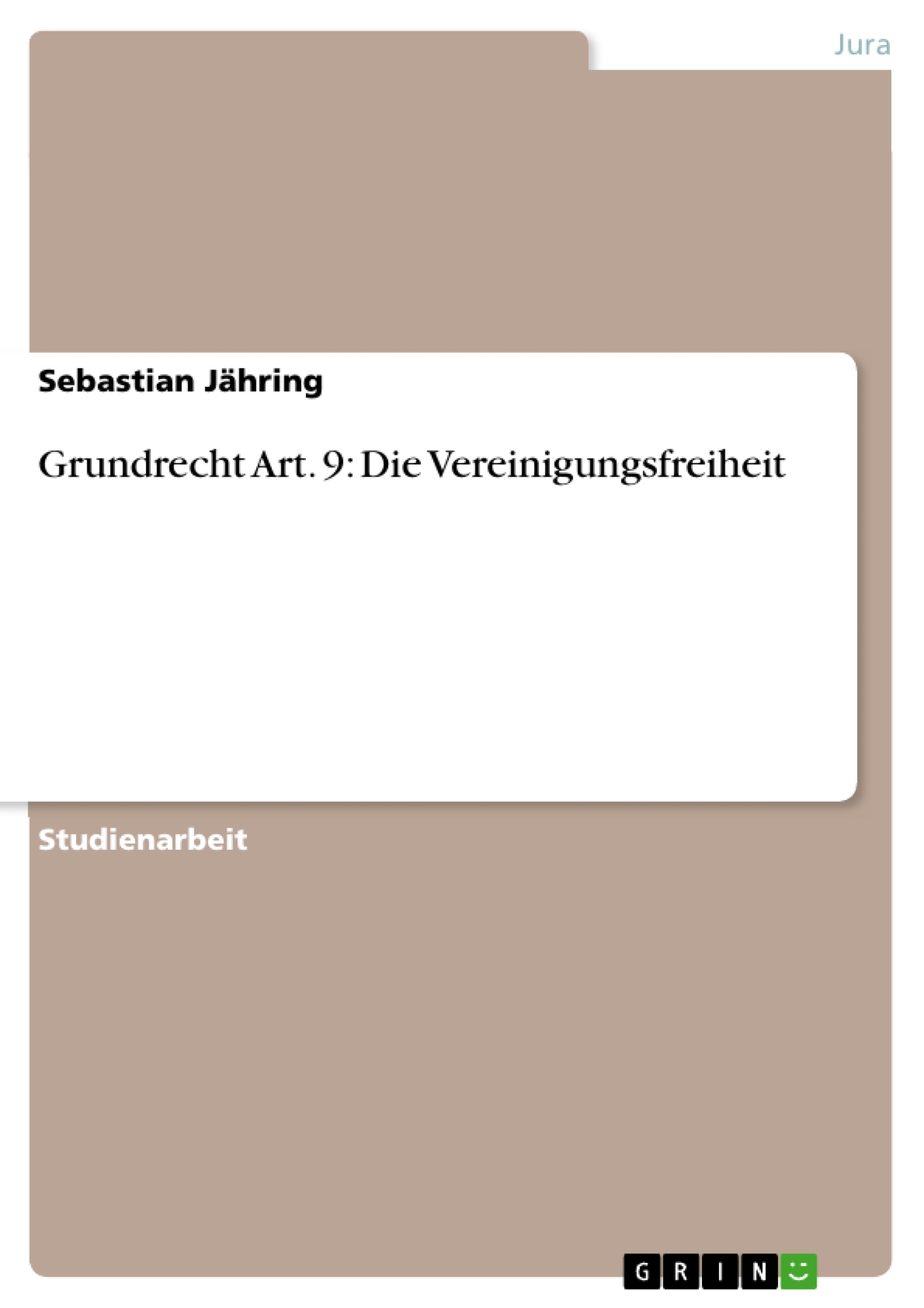Der Fund zweier Leichen am 04.11.2011 in einem Wohnwagen bei Eisenach markierte den Beginn zahlreicher Enthüllungen rund um die sog. NSU-Organisation. Sie zeigten ein bis dahin in der Öffentlichkeit nicht für möglich gehaltenes Ausmaß an rechtsextremistischer Kriminalität. Diese Enthüllungen lenkten eine erhöhte Aufmerksamkeit auf verfassungsfeindliche Vereinigungen. So tritt unweigerlich die Frage auf, welche Möglichkeiten es gibt, solchen Vereinigungen mit einem rechtsstaatlichen Verbot entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wird die Problematik aufgeworfen, inwieweit man von der Grundeinstellung und Gesinnung führender Vereinsmitglieder Rückschlüsse auf die wahren Ziele einer Vereinigung schließen kann.
Um diese Thematik näher zu beleuchten, zeigt die hier vorliegende Arbeit zunächst einen Überblick über die Struktur des Art. 9 GG. Es folgt eine ausführliche Erläuterung des Grundrechts der Vereinigungsfreiheit, u.a. mit dessen Schutzbereich und möglichen Eingriffsrechten. Anschließend wird das Urteil zum Verbot des verfassungsfeindlichen Vereins „Heimattreue Deutsche Jugend – Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und Heimat e.V.“ betrachtet.
Dieses Urteil ist für die Praxis insoweit von Bedeutung, dass die bisher erarbeiteten Rechtsgrundsätze zusammengestellt und exemplarisch auf einen Fall aus dem rechtsextremen politischen Spektrum angewandt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Überblick zu Art. 9 GG
- 2.1 Struktur
- 2.2 Historische Entwicklung
- 3. Die Vereinigungsfreiheit
- 3.1 Begriff Vereinigung
- 3.2 Persönlicher Schutzbereich
- 3.3 Sachlicher Schutzbereich
- 3.4 Eingriffe und Schranken
- 4. Verbot einer verfassungsfeindlichen Vereinigung
- 4.1 Sachverhalt
- 4.2 Verbotsbegründung
- 4.3 Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Vereinigungsfreiheit gemäß Artikel 9 GG im Kontext des Verbots verfassungsfeindlicher Vereinigungen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die Möglichkeiten des Staates, solchen Vereinigungen entgegenzuwirken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, inwieweit die Gesinnung führender Mitglieder Rückschlüsse auf die Ziele der Vereinigung zulässt.
- Struktur und historische Entwicklung von Art. 9 GG
- Begriff und Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit
- Eingriffsrechte und Schranken der Vereinigungsfreiheit
- Rechtsgrundlagen für das Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen
- Anwendung der Rechtsgrundsätze auf einen konkreten Fall
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit wird durch den Fund von Leichen und die darauf folgenden Enthüllungen um die NSU-Organisation eingeleitet. Der Fokus liegt auf der Frage nach den Möglichkeiten eines staatlichen Verbots verfassungsfeindlicher Vereinigungen und der Rolle der Gesinnung führender Vereinsmitglieder bei der Beurteilung der Vereinsziele. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau mit einem Überblick über Art. 9 GG, einer Erläuterung der Vereinigungsfreiheit und einer Betrachtung eines Urteils zum Verbot eines verfassungsfeindlichen Vereins. Dieser Fall dient als exemplarische Anwendung der erarbeiteten Rechtsgrundsätze im Kontext rechtsextremistischer Organisationen.
2. Überblick zu Art. 9 GG: Dieses Kapitel bietet eine strukturelle und historische Analyse von Artikel 9 GG. Es differenziert zwischen der allgemeinen Vereinigungsfreiheit (Abs. 1) und der Koalitionsfreiheit (Abs. 3), wobei beide als eigenständige Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe beschrieben werden. Die historische Entwicklung beider Grundrechte wird verfolgt, beginnend mit ihrer Festlegung in Verfassungen des 19. Jahrhunderts und ihrer Aufnahme in die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz. Der Unterschiedliche historische Entwicklung der beiden Grundrechte wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Art. 9 GG, Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Verfassungsfeindliche Vereinigung, Rechtsextremismus, Verbotsgrundsätze, Grundrechte, Abwehrrechte, Gesinnung, Vereinsziele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vereinigungsfreiheit und Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Vereinigungsfreiheit gemäß Artikel 9 GG im Kontext des Verbots verfassungsfeindlicher Vereinigungen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die Möglichkeiten des Staates, solchen Vereinigungen entgegenzuwirken, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Gesinnung führender Mitglieder bei der Beurteilung der Vereinsziele. Als Fallbeispiel dient ein Urteil zum Verbot eines verfassungsfeindlichen Vereins, veranschaulicht am Beispiel rechtsextremistischer Organisationen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: die Struktur und historische Entwicklung von Art. 9 GG; den Begriff und Schutzbereich der Vereinigungsfreiheit; Eingriffsrechte und Schranken der Vereinigungsfreiheit; die Rechtsgrundlagen für das Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen; und die Anwendung der Rechtsgrundsätze auf einen konkreten Fall (Verbot eines verfassungsfeindlichen Vereins).
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Überblick über Art. 9 GG (inklusive Struktur und historischer Entwicklung), ein Kapitel zur Vereinigungsfreiheit (Begriff, Schutzbereich, Eingriffe und Schranken), ein Kapitel zum Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen (Sachverhalt, Verbotsbegründung, Schlussfolgerung) und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Die Einleitung führt in die Thematik ein, ausgehend vom Fund von Leichen und den Enthüllungen um die NSU-Organisation.
Was ist der Schwerpunkt der Analyse von Art. 9 GG?
Das Kapitel zu Art. 9 GG analysiert sowohl die allgemeine Vereinigungsfreiheit (Abs. 1) als auch die Koalitionsfreiheit (Abs. 3) als eigenständige Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Die historische Entwicklung beider Grundrechte wird von ihrer Festlegung in Verfassungen des 19. Jahrhunderts über die Weimarer Verfassung bis zum Grundgesetz nachgezeichnet, wobei auch die unterschiedliche historische Entwicklung hervorgehoben wird.
Welche Rolle spielt die Gesinnung führender Mitglieder bei der Beurteilung von Vereinszielen?
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit die Gesinnung führender Mitglieder Rückschlüsse auf die Ziele der Vereinigung zulässt und wie diese im Kontext des Verbots verfassungsfeindlicher Vereinigungen zu bewerten ist. Dies wird anhand des konkreten Fallbeispiels erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Art. 9 GG, Vereinigungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, Verfassungsfeindliche Vereinigung, Rechtsextremismus, Verbotsgrundsätze, Grundrechte, Abwehrrechte, Gesinnung, Vereinsziele.
Für welche Zielgruppe ist diese Seminararbeit gedacht?
Die Seminararbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, welches sich mit dem Thema Vereinigungsfreiheit und dem Verbot verfassungsfeindlicher Vereinigungen auseinandersetzen möchte. Sie ist für Studierende der Rechtswissenschaften und verwandter Disziplinen relevant.
- Quote paper
- Sebastian Jähring (Author), 2012, Grundrecht Art. 9: Die Vereinigungsfreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266990