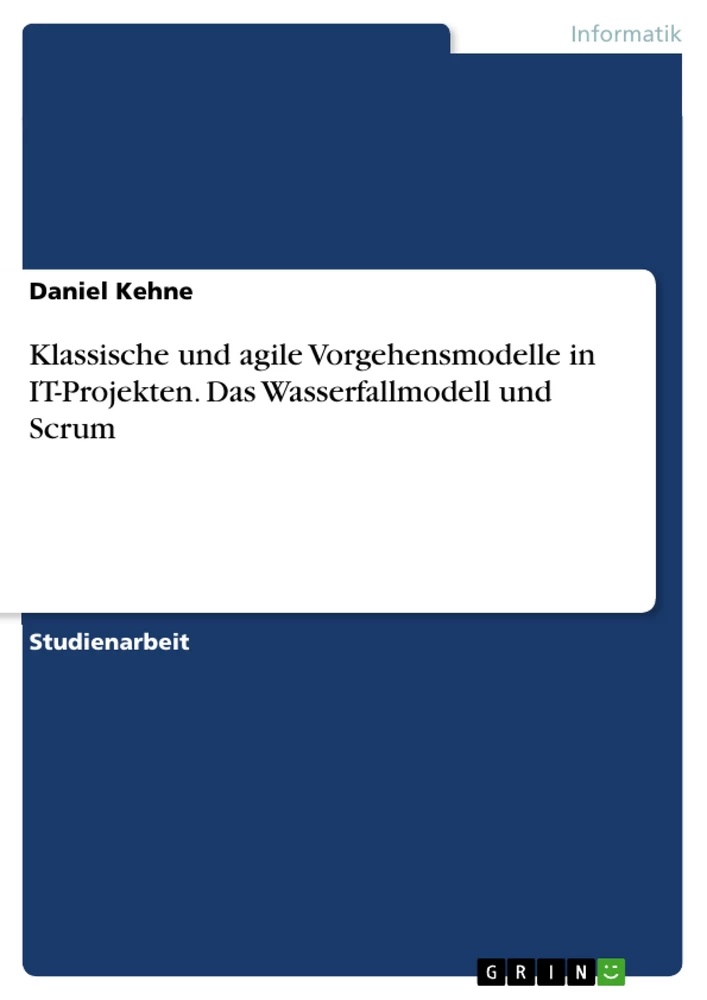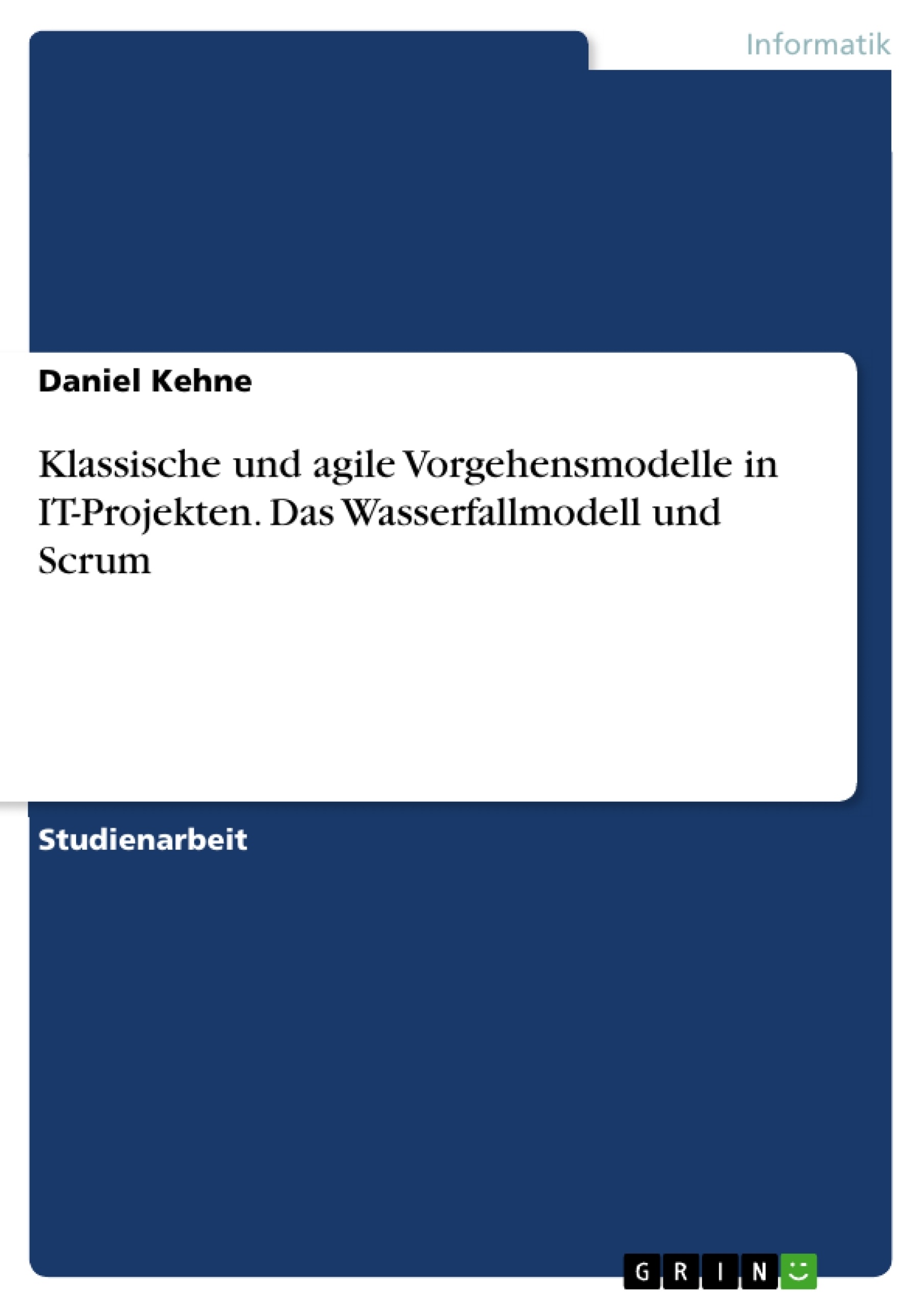Agile Organisationsmodelle sind modern und viel flexiblerer sagen die einen, die anderen schwören auf die Zuverlässigkeit des Altbewährten. Sind agile Modelle so viel besser als die klassischen Modelle? Wo liegen die Vor- und Nachteile auf beiden Seiten?
Diese Seminararbeit soll grundlegend das Wasserfallmodell als Vertreter der klassischen Modelle und Scrum als Vertreter agiler Modelle vorstellen. Beide Projektmodelle sind mir in meiner Berufslaufbahn schon begegnet, was dazu führte genügend Motivation zum Schreiben einer Facharbeit zu dieser Thematik zu schüren.
Gleichzeitig soll aber auch einen theoretischen Vergleich der beiden primären Vertreter zeigen, ob sich die Fragestellung im ersten Paragraphen beantworten lässt. Dies soll in einem für eine Seminararbeit angemessenen Umfang erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Umfeld der Arbeit
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Das IT-Projekt
- Klassische Vorgehensmodelle
- Das Wasserfallmodell
- Grundlegendes
- Die Phasen
- Vor- und Nachteile
- Bewertung
- Agile Vorgehensmodelle
- Scrum
- Grundlegendes
- Die Rollen
- Die Artefakte
- Meetings
- Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit hat zum Ziel, das Wasserfallmodell als Vertreter klassischer Vorgehensmodelle und Scrum als Vertreter agiler Modelle im IT-Projektmanagement zu vergleichen. Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile beider Modelle und bewertet deren Eignung für IT-Projekte. Der Fokus liegt auf einem theoretischen Vergleich und der Beantwortung der Frage, ob agile Modelle tatsächlich besser als klassische Modelle sind.
- Vergleich klassischer und agiler Vorgehensmodelle im IT-Projektmanagement
- Analyse des Wasserfallmodells: Stärken und Schwächen
- Analyse von Scrum: Stärken und Schwächen
- Bewertung der Eignung beider Modelle für unterschiedliche IT-Projekte
- Theoretische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beider Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Umfeld der Arbeit als Schnittstelle zwischen Wirtschafts- und Informatikwissenschaften im Kontext des IT-Projektmanagements. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich den Vergleich des Wasserfallmodells und Scrum, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der einleitende Zitat von Richard Löwenherz unterstreicht die Notwendigkeit von Anpassung und Wandel im dynamischen Umfeld der IT-Branche.
Das IT-Projekt: Dieses Kapitel definiert den Begriff des IT-Projekts als eine spezifische Form von Projekt mit informationstechnischem Zielbezug. Es werden die charakteristischen Merkmale von Projekten im Allgemeinen erläutert, darunter Komplexität, Einmaligkeit und zeitliche Begrenzung. Die Definition stellt die Grundlage für die folgenden Kapitel dar, in denen konkrete Vorgehensmodelle im Detail betrachtet werden.
Klassische Vorgehensmodelle: Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge klassischer Vorgehensmodelle und analysiert das Wasserfallmodell als ein Beispiel. Es werden die einzelnen Phasen des Wasserfallmodells detailliert dargestellt, sowie seine Vor- und Nachteile im Hinblick auf Planbarkeit, Flexibilität und Risikomanagement diskutiert. Die Bewertung des Wasserfallmodells beleuchtet dessen Eignung für bestimmte Arten von IT-Projekten.
Agile Vorgehensmodelle: Ähnlich wie das vorherige Kapitel, konzentriert sich dieser Abschnitt auf agile Vorgehensmodelle und beschreibt Scrum als ein Beispiel. Es werden die zentralen Elemente von Scrum – Rollen, Artefakte und Meetings – detailliert erläutert und ihre Funktionen innerhalb des agilen Entwicklungsprozesses erklärt. Die Beschreibung umfasst die Prinzipien der iterativen und inkrementellen Entwicklung und die Bedeutung von Zusammenarbeit und Flexibilität.
Bewertung: Dieses Kapitel bietet einen direkten Vergleich des Wasserfallmodells und Scrum. Die Stärken und Schwächen beider Modelle werden gegenübergestellt und diskutiert, wobei der Fokus auf den jeweiligen Vor- und Nachteilen in unterschiedlichen Projektsituationen liegt. Dieser Vergleich dient als Grundlage für die abschließende Bewertung und das Fazit.
Schlüsselwörter
IT-Projektmanagement, Wasserfallmodell, Scrum, agile Vorgehensmodelle, klassische Vorgehensmodelle, Projektmanagementmethoden, Softwareentwicklung, Vor- und Nachteile, Bewertung, theoretischer Vergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Vergleich von Wasserfallmodell und Scrum im IT-Projektmanagement
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit vergleicht das Wasserfallmodell (als Vertreter klassischer Vorgehensmodelle) und Scrum (als Vertreter agiler Modelle) im IT-Projektmanagement. Sie untersucht die Vor- und Nachteile beider Modelle und bewertet deren Eignung für IT-Projekte. Der Fokus liegt auf einem theoretischen Vergleich und der Beantwortung der Frage, ob agile Modelle tatsächlich besser als klassische Modelle sind.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich klassischer und agiler Vorgehensmodelle, Analyse der Stärken und Schwächen des Wasserfallmodells und von Scrum, Bewertung der Eignung beider Modelle für unterschiedliche IT-Projekte und eine theoretische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beider Ansätze.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum IT-Projekt, Kapitel zu klassischen und agilen Vorgehensmodellen (mit detaillierter Betrachtung des Wasserfallmodells und Scrum), eine Bewertung der Modelle und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt das Umfeld der Arbeit, die Zielsetzung und den Aufbau. Jedes Kapitel fasst seine Inhalte zusammen.
Was wird im Kapitel "Klassische Vorgehensmodelle" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge klassischer Vorgehensmodelle und analysiert detailliert das Wasserfallmodell. Es werden die einzelnen Phasen, die Vor- und Nachteile bezüglich Planbarkeit, Flexibilität und Risikomanagement sowie die Eignung für bestimmte IT-Projekte diskutiert.
Was wird im Kapitel "Agile Vorgehensmodelle" behandelt?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf agile Vorgehensmodelle und beschreibt detailliert Scrum. Es werden die zentralen Elemente (Rollen, Artefakte, Meetings), die Prinzipien der iterativen und inkrementellen Entwicklung und die Bedeutung von Zusammenarbeit und Flexibilität erläutert.
Wie werden Wasserfallmodell und Scrum verglichen?
Im Kapitel "Bewertung" werden die Stärken und Schwächen des Wasserfallmodells und Scrum direkt gegenübergestellt und in Bezug auf unterschiedliche Projektsituationen diskutiert. Dieser Vergleich dient der abschließenden Bewertung und dem Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: IT-Projektmanagement, Wasserfallmodell, Scrum, agile Vorgehensmodelle, klassische Vorgehensmodelle, Projektmanagementmethoden, Softwareentwicklung, Vor- und Nachteile, Bewertung, theoretischer Vergleich.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit hat zum Ziel, einen fundierten Vergleich zwischen dem Wasserfallmodell und Scrum im Kontext des IT-Projektmanagements zu liefern und deren jeweilige Eignung für verschiedene Projekte zu bewerten.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse kurz und prägnant darstellt.
- Arbeit zitieren
- Daniel Kehne (Autor:in), 2012, Klassische und agile Vorgehensmodelle in IT-Projekten. Das Wasserfallmodell und Scrum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266692