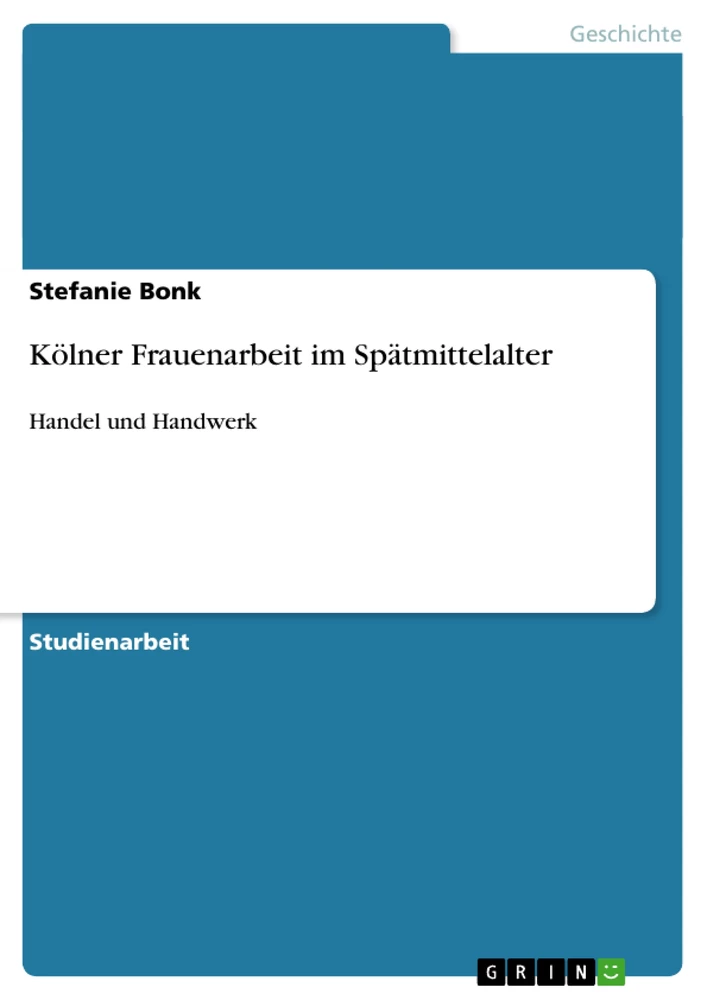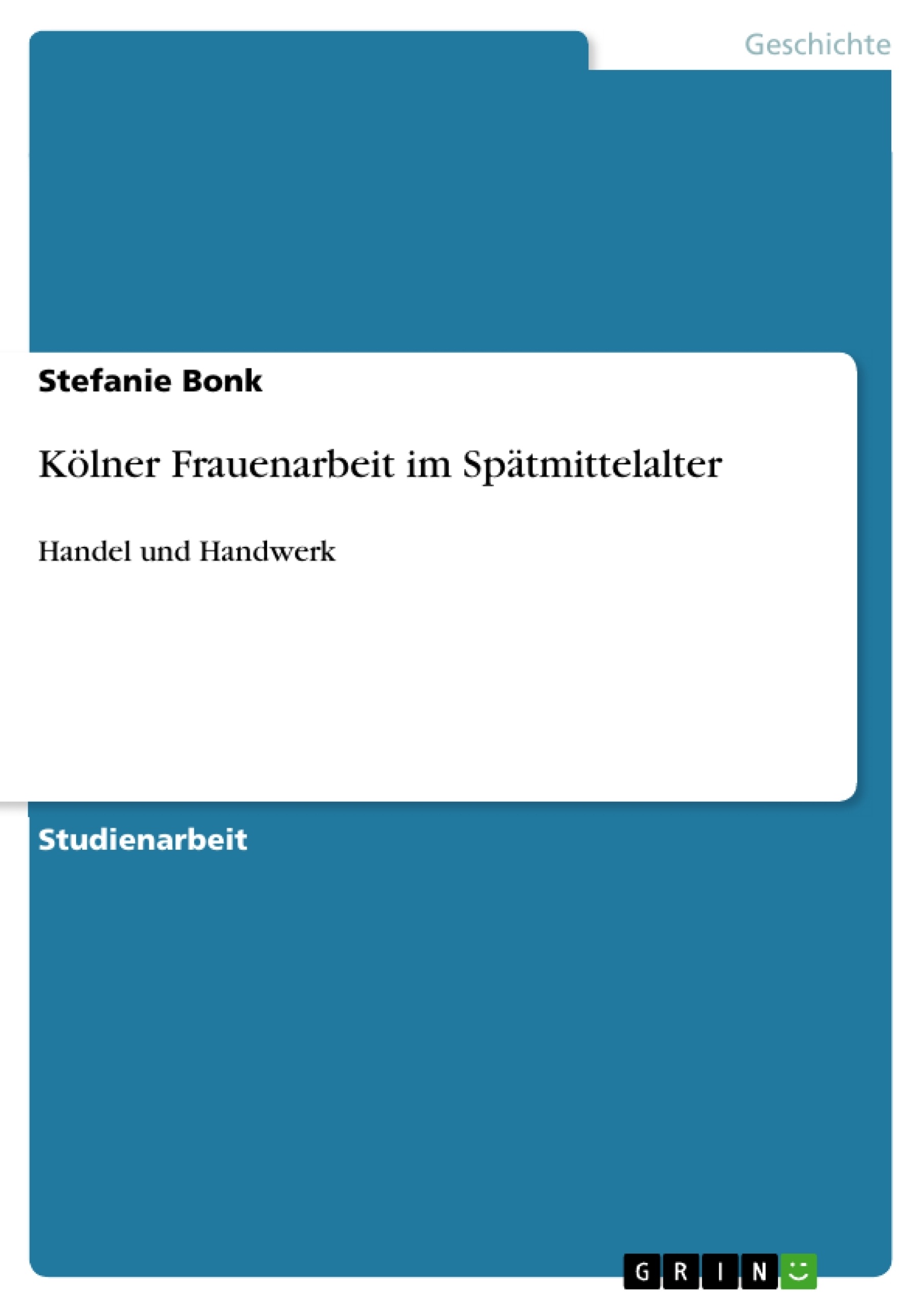Für heute lebende Menschen in der westlichen Welt ist es selbstverständlich, dass Frauen in hoher Anzahl Berufe ausüben und eine zumindest weitgehende Gleichberechtigung der Geschlechter in wirtschaftlicher, rechtlicher und sozialer Hinsicht besteht.
Denkt der Laie an vormoderne Verhältnisse, so ist er sicher, dass die Situation für Frauen seinerzeit weitaus schlechter ausgesehen haben muss und das weibliche Geschlecht vermutlich nicht am Erwerbsleben beteiligt war, sondern ihr Arbeitsbereich auf „Haus und Herd“ beschränkt blieb.
Doch begann die kategorische Trennung von Haus und Beruf erst in der Moderne, während Frauen im Mittelalter in zahlreichen Berufszweigen präsent waren.
Dennoch hat die historische Forschung das Leben der alteuropäischen Frau – ihren Alltag wie auch ihre Erwerbsmöglichkeiten – lange Zeit ausgeklammert und sich auf Machthaber und Eliten – die naturgemäß männlich waren – konzentriert. Seit Etablierung der „Geschichte von unten“ in den 1970er Jahren, die sich mit der Alltagsgeschichte und dem Leben „einfacher Menschen“ beschäftigt, nehmen sich jedoch immer mehr Historiker dieses Themas an.
Zwar sind noch viele Fragen offen und es ist weiterhin zu bedenken, dass die Vergangenheit niemals in Gänze rekonstruierbar ist, sondern aufgrund des geringen Verschriftungsgrades sowie der Zufälligkeit und Unvollständigkeit an Überlieferungen stets fragmentarisch und schemenhaft bleiben wird. Doch konnte aufgrund ausgiebiger Frauenforschung in den letzten Jahrzehnten ein erster Eindruck davon gewonnen werden, wie das weibliche Geschlecht in der Vergangenheit gelebt hat.
In meiner Hausarbeit möchte ich mich eingehender mit der Frauenarbeit im spätmittelalterlichen Köln befassen. Der Schwerpunkt liegt darin, herauszu-arbeiten, in welchem Maße weibliche Angehörige verschiedener sozialer Schichten zu jener Zeit in die Berufszweige des Kölner Handwerks und Handels eingebunden waren und welche Tätigkeiten sie dort entgeltlich entrichteten. Daneben möchte ich ergründen, wie die Frauenerwerbstätigkeit in Köln im Vergleich zur Frauenarbeit in anderen deutschen Städten zu bewerten ist. So soll herausgefunden werden, ob die berufstätige Kölnerin seinerzeit wirklich eine deutsche Ausnahmeerscheinung darstellte, wie häufig erklärt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lebenssituation deutscher Frauen in der spätmittelalterlichen Stadt
- Die bürgerrechtliche Stellung
- Die soziale und wirtschaftliche Stellung
- Die berufliche Situation Kölner Frauen im Spätmittelalter
- Kölner Frauen im Handel
- Kölner Frauen im Weinhandel
- Weinzapf
- Weinimport
- Weinexport
- Kölner Frauen im Weinhandel
- Kölner Frauen im Handwerk
- Kölner Garnmacherinnen
- Die weitere Entwicklung der Frauenarbeit
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erwerbstätigkeit von Frauen im spätmittelalterlichen Köln, insbesondere im Handel und Handwerk. Es wird analysiert, inwieweit Frauen verschiedener sozialer Schichten in diese Berufsfelder eingebunden waren und welche Tätigkeiten sie ausübten. Ein Vergleich mit der Situation in anderen deutschen Städten soll klären, ob die Kölner Frauen tatsächlich eine Ausnahme darstellten.
- Die bürgerrechtliche Stellung von Frauen im spätmittelalterlichen Köln und deren Auswirkungen auf ihre Erwerbstätigkeit.
- Die soziale und wirtschaftliche Stellung von Frauen und ihre Beteiligung am Handel und Handwerk.
- Die konkreten Tätigkeiten von Frauen im Kölner Weinhandel und Handwerk (z.B. als Garnmacherinnen).
- Ein Vergleich der Situation Kölner Frauen mit der in anderen deutschen Städten.
- Die Entwicklung der Frauenarbeit im Kontext des Spätmittelalters.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar: Während Frauen in der heutigen westlichen Welt selbstverständlich in vielen Berufen tätig sind, wird die Rolle der Frau im Mittelalter oft vernachlässigt oder als auf "Haus und Herd" beschränkt wahrgenommen. Die Arbeit widmet sich der Erwerbstätigkeit von Frauen im spätmittelalterlichen Köln, untersucht deren Einbindung in Handel und Handwerk und vergleicht die Situation mit anderen deutschen Städten.
Die Lebenssituation deutscher Frauen in der spätmittelalterlichen Stadt: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtliche, soziale und wirtschaftliche Lage von Frauen im spätmittelalterlichen städtischen Kontext. Es wird der Erwerb des Bürgerrechts thematisiert, welches zwar grundsätzlich auch Frauen zugestanden wurde, aber oft mit finanziellen Hürden verbunden war und daher vor allem vermögenden Frauen zugänglich war. Die soziale und wirtschaftliche Stellung von Frauen wird als verbessert im Vergleich zu früheren Zeiten dargestellt, unter anderem durch eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität, die sich in Bereichen wie dem Leibrentenkauf und dem Immobiliengeschäft bemerkbar machte.
Die berufliche Situation Kölner Frauen im Spätmittelalter: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die berufliche Tätigkeit Kölner Frauen im Spätmittelalter. Es bildet die Brücke zwischen den sozioökonomischen Gegebenheiten des vorherigen Kapitels und den detaillierten Analysen der folgenden Kapitel zu Handel und Handwerk. Es stellt die Grundlage für das Verständnis der spezifischen Rollen von Frauen in verschiedenen Wirtschaftszweigen dar.
Kölner Frauen im Handel: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Beteiligung Kölner Frauen am Handel, insbesondere im Weinhandel. Es beschreibt verschiedene Tätigkeiten, wie den Weinzapf, den Import und Export von Wein, und verdeutlicht die wirtschaftliche Aktivität und Selbstständigkeit von Frauen in diesem Bereich. Es werden wahrscheinlich konkrete Beispiele aus Quellen genannt, die die Rolle von Frauen im Weinhandel illustrieren.
Kölner Frauen im Handwerk: Der Fokus liegt hier auf der Beteiligung von Frauen am Handwerk in Köln, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Garnmacherinnen. Die Zusammenfassung wird die Arbeitsbedingungen, die Rolle der Frauen in den Zünften und den wirtschaftlichen Beitrag der weiblichen Handwerkerinnen in diesem Kontext beleuchten. Die Zusammenhänge zu den vorherigen Kapiteln (rechtliche Lage, soziale Stellung) werden hier besonders deutlich.
Die weitere Entwicklung der Frauenarbeit: Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf die Entwicklung der Frauenarbeit über den behandelten Zeitraum hinaus. Es wird wahrscheinlich die Kontinuität und den Wandel der Rolle von Frauen im Beruf im Kontext größerer historischer Entwicklungen analysieren.
Schlüsselwörter
Frauenarbeit, Spätmittelalter, Köln, Handel, Handwerk, Bürgerrecht, soziale Stellung, wirtschaftliche Stellung, Weinhandel, Garnmacherinnen, Rechtsfähigkeit, Geschlechterrollen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Erwerbstätigkeit von Frauen im spätmittelalterlichen Köln
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Erwerbstätigkeit von Frauen im spätmittelalterlichen Köln, insbesondere im Handel und Handwerk. Es werden die bürgerrechtliche, soziale und wirtschaftliche Stellung der Frauen analysiert, ihre konkreten Tätigkeiten beschrieben und ein Vergleich mit der Situation in anderen deutschen Städten gezogen. Die Entwicklung der Frauenarbeit wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Die Lebenssituation deutscher Frauen in der spätmittelalterlichen Stadt, Die berufliche Situation Kölner Frauen im Spätmittelalter, Kölner Frauen im Handel (inkl. Weinhandel mit Unterkapiteln zu Weinzapf, -import und -export), Kölner Frauen im Handwerk (inkl. Garnmacherinnen), Die weitere Entwicklung der Frauenarbeit und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Erwerbstätigkeit von Frauen im spätmittelalterlichen Köln zu erforschen und deren Einbindung in Handel und Handwerk zu analysieren. Es soll untersucht werden, inwieweit Frauen verschiedener sozialer Schichten in diese Berufsfelder eingebunden waren und welche Tätigkeiten sie ausübten. Ein Vergleich mit anderen Städten soll die Besonderheiten der Situation in Köln herausstellen.
Welche Rolle spielte das Bürgerrecht für die Erwerbstätigkeit von Frauen?
Das Bürgerrecht spielte eine wichtige Rolle. Obwohl Frauen es grundsätzlich erwerben konnten, war dies oft mit finanziellen Hürden verbunden und somit vorwiegend vermögenden Frauen zugänglich. Die Arbeit analysiert den Einfluss des Bürgerrechts auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen.
Welche konkreten Tätigkeiten von Frauen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Tätigkeiten von Frauen im Kölner Weinhandel (Weinzapf, Import, Export) und im Handwerk, insbesondere als Garnmacherinnen. Konkrete Beispiele aus Quellen werden wahrscheinlich angeführt.
Wie wird die Situation Kölner Frauen mit anderen Städten verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Situation Kölner Frauen mit der in anderen deutschen Städten, um die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der Situation herauszuarbeiten und zu ermitteln, ob die Kölner Frauen eine Ausnahme darstellten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in den Schlussbemerkungen zusammengefasst. Sie beleuchten wahrscheinlich die Rolle der Frauen in der spätmittelalterlichen Kölner Wirtschaft, die Bedeutung der sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Frauenarbeit über den betrachteten Zeitraum hinaus.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenarbeit, Spätmittelalter, Köln, Handel, Handwerk, Bürgerrecht, soziale Stellung, wirtschaftliche Stellung, Weinhandel, Garnmacherinnen, Rechtsfähigkeit, Geschlechterrollen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Bonk (Autor:in), 2012, Kölner Frauenarbeit im Spätmittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265671