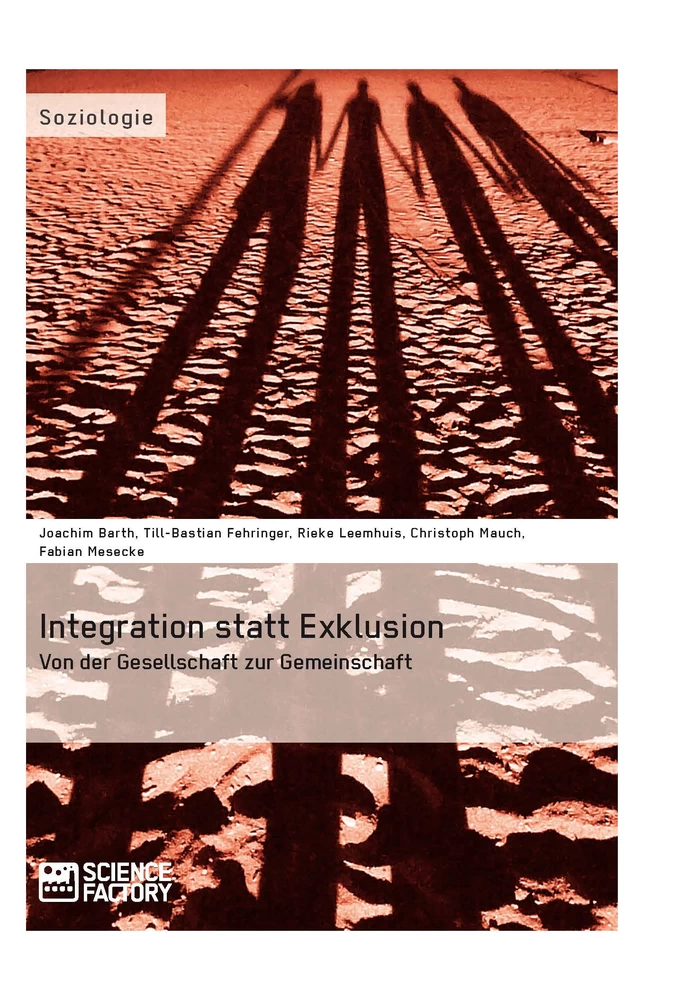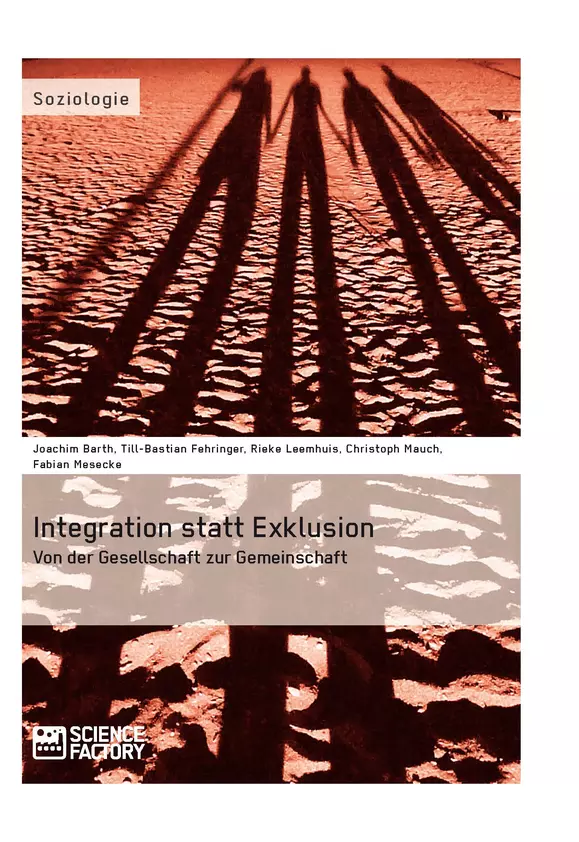Die Integration ethnischer wie religiöser Minderheiten ist nach wie vor eine ungelöste Aufgabe, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Dieser Band erklärt die Grundproblematik und liefert einige Denk- und Lösungsansätze. Dabei werden sowohl der Einfluss sozialräumlicher Segregation als auch die Spracherwerbsproblematik vertieft behandelt.
Aus dem Inhalt: Exklusionsmechanismen durch Medien und Islam?, Die Integration ethnischer Minderheiten, Der Einfluss sozialräumlicher Segregation, Die Spracherwerbsproblematik als Determinante der Integration
Inhaltsverzeichnis
Das Problem der Integration von Muslimen in der Bundesrepublik Deutschland
Einleitung
Integration – Assimilation: Begriffserklärung
Zuwanderung von Muslimen türkischer Herkunft nach Deutschland
Das Problem des „Fremden“ und die Rolle der Medien
Das Islambild der deutschen Gesellschaft seit dem 11. September 2001
Der Islam als Integrationbarierre?
Fazit
Quellenangabe:
Abbildungsverzeichnis:
Integration ethnischer Minderheiten
Einleitung
Soziale Probleme
Ethnische Gruppen, ethnische Minderheiten und Ethnizität
Integration ethnischer Minderheiten
Ethnische Schichtung
Selbstehtnisierung
Zusammenfassung: Ethnische Schichtung und Ethnisierung als Integrationshemmnisse
Rekurs Integration als soziales Problem
Schlussbemerkung und Ausblick
Literatur
Integration durch Sprache in der Schule
Einleitung
Problemfeld Sprachbarrieren
Integration und Zweitsprache Deutsch
Fazit und Ausblick
Literatur
Über den Einfluss sozialräumlicher Segregation auf die Integration von MigrantInnen
Einleitung
Zum Begriff der Segregation
Zum Begriff der Integration
Segregationseffekte
Fazit
Literaturverzeichnis
Spracherwerbsproblematik als Determinante der Integration von Migranten
Abkürzungsverzeichnis
Problemstellung
Erziehungs- und sozialisationstheoretische Überlegungen
Migration in Deutschland
Entwurf eines sozioökologischen Modells zur Erfassung von Schulerfolgsdeterminanten in Migrantenschullaufbahnen
Prozess der Integration unter dem Gesichtspunkt der Zweisprachigkeit und des Bilingualismus
Förderungsprogramme zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Integration
Fallanalyse
Zusammenfassende Interpretation und Ausblick
Literaturverzeichnis
Das Problem der Integration von Muslimen in der Bundesrepublik Deutschland
Exklusionsmechanismen durch Medien und Islam?
Christoph Mauch, 2006
Einleitung
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit und in der einschlägigen Literatur wird häufig davon ausgegangen, dass Integrationsprobleme auf Kultur und Religion beruhen. Die Ausgangsproblematik ist hierbei, dass eine christlich eingefärbte säkulare Mehrheitsgesellschaft einer (zahlenmäßig türkisch dominierten) muslimischen Minderheit gegenüber steht.
Häufig werden der Islam und die Muslime mit einer in einigen Ländern praktizierten radikal-fundamentalistischen Ausprägung gleichgesetzt, insbesondere nach dem 11. September 2001 und auch durch die Anschläge von London, welche von anscheinend „eingebürgerten“ und „integrierten“ jungen Muslimen durchgeführt wurden. Dabei wird nicht beachtet, dass in vielen islamischen Ländern seit langem eine Trennung zwischen Staat und Religion besteht[1]. Trotz der inzwischen 40jährigen Migration von Muslimen ist das Wissen über den Islam in der deutschen Öffentlichkeit gering geblieben. Es wird größtenteils die These vertreten, Muslime wollten sich nicht integrieren, um ihre „kulturelle Identität“ nicht zu verlieren, oder sie könnten sich nicht integrieren, da der Islam dies nicht zulasse. Stehen sich hier islamische Religion und Rechtstaat, Tradition und Moderne, homogene und pluralistische Gesellschaft gegenüber? Sind Muslime nicht gewollt, ist es ihnen nicht erlaubt oder liegt es an der autochthonen Bevölkerung?
Ich beziehe mich in meiner Ausarbeitung auf in Deutschland lebende Türken, muslimischen Glaubens, da diese den größten Anteil der in der BRD lebenden Muslime ausmachen.
Zunächst werden die Termini Integration und Assimilation in Anlehnung an den Soziologen Hartmut Esser geklärt. Dann gebe ich einen kurzen historischen Abriss über die Zuwanderung von türkischen Muslimen nach Deutschland im Zuge der „Deutsch-türkischen Vereinbarung zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“.
Anschließend beschreibe ich die Darstellung von Ausländern in deutschen Massenmedien, um anschließend in Punkt auf das besondere „Bild“ von Muslimen in der deutschen Öffentlichkeit, verändert durch die Anschläge vom 11. September 2001, einzugehen. Zum Schluss versuche ich zu klären, ob der Islam als eine Art Integrations-/Assimilationsbarierre wirkt und, ob er mit dem Deutschen Rechtsstaat vereinbar ist.
Aufgrund der zu umfangreichen Thematik gehe ich weder auf die soziale Stellung von Muslimen in Deutschland noch auf Integrationspolitik oder spezielle Integrationsfelder wie Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnsituation ein. Mit „Muslimen“ sind generell türkische, in Deutschland lebende Muslime gemeint.
Integration – Assimilation: Begriffserklärung
Der vielseitige Begriff der Integration wird häufig falsch angewendet oder erst gar nicht verstanden. Medien und Politik verwenden ihn häufig polarisierend für oder gegen Zuwanderung und Migranten.[2] Dabei wird der Begriff der Integration als ein Anpassen von Migranten an die deutsche[3] Gesellschaft beschrieben.
Hier ist jedoch besonders der Begriff der Assimilation oder der Sozialintegration anzuwenden, der den Anpassungsprozess von Zuwanderern an die Gesellschaft als einseitig und von den Migranten ausgehend beschreibt[4] (die Inklusion), obwohl die Gesellschaft Aufnahmebereitschaft zeigen muss.
Der Soziologe Hartmut Esser unterscheidet zwischen vier Dimensionen der Sozialintegration: Kulturation, Plazierung, Interaktion und Identifikation.
Kulturation meint dabei, dass sich die Akteure nötiges Wissen und Kompetenzen aneignen, ein so genanntes Humankapital, in das sie investieren müssen, um für andere Akteure interessant zu sein und in Folge dessen gesellschaftlich angesehene Positionen besetzen können.[5] Er bezeichnet dies auch als kognitive Assimilation, die sich auf das Erlernen von Normenkenntnissen und kulturellen Fähigkeiten, wie der deutschen Sprache, bezieht.[6]
Als wahrscheinlich wichtigste Form der sozialen Integration sieht Esser die Plazierung, bei der es um die Besetzung gesellschaftlicher Positionen geht. Die Akteure werden dabei in ein bereits bestehendes soziales System eingegliedert.
Dazu gehören das Erlangen verschiedener Rechte wie das Staatsbürgerrecht, das damit einhergehende Wahlrecht oder die Übernahme von beruflichen Positionen, die allerdings im Zusammenhang mit dem „Durchlaufen einer gewissen Bildungskarriere“[7] stehen. Dies nennt er auch strukturelle Assimilation, welche beschreibt, inwieweit Migranten im Bezug auf Wohnsituation, rechtliche Situation und berufliche Situation an die Aufnahmegesellschaft angepasst sind.[8]
Interaktionen beschreiben unter anderem soziale Beziehungen, quasi die Plazierung in alltägliche, nichtformelle Bereiche. Esser beschreibt die Interaktion als einen Spezialfall des sozialen Handelns, bei dem Akteure über „ihr Handeln, Relationen miteinander bilden“.[9]
Die identifikative Assimilation beschreibt das subjektive Zugehörigkeitsempfinden und die Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ zur Aufnahmegesellschaft.[10] Der im Zusammenhang mit der Sozialintegration als Identifikation beschriebene Begriff bezeichnet die emotionale Beziehung zwischen dem einzelnen Akteur und dem sozialen System als Kollektiv und wird in drei Dimensionen (Werte, Bürgersinn, Hinnahme) unterschieden.[11]
„Integration setzt das Vorhandensein von mindestens zwei Gruppen voraus, die sich in Herkunft, Verhalten, Normen und Wertehaltung differenzieren.“[12] Diese zwei Gruppen werden als Majorität und Minorität beschrieben: Aufnahmegesellschaft und Einwanderer. Die Minorität hat sich der Aufnahmegesellschaft unterzuordnen.
Das Assimilationsmodell Essers geht von einem einseitigen Angleichen der Ausländer an die Aufnahmegesellschaft aus.
Dies ist aber nur in äußerst homogenen Gesellschaften möglich, nicht dagegen in pluralistischen Dienstleistungsgesellschaften wie der Bundesrepublik Deutschland, weil es unmöglich ist, sich an alle Milieus und Lebensstile innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft anzupassen.[13]
Allerdings gilt Integration nicht als gelungen, wenn die ethnische Zugehörigkeit und die dazugehörige Lebensweise und Einstellung verschwindet und die der Aufnahmegesellschaft übernommen wird. Erst wenn eine Chancengleichheit in Bereichen wie Arbeit, Wohnen und Bildung gegeben ist, kann eine Integration als erfolgreich angesehen werden. Migranten dürfen dabei nicht nur die unteren Segmente von Wohn- und Arbeitsmarkt offen stehen. Hierzu braucht es einen Sozialstaat, der dies kontrolliert.[14]
Zuwanderung von Muslimen türkischer Herkunft nach Deutschland
In der Bundesrepublik Deutschland leben zurzeit etwa 7,3 Millionen Ausländer, das entspricht einem Anteil von ca. 8,9% der Gesamtbevölkerung. Darunter befinden sich 1,88 Millionen Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit, die mit Abstand größte Gruppe der Nichtdeutschen in der BRD.[15]
Die meisten Türken kamen seit den sechziger Jahren als „Gastarbeiter“, im Zuge der „deutsch-türkischen Vereinbarung zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt“ vom 31.10.1961 in die BRD.[16] Für die so genannte erste Generation der türkischen Einwanderer galten besondere Bedingungen im Vergleich zu anderen „Arbeitsmigranten“ wie etwa aus Italien, mit welchem es schon seit 1955 das erste Anwerbeabkommen gab. Der Aufenthalt türkischer Migranten beschränkte sich zunächst auf zwei Jahre (das so genannte „Rotationsprinzip“). Damit distanzierte man sich sehr von der im Umgang mit italienischen „Gastarbeitern“ betriebenen Politik, bei denen ein dauerhafter Aufenthalt inklusive Familiennachzug gewünscht war. Begründet wurde dies damit, dass es keine Einwanderung von Türken nach Deutschland geben dürfe, da eine „Überfremdung“ befürchtet wurde.[17] Des Weiteren wurden Türken vor der Einreise zum „seuchenhygienischen“ Schutz der deutschen Bevölkerung einer Untersuchung unterzogen.
Aufgrund des Drucks von Arbeitgebern, die Türken beschäftigten, wurde das Abkommen mit der Türkei 1964 überarbeitet und ein längerer Aufenthalt vereinbart, da beklagt wurde, dass die Unternehmen ständig gut eingearbeitete Arbeitnehmer durch nicht eingearbeitete ersetzen müssten, was häufig mit Produktionsausfällen und hohen Kosten verbunden war.[18]
Ahmet Fuat Boztepe[19] unterscheidet drei große Phasen der Zuwanderung. Die erste umfasst die Zeit vom ersten Anwerbeabkommen mit der Türkei 1961 bis zum Anwerbestopp 1973. In Folge des Konjunkturrückgangs konnten 1966-1967 erstmals mehr Fortzüge als Zuzüge, also eine erste Remigration, registriert werden. Drei Jahre später, 1970, erreichte die Migrationswelle aus der Türkei mit über 120.000 Einreisen ihren zahlenmäßigen Höhepunkt (zum Vergleich: 1962 waren es ca. 15.000 eingereiste Arbeiter).
In dieser ersten Phase kamen vor allem Männer nach Deutschland, mit dem Ziel, möglichst viel zu arbeiten, um nach kurzer Zeit genug Geld verdient zu haben, um sich und ihren Familien in der Türkei eine Existenzgründung zu ermöglichen.
Anwerbestopp und die durch die Rezession 1974 steigende Arbeitslosigkeit läuteten die zweite Phase bis 1985 ein. Es war nicht mehr möglich als Arbeitsmigrant nach Deutschland einzureisen, was zur Folge hatte, dass viele Türken gleich in Deutschland blieben und ihnen somit klar wurde, dass der Aufenthalt nicht unbedingt befristet bleiben würde. Des Weiteren wurde 1975 beschlossen, dass nicht in der BRD lebenden Kindern weniger Kindergeld zukommt. Ein weiterer Anreiz für den Familiennachzug. Viele Eltern holten auch in Folge der politischen Unruhen der siebziger Jahre in der Türkei ihre bisher dort zur Schule gehenden Kinder nach. Dadurch wuchs die Zahl der türkischen Bevölkerung allein in den Jahren von 1978 bis 1981 um über 400.000 an. Infolge des Rückkehrförderungsgesetzes vom Oktober 1983, dem Beginn der 3. Phase, kehrten in den darauffolgenden Jahren über 320.000 Türken in ihre Heimat zurück. Durch den gewaltsamen Konflikt zwischen PKK und türkischer Armee, Mitte der achtziger Jahre, stieg die Zahl der türkischen Staatsangehörigen in Deutschland wieder, vor allem deshalb, weil viele Kurden als politische Flüchtlinge einreisten.
Vom Beginn der Arbeitskräfteanwerbung 1955 bis zum Anwerbestopp im Jahre 1973 kamen etwa 14 Millionen „Gastarbeiter“ in die Bundesrepublik Deutschland, etwa 11 Millionen verließen sie im gleichen Zeitraum wieder.
Diejenigen, die sich entschlossen in der BRD zu bleiben, begannen sich niederzulassen, Wohnungen zu kaufen und in die Bildung ihrer Kinder in Deutschland zu investieren, so dass erstmals eine Einbürgerung denkbar wurde.[20]
Um den in der Zeit des Nationalsozialismus geprägten Begriff des „Fremdarbeiters“ zu ersetzen, wurden ausländische Arbeitnehmer, vor allem in den siebziger Jahren, im allgemeinen Sprachgebrauch als „Gastarbeiter“ bezeichnet.[21] Das beschreibt die allgemeine Einstellung des deutschen Staates wie auch der deutschen Gesellschaft zu dem Thema, da viele der Ansicht waren, dass „Gäste“ eben nicht auf Dauer bleiben. Als sich Ende der sechziger Jahre die ersten Arbeitsmigranten auf einen dauerhaften Aufenthalt in der BRD einstellten, wurden aus den „Gastarbeitern“ „die Ausländer“. Der Begriff des „Ausländers“ führt zwangsläufig zu einer Aus- bzw. Abgrenzung von Fremden zur Gesellschaft.[22]
Das Problem des „Fremden“ und die Rolle der Medien
Was ist aber das Problem? Warum hört, sieht und liest man in den Medien immer von „gescheiterter Integration“, dem „Ausländer-Problem“?
Liegt es an mangelnden Sprachkenntnissen, an fehlendem Assimlilationswillen? Wollen sich „die Ausländer“ nicht anpassen oder lässt die deutsche Gesellschaft keine Aufnahme zu? Liegt es etwa am Islam, lässt er keine Assimilation zu?
Christoph Butterwegge[23] sieht die Massenmedien als treibende Kraft im Ausgrenzungsprozess von Zuwanderern, „indem sie als Motoren und Multiplikatoren der Ethnisierung wirken“[24]. Dabei beschreibt er „Ethnisierung“ als einen gesellschaftlichen Exklusionsmechanismus, der die Aufnahmegesellschaft in ihren Privilegien bestärkt und durch Stereotypisierung Minderheiten schafft. Das hat zur Folge, dass die nationale Identität gestärkt und „das Andere“, als nicht zur Gesellschaft gehörende Randgruppe deklassiert wird.
Massenmedien haben die Möglichkeit Informationen zu filtern und dadurch das Meinungsbild der Öffentlichkeit im eigenen Interesse, einer westlichen Interessenperspektive, zu prägen und es stark zu beeinflussen.[25]
Die Berichterstattung von Massenmedien begrenzt sich bei Themen über das Ausland und bei Themen über „Ausländer“ in Deutschland meist auf Negatives.
Zuwanderer werden allzu oft mit Begriffen wie Chaos und Gewalt in Verbindung gebracht.[26]
Häufig berichten Zeitungen im Zusammenhang mit ethnischen Minderheiten über Mord, Diebstahl, Bandenraub und Betrug. „Der medial konstruierte, deformierte Fremde ist überflüssig und/oder gefährlich, zu bedauern oder zu fürchten – meistens beides zugleich.“[27]
Kriminelle Deutsche werden überwiegend als Einzeltäter dargestellt, wohingegen das Bild des „kriminellen Ausländers“ eher als eine im Kollektiv auftretende Erscheinung in deutschen Zeitungen zu erkennen ist. Dabei fällt auf, dass bei Verbrechen nichtdeutsche Kriminelle auch als solche ausgewiesen werden, wodurch der Anschein erwirkt wird, „die Amoralität eines Gesetzesbrechers hänge mit dessen Abstammung oder Herkunft zusammen“[28].
Eine anderes Feld der Medienberichterstattung, in dem Massenmedien das Bild von Migranten und Flüchtlingen verzerren bzw. falsch darstellen, ist das Aufbauen einer Drohkulisse vor der die deutschen Ressourcen durch „Asylbetrüger“, „Sozialschmarotzer“ und „Wirtschaftsflüchtlinge“ bedroht sind. Begriffe wie „das Boot ist voll“ oder „Asylantenfluten“ internalisieren eine Bedrohung der „Wohlstandsinsel“ Deutschland.[29]
Seit den 80er Jahren wird in Deutschland der Begriff der „multikulturellen Gesellschaft“ diskutiert, kritisiert und interpretiert. 1998 wurde vom damaligen Berliner Innensenator Jörg Schönbohm und anschließend vom damaligen Vorsitzenden der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, als Gegenmodell der Begriff der „Leitkultur“ geprägt, in dem gefordert wurde, dass sich Migranten einer deutschen Leitkultur anzupassen hätten. Der Multikulturalismus wurde als eine Gefahr dargestellt, aus dem Parallelgesellschaften wachsen, die eine Bedrohung der deutschen Gesellschaft darstellten.
Der Begriff der „deutschen Leitkultur“ wurde somit eine Art Schutzschild, um Überfremdung und „Islamisierung“ vorzubeugen. Der bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber brachte dies mit einer Aussage auf den Punkt:
"Das Christentum unterscheidet sich etwa vom Islam dadurch, dass wir Intoleranz ablehnen, Religionsfreiheit gewähren, die Gleichberechtigung von Mann und Frau vertreten, Zwangsheiraten ganz entschieden nicht billigen.
Für uns ist jeder Mensch einzigartig, jeder Mensch hat Würde, Freiheitsrechte und ist gleichberechtigt."[30] Damit grenzt er die deutsche Gesellschaft klar vom Islam ab und spricht Muslimen jegliche menschliche Eigenschaft ab.
Das Islambild der deutschen Gesellschaft seit dem 11. September 2001
Nach dem 11. September 2001 hat sich das Bild der Muslime weltweit verändert. Innerhalb der deutschen Gesellschaft ist das Bild durch mangelnde Kenntnis über den Islam weiterhin stark von Vorurteilen geprägt. Aus den bisher überwiegenden Differenzen zwischen muslimischer Zuwanderungsgesellschaft und autochthoner Bevölkerung sind Misstrauen und Angst hervorgegangen. Besonders durch terroristisch motivierte Anschläge von scheinbar westlich sozialisierten und integrierten jungen Muslimen, wie zum Beispiel in London im Jahr 2005, verstärkt sich dieses Bild, schürt eine gewisse Angst innerhalb der deutschen Gesellschaft und stellt Muslime insgesamt unter eine Art Generalverdacht. Das Problem besteht darin, dass eine christlich geprägte Mehrheit einer größtenteils türkisch dominierten muslimischen Minderheit gegenübersteht, und diese muslimische Minderheit lange Zeit keine öffentliche Lobby in Anspruch nehmen konnte[31], bzw. diese Lobby kein besonderes Gehör in der deutschen Öffentlichkeit und Medienlandschaft fand. Dieses musste zwangsläufig zu einer einseitigen Darstellung der Differenzen zwischen muslimisch und christlich geprägter Gesellschaft führen. Unkenntnis gegenüber der anderen „Ethnie“ besteht aber auf beiden Seiten. Deutsche hegen Vorurteile gegenüber Türken und umgekehrt. Der Grund für diese Differenzen ist in der öffentlichen Meinung eine mangelnde „Integrationsbereitschaft“ der Migranten, wobei besonders hier der Begriff der mangelnden „Assimilationsbereitschaft“ zu verwenden ist.[32]
Um dies zu verdeutlichen, beziehe ich mich auf drei Studien, in denen Vorurteile von in Deutschland lebenden Muslimen gegenüber Deutschen und umgekehrt untersucht worden sind. Eine der Studien entstand aus einer „repräsentativen Bevölkerungsbefragung im Rahmen des Langzeitprojektes „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF)“[33], die unter anderem untersucht, ob in Deutschland eine „islamophobe“ Einstellung zu erkennen ist. „Islamophobie“bezeichnet die Bedrohungsgefühle und die ablehnenden Einstellungen gegenüber der Gruppe der Muslime, ihrer Kultur und ihren öffentlich- politischen wie religiösen Aktivitäten.“[34] Die Befragung unterteilt sich in die Bereiche „Anteil islamophober Einstellungen“ mit den Subthemen „Generelle Ablehnung von Muslimen in Deutschland“, „Kulturelle Abwertung des Islam“, „Distanzierte Verhaltensabsicht“, und „Ausmaß islamophober Einstellungen“ mit den jeweiligen Subthemen „Homogenisierung des Islam“, „Unterstellte Segregationsleistung“ sowie „Unterstellte Sympathien für Terroristen“. Des Weiteren wurden die Themen „Kontakte muslimischer Befragter zu deutschen Personen“, „subjektiver Grad der Religiosität“ empirisch erfasst.
Nach dieser Studie sind 24% der Befragten der Ansicht, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte.[35] 33 % fühlen sich manchmal wie eine Fremder im eigenen Land, während sogar 74 % der Befragten angaben, die „muslimische Kultur passt [nicht] in unsere westliche Welt.“[36] Dabei hätte fast die Hälfte aller Befragten (46%) ein Problem damit, „in eine Gegend zu ziehen, in der viele Muslime leben“.[37]
Diese Ergebnisse wie auch eine Ablehnung von Muslimen und dem Islam in Deutschland können durch den Befragungsteil „Ausmaß islamophober Einstellungen“ bedingt erklärt werden. In diesen Aussagen ist ein defizitäres Wissen über den Islam und über muslimische Menschen in der Bundesrepublik zu erkennen. Demnach sind für 80% der Befragten die verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam kaum zu unterscheiden, für 72% sind sie sich sehr ähnlich. Die Mehrheit der an der Erhebung Teilnehmenden meint, klare Segregationstendenzen seitens der Muslime zu erkennen. 67% stimmen der Aussage „Die Mehrheit der Muslime hält große Distanz zur restlichen Bevölkerung“ zu, 80%, dass Muslime lieber unter sich bleiben würden.
Eine Bestätigung, dass Muslime in der bundesdeutschen Öffentlichkeit unter einer Art Generalverdacht stehen, kann bei der Befragung zum Thema Muslime und Terror erkannt werden. Fast zwei Drittel (64%) der Befragten stimmen auch der Aussage „die islamistischen Terroristen werden von vielen Muslimen als Helden verehrt“ zu. Dass „islamistische Terroristen“ starken Rückhalt bei Muslimen finden, denken 60%.
Die Untersuchung zeigt deutlich eine abwertende Haltung gegenüber dem Islam und muslimischen Menschen in Deutschland. Sie bestätigt eine von Seiten der deutschen Gesellschaft empfundene Segregation und Ausgrenzung sowie auch die allgemeine Annahme, Muslime sind nicht integrations- beziehungsweise assimilationsbereit. Des Weiteren sind in Teilen Stereotypisierungen im Bezug auf Terror und Islam zu erkennen.
Die Studie sieht als einen Indikator für „Integration“ die Kontakthäufigkeit von Muslimen zu Deutschen, wobei zu erkennen ist, dass die Kontakthäufigkeit – wenn auch nur leicht – seit dem 11. September 2001 abgenommen hat, womit jedoch von diesem Zeitpunkt an Separationstendenzen zu erkennen sind.[38]
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Umfrage über die Einstellung der Deutschen zum Islam, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Mai 2006 im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erhoben hat.[39] Die Frage "Was meinen Sie: Können Christentum und Islam friedlich nebeneinander existieren, oder sind diese Religionen zu verschieden, wird es deshalb immer wieder zu schweren Konflikten kommen?" [40] wurde von 61 % der Befragten bejaht. Die Studie zeigt eine verstärkte Marginalisierung innerhalb der letzten zwei Jahre. 83 % der Befragten gaben an, der Islam sei von Fanatismus geprägt (2004: 75%). Den Islam befanden 71 % als intolerant (2004: 66%), als undemokratisch 60 % (2004: 52 %).
Nur 8 % der Befragten konnten den Islam mit Friedfertigkeit identifizieren, wohingegen 65 % dies mit dem Christentum konnten. Das Bild des Christentums konnte sich generell seit 2004 verbessern.
Die Befragten bescheinigten ihm wesentlich mehr Nächstenliebe, Achtung der Menschenrechte, Friedfertigkeit, Toleranz und Selbstbewusstsein als noch vor zwei Jahren.
Eine Stereotypisierung von Muslimen im Bezug auf Terrorismus ist auch hier zu erkennen. Fast die Hälfte der Befragten stimmte der Aussage zu: "Es leben ja so viele Moslems bei uns in Deutschland. Manchmal habe ich direkt Angst, ob darunter nicht auch viele Terroristen sind." Deutliche Segregationstendenzen sind bei der Frage, ob es einen Konflikt zwischen Christentum und Islam gibt, zu erkennen. 65 % gaben an, es gebe einen solchen, gerade mal 25 % verneinen dies.[41]
Die Untersuchung erkennt ebenfalls einen Prozess der Entfremdung und Marginalisierung zwischen autochthoner und muslimischer Gesellschaft sowie islamophobe Einstellungen und Tendenzen innerhalb der deutschen Gesellschaft, und es lässt sich ein empfundener Konflikt zwischen Christentum und Islam ausmachen.
Auch die Befragung des Zentrum für Türkeistudien (ZfT) in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2002 kommt zu dem Ergebnis, dass der 11. September das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen dauerhaft verändert und sich das Verhältnis verschlechtert hat.[42]
Das ZfT konzentriert sich auf die Religiosität der befragten Muslime und stellt dabei fest, dass sich gerade einmal 7% als sehr religiös bezeichnen, zwei Drittel sehen sich als eher religiös, 29 % empfinden sich als weniger oder gar nicht gläubig.[43]
Das ZfT beobachtet eine Zunahme der Religiosität unter Muslimen seit 2002. Einen eindeutigen Grund kann die Studie nicht aufzeigen, doch gibt ein Viertel der türkischstämmigen Migranten an, sich seit dem 11. September 2001 und den anschließenden Diskussionen, wie auch teilweise persönlichen Angriffen ihnen gegenüber, intensiver mit dem Islam auseinander gesetzt zu haben und sich mit diesem stärker zu identifizieren. Mehr als ein Drittel sah eine zunehmende Fremdheit zwischen muslimischen Türken und Deutschen nach den Anschlägen.
Obwohl sich mehr als die Hälfte (56 %) der Befragten in Deutschland zuhause fühlen, stimmen 70 % der Aussage „Ich fühle mich den Deutschen ziemlich nahe“ nicht zu. Das lässt auf Segregationstendenzen und Marginalisierung schließen, da sich die türkischstämmigen Migranten anscheinend eher an der in Deutschland lebenden türkischen Gemeinschaft orientieren, in dieser verkehren und durch diese ein Heimatgefühl vermittelt bekommen.[44] Auch sind 47% der Meinung, dass „Wir Türken [...] aufpassen [müssen], dass wir nicht allmählich zu Deutschen werden“[45], obwohl wiederum drei Viertel die Meinung ablehnen, dass die Türken unter sich bleiben müssen, um ihre türkische Lebensweise nicht zu verlieren. Dies lässt einen Konflikt innerhalb der Türkischen Gesellschaft zwischen dem bedingten Interesse an Assimilation wie auch Segregation erkennen. (Siehe Abb. 1)
Abb. 1: Zustimmung beziehungsweise Ablehnung zu kultureller Zugehörigkeit und Marginalisierung (Zeilenprozent):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Marginalisierung und Religiosität stehen in engem Kontext: Je religiöser die Befragten, umso weniger fühlen sie sich der deutschen Gesellschaft zugehörig.[46] Die Religiosität hat auch starken Einfluss auf die Segregationstendenzen. Es zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Je religiöser, desto ausgeprägter die Segregationstendenzen.[47]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Marginalisierungsindex nach Religiosität ( Mittelwert*)
Quelle: Zentrum für Türkeistudien: Euroislam
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Segregationsindex nach Religiosität (Mittelwert*)
Der Islam als Integrationbarierre?
Der Islam trennt nicht Sakrales und Profanes, weshalb die Religion eine zentrale Rolle im Alltag der Menschen spielt[48]. Der Glaube hat dadurch einen prägenden Einfluss auf die Identität und das Leben der türkischen Muslime. „Der industrialisierte Westen ist hochgradig säkularisiert. In der islamischen Welt spielt die Religion eine ganz andere Rolle, und das liegt auch an der Natur des Islam: Er durchdringt alle Bereiche des täglichen Lebens.“[49] Der Sozialwissenschaftler Bassam Tibi geht von einer Unvereinbarkeit „authentisch islamischer und westlich-pluralistischer Ansprüche“ aus und sieht ein Zusammenleben von deutschen Christen und türkischen Muslimen als „eine der diffizilsten Herausforderungen an den demokratischen Rechtsstaat“.[50] Sind Religiosität und Tradition also mit Demokratie und Moderne unvereinbar? Und wie lassen sie sich mit einer pluralistischen Gesellschaft verbinden? Hans-Ludwig Frese sieht eine solche Verbindung, indem „islamische Traditionen und ihre Symbole in [einen] modernen Kontext“ gesetzt werden.[51] Er bescheinigt Muslimen allerdings auch auf Dauer nicht integrierbar zu sein, sollte sich die Diskussion über den Islam in Westeuropa vorwiegend auf ein „Fundamentalismus/Unterwanderungs-Paradigma“ beschränken.
Er bezieht sich auf eine Bremer Untersuchung, die eine Rückbesinnung jugendlicher Muslime türkischer Herkunft auf traditionelle Werte nachweisen konnte. So werden familiäre Werte in besonderem Maß geschätzt, häufig außereheliche Sexualität abgelehnt und eine konsumorientierte Gesellschaft kritisiert.[52] Gleichwohl gibt es eine große Zustimmung für Demokratie und pluralistische Gesellschaft.
„Der Rückgriff auf Tradition ist dabei ein Mittel für den Umgang mit Zeit und Raum, das jede einzelne Tätigkeit oder Erwartung in das Kontinuum aus Vergangenheit und Zukunft einbringt, die ihrerseits durch immer wieder eingesetzte soziale Praktiken strukturiert werden. Die Tradition ist nicht völlig statisch, denn sie muss von jeder Generation neu erfunden werden.“[53] Eine Studie des „Zentrum für Türkeistudien“ kommt zu einem anderen Ergebnis. In Bezug auf eine Zunahme der Religiosität von türkischen Migranten seit dem 11. September 2001 heißt es dazu: „Die in [Nordrhein-Westfalen] festgestellte Zunahme der Religiosität erstreckte sich zwar über alle Altersgruppen, in erster Linie betraf sie jedoch die Migranten im mittleren Alter, unter jungen Migranten war dieser Anstieg unterdurchschnittlich.“[54]
Die sich selbst als Islamkritikerin bezeichnende Ayaan Hirsi Ali warnt davor, „dass der Islam mit der liberalen Gesellschaft, wie sie sich im Gefolge der Aufklärung herausgebildet hat, nicht vereinbar ist.“[55] Sie begründet dies damit, dass der Islam keine individuellen Rechte anerkennt und Muslime sich streng an Koran und Hadith zu halten haben. Sie ist der Meinung, dass alles Wissen, das nicht in Koran oder Hadith geschrieben steht, unrein ist und erkennt eine Vorschrift in der Philosophie des Islam, die besagt, dass alle, die dieses unreine Wissen anerkennen oder verbreiten, zu töten sind.
Der größte Teil der rund 1,88 Millionen Menschen mit türkischem Pass sind Sunniten, eine kleinere Gruppe Alleviten.[56] Mit Ausnahme der Schiiten sind die verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam wenig hierarchisch gegliedert, was sich, nach Wolfgang Günter Lerch, im Laufe der letzten Jahre als Nachteil erwiesen hat. Es gibt keinen Dachverband, der für alle Muslime spricht und „vorgibt, was islamisch sei und was nicht.“[57]
Dadurch begründet er eine gewisse „Fundamentalisierung“ des Islams, in dem er sich auf die Londoner Attentäter bezieht: Der Hinwendung zum Islam geht, so Lerch, eine gewisse Entfremdung des Islams voraus, bevor man sich unter irrelevanten Gründen wieder mit der Religion auseinandersetzt. Dabei sieht er die Gefahr, dass Koran und Hadith ohne historischen Kontext gelesen und interpretiert werden, und eine „private“ oder „wilde Theologie“ entsteht.[58]
Der „Zentralrat der Muslime in Deutschland“ (ZMD) versteht sich als „Spitzenverband der islamischen Dachorganisationen in Deutschland“[59]. In der vom ZMD als Reaktion auf die Geschehnisse vom 11. September 2001 herausgegebenen Charta, einer Art Grundsatzerklärung der Muslime in Deutschland, bekennt er sich repräsentativ für die in Deutschland lebenden Muslime zu Demokratie und Rechtsstaat. Die Charta, von vielen Medien als Integrationsangebot verstanden, versucht auch das stereotype Bild der „radikalen Muslime“ zu berichtigen und einen Generalverdacht gegen in Deutschland lebende Muslime zu unterbinden. Nach der Charta verpflichtet „das islamische Recht […] Muslime in der Diaspora, sich grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zu halten.“[60] Solange Muslimen die Religionsausübung garantiert wird, können sie, so der ZMD, in jedem nicht muslimischen Land leben. Sollte dies nicht gewährt sein, „darf er dennoch nicht gegen diese Staatsanordnung mit Gewalt vorgehen. Er soll seine Freiheit durch Überzeugung oder durch Auswanderung erlangen.“[61]
Frank Meng erkennt, in Anlehnung an Bassam Tibis These, wesentliche Probleme in der Vereinbarkeit zwischen „authentischem“ Islam und pluralistischer, demokratischer Gesellschaft: Da der Koran ohne historischen Kontext gelesen und interpretiert wird, wird der „Fundamentalismus als Weltsicht unter Muslimen zur Hauptquelle ihrer Denkweise“[62]. Dies liegt an der fehlenden Aufklärung im Islam.
Des Weiteren geht er von einer Unvereinbarkeit zwischen Schari’a, „ein überragendes Fragment des Glaubensverständnisses der Muslime“[63], und elementaren Menschenrechten aus. Und er sieht im Islam auf Grund der Tatsache, dass Mohammed in der islamischen „Urgesellschaft von Medina“ religiöser und weltlicher Führer war, eine politische, absolutistische Ideologie.[64]
Fazit
Wenn über Integration gesprochen wird, sollte eher der Begriff der Assimilation verwendet werden, weil sowohl von der deutscher Gesellschaft an die Migranten als auch umgekehrt kein beiderseitiges Anpassen gewünscht wird. Deutsche Politik und Medien präferieren ein Annehmen von Werten und Normen der Majorität. Allerdings entsteht hier ein gravierendes Problem. Es ist nahezu unmöglich, sich in alle Bereiche einer pluralistischen Gesellschaft einzugliedern. Sowohl für Deutsche als auch für Zuwanderer. Allerdings ist es besonders wichtig, dass die Traditionen und Werte sowie die dazugehörige Lebensweise der Zuwanderer nicht verschwinden. Migranten müssen dieselben Chancen in den Bereichen Bildung, Wohn- und Arbeitsmarkt, wie auch bei der Besetzung gesellschaftlicher Positionen erhalten wie die autochthone Bevölkerung. Von der Zuwanderungsgesellschaft ist eine kognitive Assimilation zu erwarten. Ohne das Erlernen der deutschen Sprache, als auch der Kenntnis von grundlegenden Normen und Werten, wie zum Beispiel einem Mindestwissen über den demokratischen Rechtsstaat und dessen Eigenschaften und Wirkungsweisen ist eine identifikative Assimilation und ein Zusammenleben auf Dauer nicht möglich. Auf der anderen Seite muss eine Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft vorliegen. Und diese muss weitergehen als das „zur Kenntnis nehmen“ von Zuwanderern. Besonders im Bezug auf muslimische Migranten müssen sich Medien und Politik mehr mit dem Islam – der Geschichte und der Tradition – auseinandersetzten. Eine Stereotypisierung zugunsten von Einschaltquoten- oder Auflagenmaximierung ist unverantwortlich und zieht weit reichende Folgen nach sich. Die von Butterwegge beschriebene Ethnisierung erschwert eine Assimilation und das Zusammenleben von Majorität und Minorität enorm, sie macht diese unmöglich. Solange Migranten in der deutschen Öffentlichkeit durch Medien und Politik von der deutschen Gesellschaft abgegrenzt und als „Fremde“ „deklassiert“ werden, wird es keine ausreichende Akzeptanz ihnen gegenüber geben. Dieser Exklusionsmechanismus ist vor allem seit den Anschlägen vom 11. September 2001 wieder vermehrt zu entdecken. Muslime werden unter eine Art Generalverdacht gestellt, was zu einer verstärkten Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie führt.
Der Grund dafür ist ein defizitäres Wissen über den Islam und der dazugehörigen traditionellen Lebensweise und Wertevorstellung. Dies führt zu einer Abgrenzung zwischen Türken und Deutschen. Dabei geht es weniger um Nationalitäten als vielmehr um Religion. Christen und Muslime werden gläubiger, was erhebliche Vorteile allerdings auch Nachteile bringen kann. So kann auch die Identifikation mit der eigenen Religion als Exklusionsmechanismus wirken, da, wie oben angeführt, Muslime in der deutschen Öffentlichkeit unter eine Art Generalverdacht im Bezug auf Terrorismus gestellt werden, ihnen Rückständigkeit im Bezug auf demokratische Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte unterstellt wird, sich gleichzeitig aber die Einstellung der autochthonen Bevölkerung zum Christentum sehr zum Positiven wendet. Ich möchte nicht behaupten, dass dies zu einem „Konflikt der Religionen“ führen muss, es ist aber nicht auszuschließen.
Verhindert der Islam eine Assimilation an die deutsche Gesellschaft? Da der Islam theoretisch alle Bereiche des täglichen Lebens von Muslimen durchdringt, ist eine Trennung zwischen Religion und alltäglichem Handeln – theoretisch – nicht möglich. Von der Annahme ausgehend, dass „authentisch islamische und westlich-pluralistische Ansprüche“[65] unvereinbar sind, erscheint ein Zusammenleben unmöglich. Auch wenn bereits ein Modernisierungsprozess des Islams in Deutschland eingesetzt hat, besteht noch immer Reformbedarf. So muss die Scharia bekennend abgelehnt und die laizistische Ordnung nicht nur anerkannt, sondern vor allem auch verstanden und umgesetzt werden. Dabei kommt es vor allem auf die muslimischen Spitzenverbände in Deutschland an. Sie müssen sich sowohl in der Deutschen Öffentlichkeit als auch unter den Muslimen in Deutschland stärker etablieren und eine Gewisse Führungsrolle einnehmen, um sinnvoll Reformen durchsetzen zu könne.
Da die Vermutung nahe liegt, auf Grund dieser Tatsachen sei eine Assimilation nicht möglich, sollte allerdings bedacht werden, dass sich nur 7 % der in Deutschland lebenden Muslime als „sehr religiös“ bezeichnen, der größte Teil aber zu demokratischer Grundordnung und pluralistischer Gesellschaft bekennt und sich „in Deutschland zu Hause [fühlt]“.[66]
Quellenangabe:
Monographien und Sammelbände:
Bade, Klaus J./Bommes, Michael/Münz, Rainer, (2004): Migrationsreport 2004. Fakten – Analysen – Perspektiven, Frankfurt/Main
Bade, Klaus J./Münz, Rainer(2002): Migrationsreport 2002, Farnkfurt/Main
Boztepe, Ahmet Fuat (2006): Türken in Deutschland, in: Integration und Islam, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.)
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.) (2004): Migration, Integration und Asyl in Zahlen, Bonn
Bundesministerium des Innern (Hrsg.) (2005), Referat Öffentlichkeitsarbeit : Zuwanderungsrecht und Zuwanderungspolitik, Berlin
Butterwegge, Christoph (2003): Das mediale Bild der Migrant(inn)en und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland, in: Forum 2003: Social cohesion or public security: How should Europe respond to collective feelings of insecurity?
Eder, Klaus / Rauer, Valentin / Schmitdke, Oliver (2004): Die Einhegung des Anderen. Türkische, polnische und russlanddeutsche Einwanderer in Deutschland, Wiesbaden
Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Nr 40, Mannheim
Felbinger, Hartmut (2005): Kontinuität und Wandel türkischer Volkskultur durch Migration, Bamberg
Frese, Hans-Ludwig (2004) „Moderne Muslime”, in: Luchesi, Brigitte & Kocku von Stuckrad (Hrsg.), Religion im kulturellen Diskurs. Festschrift für Hans G. Kippenberg zu seinem 65. Geburtstag (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, vol. 52), Berlin & New York, S. 439-454.
Gestring, Norbert (2006): Prozesse der Integration und Ausgrenzung, Wiesbaden
Graduszewski, Anja / Vettermann, Jörg (Hrsg.) (2002): „Fremder, kommst du nach Deutschland…“, Zum institutionellen Umgang mit Fremden in Staat und Gesellschaft. Berliner Kriminologische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Praxisorientierte Kriminalforschung e.V. Band 4, Münster
Hillmann, Karl-Heinz (1994): Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart
Koch-Arzberger, Claudia (1985): Die schwierige Integration, Die bundesrepublikanische Gesellschaft und ihre 5 Millionen Ausländer. Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung 80, Opladen
Koller, Barbara (1997): Aussiedler der großen Zuwanderungswellen – was ist aus ihnen geworden? * die Eingliederungssituation von Aussiedlerinnen und Aussiedlern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 30, H. 4. S. 766-789
Der Koran (1960), Stuttgart
Meng, Frank, (2004): Islam(ist)ische Orientierungen und gesellschaftlich Integration in der zweiten Migrantengeneration. Eine Transparenzstudie, in: Bremer Beiträge zur politischen Bildung 1/2004, Bremen
Ottenschläger, Madlen (2004): „Da spürt man irgendwie Heimat“. Eine qualitative Studie zur Mediennutzung von Türken und Deutsch-Türken der Zweiten Generatiom in Deutschland, Münster
Papamichou, Maria (2005): Massenmedien und ethnische Minderheiten in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung griechischer Bevölkerungsteile. Partizipationsmöglichkeiten, Probleme und Perspektiven unter sozialpädagogischem Aspekt, Athen/Köln
Pinn, Irmgard (2002): “Gastarbeiter“ kamen – Muslime sind geblieben. Migranten und Migrantinnen aus muslimischen Ländern in den deutschen Medien, Köln
Schulte, Axel (2002): Integrations- und Antidiskriminierungspolitik in Einwanderungsgesellschaften: Zwischen Ideal und Wirklichkeit der Demokratien, Bonn
Sen, Faruk et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen
Schimmel, Annemarie (1990): Die Religion des Islam. Eine Einführung, Stuttgart
Sökefeld, Martin (Hrsg.) (2004): Jenseits des Paradigmas kultureller Differenz. Neue Perspektiven auf Einwanderer aus der Türkei, Bielefeld
Weber, Katrin (2003): Integration „in deutschem Interesse“, in: Projekttutorien „Lebenswirklichkeiten von Flüchtlingen in Berlin“/„Behörden und Migration“ (Hrsg.): Verwaltet, entrechtet, abgestempelt – wo bleiben die Menschen? Einblicke in das Leben von Flüchtlingen in Berlin, Berlin, S165-173
Weidacher, Alois [Hrsg.] (2000): In Deutschland zu Hause. Politische Orientierungen griechischer, italienischer, türkischer und deutscher junger Erwachsener im Vergleich, Opladen
Yousefi, Hamid Reza / Braun, Ina (2005): Interkulturelles Denken oder Achse des Bösen. Das Islambild im christlichen Abendland, Bausteine zur Mensching-Forschung Bd. 8, Nordhausen
Zeitungen und Zeitschriften:
Aust, Stefan; Follath, Erich( 2006): „Islam heißt Vernunft“, Karim Aga Khan IV., Nachfahre des Propheten und geistliches Oberhaupt von 20 Millionen Ismailiten, über die Grundsätze seines Glaubens, den Streit um die Papst-Vorlesung sowie die Chancen, einen Krieg der Religionen zu vermeiden, in: Der Spiegel (41/2006)
Butterwegge, Christoph (2002): Globalismus, Neoliberalismus und Rechtsextremismus, in: UTOPIE kreativ 135 (Januar 2002), S. 55-67
Die schleichende Machtübernahme. Die Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali warnt davor, sich von muslimischen Friedensbeteuerungen einlullen zu lassen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (04.10.2006) : S. 39
Elisabeth Noelle/Thomas Petersen (2006): Eine fremde, bedrohliche Welt. Die Einstellungen der Deutschen zum Islam, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (17.05.2006), S.5
Leibol, Jürgen / Kühnel, Steffen / Heitmeyer, Wilhelm (2006): Abschottung von Muslimen durch generalisierte Islamkritik? In: Parallelgesellschaften? Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 1-2/2006)
Wolfgang Günter Lerch (2005): Vom "wilden" Islam. Am Terrorismus ist auch mangelndes religiöses Wissen schuld, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (19.07.2005):. S. 10
Internetquellen:
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.: Selbstdarstellung: http://zentralrat.de/2594.php [01.10.2006]
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.: Islamische Charta: http://zentralrat.de/3035.php [01.10.2006]
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. : 10. Muslime in nichtislamischen Ländern: http://islam.de/1641.php#deutsch/Muslime_in_nichtisl_Laendern.html [01.10.2006]
Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.: "Herr Stoiber, das Maß ist voll!": http://zentralrat.de/6725.php [01.10.2006]
Abbildungsverzeichnis:
Abb.1 : Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen, S 37
Abb. 2: Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen S 38
Abb. 3: Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen S 39
Integration ethnischer Minderheiten
Im Kontext von ethnischer Schichtung und Ethnisierung
Rieke Leemhuis, 2006
Einleitung
Zunehmende kommt es zu Debatten über Integrationsschwierigkeiten ethnischer Minderheiten. Es ist in den Medien vom „Ende der Multikulti -Lüge“ von „Parallelgesellschaften“ und von der „Integrationsunwilligkeit“ ethnischer Minderheiten die Rede.
Die Integration vor allem von Zuwanderer- Minderheiten wird als soziales Problem thematisiert, das gesamtgesellschaftliche Folgen hat und Maßnahmen erfordert.
Die Debatte geht teilweise von einer mangelnden Integrationsbereitschaft der Minderheitsgesellschaft aus und kritisiert die Bildung ethnischer Kolonien, den Rückzug in die eigene ethnische Gruppe und den Widerstand gegen kulturelle Muster des Aufnahmelandes.
In dieser Arbeit möchte ich nun den Hintergründen dieses sozialen Problems auf den Grund gehen. Schwerpunkte bilden in diesem Zusammenhang die ethnische Schichtung sowie Prozesse der Selbst –und Fremdethnisierung und die Folgen auf die Integration von ethnischen Minderheiten.
Zunächst werde ich versuchen, den Begriff „soziales Problem“ zu umreißen, um dann die Integration ethnischer Minderheiten in den Kontext sozialer Probleme einzuordnen. Im Folgenden werde ich eine Definition von ethnischen Gruppen, ethnischen Minderheiten und Ethnizität geben. Dann werde ich das Integrationskonzept Hartmut Essers vorstellen. Darauf werde ich den Prozess der ethnischen Schichtung und seine Folgen auf die Integration schildern. Im Anschluss werde ich dann Prozesse der Zuschreibung ethnischer Zugehörigkeit durch die Mehrheitsgesellschaft und durch die Gruppe der ethnischen Minderheit mit ihren Folgen erläutern.
Deutlich werden sollen die Auswirkungen von Ethnischer Schichtung und Ethnisierungsprozessen auf die Integration. Integration soll als soziales Problem bearbeitet werden, welches im gesellschaftlichen Kontext steht und Thema politischer Diskurse und Debatten ist. In diesem Zusammenhang soll auch die strategische Nutzung und mediale Verarbeitung des sozialen Problems klar werden.
Soziale Probleme
Der gemeinsame Hauptaspekt im Bezug auf eine Theorie sozialer Probleme ist die kollektive Definition eines sozialen Tatbestandes als soziales Problem. Strittig ist, ob und in welche Weise diese kollektive Definition auf konkreten gesellschaftlichen Bedingungen aufbaut oder ob soziale Probleme unabhängig davon konstruiert werden. Unabhängig von dieser Diskussion lassen sich drei Elemente von sozialen Problemen festhalten.
Das erste Element eines sozialen Problems ist der Bezug auf bestimmte soziale Bedingungen, Strukturen oder Situationen, die als Störung, Widerspruch oder Funktionsproblem der Gesellschaft analysiert werden können. Das zweite Element ist die Wahrnehmung, Benennung oder kollektive Definition als soziales Problem. Das dritte Element ist die Wahrnehmung der Notwendigkeiten von Veränderung der Situation und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen und Politik (Groenemeyer 18 ff).
Im kollektiven Definitions- Prozess setzen sich verschiedene Akteure mit verschiedenen Definitionspotentialen und Ressourcen (wie z. B Macht) dafür ein um bestimmte Deutungsmuster und Sachverhalte als Soziale Probleme in den öffentlichen und politischen Arenen zu platzieren. Soziale Probleme können demnach auch strategisch genutzt werden .Sie sind häufig das Ergebnis von Interessendurchsetzungen und eingebettet in Ideologien. Soziale Probleme sind damit „ Bestandteil gesellschaftlicher Auseinandersetzung und politischer Konflikte, in denen die Art und das Ausmaß der Thematisierung sozialer Probleme entwickelt wird“ (Groenemeyer 1999: 20).
Ethnische Minderheiten und Integration als soziales Problem
Die vorliegende Arbeit behandelt einen Teilbereich der sozialen Problematik ethnischer Minderheiten. Das soziale Problem, dass hier analysiert werden soll, wird in der medialen Debatte teilweise als „Integrationsunwilligkeit“ ethnischer Minderheiten und Migranten thematisiert. Wertfreier kann man von der Integrationsproblematik ethnischer Minderheiten sprechen.
Diese Problematik beinhaltet die räumliche Segregation von ethnischen Minderheiten, der Widerstand gegen kulturelle Muster der Mehrheitsgesellschaft, den Rückzug in die eigene ethnische Gruppe und weitere Problembereiche, die in der These münden, dass in Deutschland ein soziales Problem im Bezug auf die Integration von Minderheiten vorliegt. Die öffentliche Diskussion von den Problemen „der Rütli Schule“, „Ehrenmorden“ und mangelnden Sprach- und Bildungskompetenzen ethnischer Minderheiten fällt in diesen Komplex.
Zu beobachten ist, dass weniger die objektiven Problemlagen des Problems der Integration öffentlich debattiert werden, als die Auswirkungen ebendieser. In dieser Arbeit möchte ich mich nun den Hintergründen dieser Integrationsproblematik zuwenden, die ich in ethnischer Schichtung und Ungleichheit, sowie in Ethnisierungsprozessen sehe.
Ethnische Gruppen, ethnische Minderheiten und Ethnizität
Ethnische Gruppen sind Teilbevölkerungen von staatlich verfassten Gesamtgesellschaften. Diese Teilbevölkerungen sind wiederum Angehörige eines Volkes oder Teile von Völkern. Ethnische Gruppen haben eine Vorstellung einer gemeinsamen Herkunft, sowie ein Zusammengehörigkeitsbewusstsein und sind durch Gemeinsamkeiten von Geschichte und Kultur gekennzeichnet. Ein kollektives Bewusstsein entsteht aus der Gruppe selbst und durch Zuschreibungen von außen, genauer seitens anderer Gruppen (Heckmann 1992: 55).
Die klassische Definition einer ethnischen Gruppe formulierte Max Weber:
„Wir wollen solche Menschengruppen, welche auf Grund von Ähnlichkeiten des äußeren Habitus oder Sitten oder beider Erinnerung an Kolonisationen und Wanderung einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, derart, dass dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftung wichtig wird, dann, wenn sie nicht Sippen darstellen, ethnische Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsverwandtschaft objektiv vorliegt oder nicht “(Weber 1972:237). Ethnische Gruppen existieren also nicht von sich aus, sondern sie entstehen durch bestimmte Definitions- und Zuschreibungsprozesse.
Ethnische Minderheiten sind nun ethnische Gruppen mit spezifischen Merkmalen. Der Begriff der Minderheit meint zum einen die ethnische Andersartigkeit gegenüber der ethnischen Gruppe der Mehrheits-Gesellschaft.
Hier spielt die Ethnizität eine wichtige Rolle im Bezug auf Zuordnung zur ethnischen Minderheiten Gruppe, die durch die Mitglieder der ethnischen Gruppe selbst und durch die Mitglieder der Gruppe der ethnischen Mehrheit erfolgt. “ Ethnizität bezeichnet handlungsrelevante Tatsache, dass eine relativ große Gruppe von Menschen durch den Glauben an eine gemeinsame Herkunft, durch Gemeinsamkeiten von Kultur, Geschichte und aktuellen Erfahrungen verbunden sind und ein bestimmtes Identitäts- und Solidarbewusstsein besitzen“ (Heckmann 1992: 56).
Ethnizität ist ein auch Mittel zur Aufrechterhaltung sozialer Grenzen im Kontakt zu anderen Gruppen. Diese Grenzen konstruieren sich im Wechselspiel zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung. Die Kategorie Ethnizität ermöglicht die Bildung ethnischer Kollektive. Dies eröffnet ethnischen Minderheiten neue Möglichkeiten der Allianzenbildung. Menschen, die sich einer bestimmten ethnischen Gruppe zugehörig fühlen, können sich zusammenschließen um gemeinsame Ziele zu verfolgen, wobei dieser Zusammenschluss relativ unabhängig davon ist, wie sehr sie privat in der jeweiligen Sprache, Religion und Kultur der ethnischen Gruppe verankert sind (Heinemann2001: 113).
Weiterhin meint der Minderheitenbegriff eine mit der ethnischen Zugehörigkeit verbundene Benachteiligung, Diskriminierung und Stigmatisierung. Ethnische Minderheiten sind also „innerhalb eines Systems ethnischer Schichtung benachteiligte, unterdrückte, diskriminierte und stigmatisierte ethnische Gruppen“ (Heckmann 1992:56).
Es lassen sich verschiedene Typen ethnischer Minderheiten unterscheiden: nationale und regionale Minderheiten, Einwandererminderheiten, kolonisierte Minderheiten und neue soziale Minderheiten (Heckmann 1992: 58). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Einwanderminderheiten und ihre Nachkommen. Hier vor allem auf die Nachkommen der Arbeitsmigranten[67].
Integration ethnischer Minderheiten
Es gibt zahllose Modelle zur Eingliederung von Einwanderern und ethnischen Minderheiten. Ich werde meine folgenden Ausführungen auf das Modell von Hartmut Esser stützen, da es im Sinne der handlungstheoretischen Konzeption Barrieren und Opportunitäten der Eingliederung aufzeigt und auch Ethnizität ein wichtiger Teil des Konzeptes ist.
Die soziale Integration von „Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten“[68] lässt sich mit Essers Konzept der Unterscheidung von vier Formen der Integration beschreiben: Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation. Mit Kulturation (kultureller Assimilation) ist der Erwerb kognitiver Fähigkeiten gemeint, die Individuen zur gesellschaftlichen Teilhabe benötigen. Unter Platzierung (strukturelle Assimilation) wird die Einnahme sozialer Positionen verstanden, die sich vor allem aus der Stellung in der Hierarchie des Arbeitsmarktes ergibt. Mit Interaktionen (soziale Assimilation) werden soziale Kontakte, die Einbindung in soziale Netzwerke sowie die Partizipation in der Öffentlichkeit charakterisiert, und bei der Identifikation (identifikative Assimilation) geht es um die subjektive Verortung von Individuen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Dabei entstehen Wechselwirkungen zwischen den Integrationsdimensionen.
Ein gewisser Grad an kultureller Assimilation muss zum Beispiel vorhanden sein, damit sich die Person auf dem Arbeitsmarkt und hinsichtlich sozialer Beziehungen integrieren kann; zugleich sind Beziehungen zur Aufnahmegesellschaft – wie zum Beispiel zum Arbeitsmarkt – zum Erwerb von kognitiven Fähigkeiten (z. B Sprachkenntnisse) notwendig (Janssen, Polat 2005: 4).
Der Fall einer „vollständigen“ Assimilation liegt für Esser dann vor, wenn alle vier Assimilationsstufen manifestiert sind. Das heißt, wenn die Sprache des Aufnahmelandes und seine sozialen Normen beherrscht werden, eine gesellschaftliche Teilhabe am Statussystem besteht, interethnische Kontakte vorliegen und die Selbstidentifikation mit der Mehrheitsgesellschaft erfolgt ist. In Essers Konzept ist allerdings auch eine partielle Assimilation auf einzelnen Dimensionen vorgesehen (Pott 2002:45).
Auch sieht Esser die erwähnten Formen der Assimilation nicht einzige mögliche Ausgänge eines Integrationsprozesses.
Er entwirft drei Alternativen zur Assimilation. Zum einen gibt es die Mehrfachintegration –als die Gleichzeitigkeit von Beziehungen zur Herkunftsgesellschaft oder ethnischen Gemeinde und zur Aufnahmegesellschaft, also eine doppelte Sozialintegration. Der zweite Typ, die ethnische Segmentation bedeutet die ethnische Binnenintegration bei gleichzeitiger Exklusion aus den verschiedenen Bereichen der Aufnahmegesellschaft.
In der Segmetation sieht Esser eine Gefahr. Der ausschließliche Bezug des Migranten auf die ethnische Gemeinde bedeute eben nicht nur die Nichtintegration in das Aufnahmeland, sondern eine „ dauerhafte Alternative der Lebensgestaltung“. Die Ethnische Gemeinde können daher der Ausgangspunkt auch zu einer dauerhaften Segmentation der ethnischen Gruppen werden (Esser 2001: 19).
Im Gegensatz zu z. B Heckmann[69] geht Esser besonders im Falle der zweiten und dritten Generation von Zuwandererminderheiten, von einer eingliederungshemmenden Wirkung ethnischer Kolonien und räumlich segregierter ethnischer Gemeinschaften aus.
Als dritten möglichen „Ausgang“ des Integrationsprozesses skizziert Esser die Marginalisierung von Akteuren in allen Bereichen. Dieses Szenario ist als Ausgang eher für die zweite und dritte Generation von Einwandererminderheiten zu erwarten, wenn es ihnen weder möglich ist in der Mehrheitsgesellschaft Fuß zu fassen, noch die Kultur der Herkunftsgesellschaft (ethnische Gruppe) ausreichend Halt bietet.[70]
Insgesamt sieht er ethnische Selbstbeschreibungen (Selbstehtnisierung), also das Rekurrieren auf die Ethnizität und die räumliche Konzentration von ethnischen Gruppen als Indikatoren für eine unvollständige Eingliederung in die Mehrheitsgesellschaft.
Diese Eingliederung wird durch die Handlungen der Migranten, aber auch durch die Opportunitäten und Barrieren, die in der Mehrheitsgesellschaft im Bezug auf assimilatives Verhalten vorhanden sind, bestimmt (Esser 1980 149 ff).
Ethnische Schichtung
Mit Ethnischer Schichtung wird das Vorliegen systematischer vertikaler sozialer Ungleichheiten zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in sozialstrukturellerHinsicht bezeichnet. Hier geht es insbesondere um die Verfügung über Ressourcen und Markt- bzw. Organisationsmacht, etwa nach der durchschnittlichen Bildung, den ausgeübten Berufen, dem Einkommen, der Beteiligung an öffentlichen Angelegenheiten, auch in Hinsicht auf die politische Partizipation und Repräsentation (Esser 2001: 33). Ethnische Schichtung meint also, dass zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen ein strukturelles Ungleichheitsverhältnis besteht. In ethnisch geschichteten Gesellschaften erfolgt die Positions- und Statuszuweisung auf der Basis von ethnischer Zugehörigkeit (Steinbach 2004: 81).
Die Entstehung ethnischer Schichtungen kann als Unterschichtung der einheimischen Bevölkerung durch ethnische Minderheitengruppen verstanden werden, die sich kulturell, im Bezug auf ökonomische Funktionen und in ihrem Status systematisch von der übrigen Bevölkerung unterscheiden. Es ist eine „Art von Kastenbildung inmitten einer ansonsten modernen Gesellschaft“ (Esser 2001: 35).
Ethnische Differenzierungen und ethnische Schichtungen sind keine „stabilen“ Strukturen, sondern werden durch alltägliche Handlungen und Interaktionen im Alltag immer wieder neu konstituiert. In einer groben Einteilung lassen sich nach Esser zwei Mechanismen und Prozesse der Konstitution ethnischer Schichtungen benennen: soziale Distanzierungen der Gruppen untereinander und ihre Segmentation voneinander.
Soziale Distanzierungensind Prozesse der externenGrenzziehung (siehe Fremdethnisierung). Es gibt sie in der Form distanzierender Einstellungen, als Vorurteile, und als diskriminierende Handlungen (Esser 2001: 38).
Die Segmentation ethnischer Gruppen ist ein Prozess der „freiwilligen“ Distanzierung von der umgebenden Gesellschaft durch den Zusammenschluss nach innen ( Siehe Selbstethnisierung ). Sie gibt segmentierenden Wirkungen jeweils gesteigerten Formen: als räumliche Segregation, als kulturelle Segmentation und als die Institutionalisierung einer ethnischen Gemeinde (Esser 2001: 39).
Die räumliche Segregationist die Konzentration bestimmter ethnischer Gruppen auf bestimmte Regionen oder Stadtteile.
Die räumliche Segregation hat verschiedene Ursachen, die nur kurz angerissen werden sollen. Die Konzentration ethnischer Gruppen in städtischen Quartieren kann zum einen die Folge von Diskriminierungen, etwa auf dem Wohnungsmarkt, sein. Andererseits wirken indirekte Prozesse. Einer davon ist die durch Hintergrundmerkmale erzeugte systematische räumliche Verteilung, etwa dadurch, dass die Angehörigen ethnischer Minderheiten nur bestimmte Mieten zu zahlen in der Lage sind und sich über die Einkommensunterschiede zu den Einheimischen auf indirekte Weise auf typische Quartiere mit niedrigen Mieten und schlechter Wohnqualität konzentrieren. Ein zweiter Vorgang ist der so genannte Invasions-Sukzessions-Zyklus: Mit dem Einzug einer ausländischen Familie in ein bestimmtes Haus einer bis dahin von Einheimischen bewohnten Gegend kann ein auf negativen Distanzierungen beruhender Prozess ausgelöst werden, bei dem im Anschluss daran einheimische Familien ausziehen, deren leerstehende Wohnung den Anlass für den Einzug weiterer ausländischer Familien gibt (Esser 2001: 39).
Mit kultureller Segmentation sind die Orientierung an und das Verbleiben in der ethnischen Herkunftsgesellschaft gemeint.
Räumliche Segregationen und kulturelle Segmentationen verstärken sich gegenseitig: Segregationen fördern über die räumliche Konzentration der ethnischen Gruppe der Akteure kulturelle Segmentationen, und die kulturellen Segmentationen verstärken wiederum die räumlichen Segregationen. Besonders bei zahlenmäßig großen Gruppen von ethnischen Minderheiten wird es auf dieser Grundlage dann auch wahrscheinlich, dass sich eine mehr oder weniger ausgebaute und vollständige ethnische Kolonie institutionalisiert. Das Verbleiben in der ethnischen Kolonie wird von Esser und anderen als Mobilitätsfalle verstanden, die die Grenzen des Schichtungssystems undurchlässiger macht. So ermöglicht das Positionierungssystem der eigenen ethnischen Minderheitengruppe, im Vergleich zu dem der Mehrheitsgesellschaft nur marginale Platzierungen (Esser 2001:40).
Ethnische Schichtung in der BRD
Ethnische Minderheiten sind im Vergleich zur deutschen Merheitsgesellschaft strukturell benachteiligt. So besitzen Angehörige ethnischer Minderheiten z.B. ein geringeres durchschnittliches Bildungsniveau und Einkommen als Deutsche, leben in wesentlich beengteren Wohnverhältnissen und müssen zumeist höhere Mieten zahlen. Jeder fünfte Schüler, der aus einer Zuwandererfamilie stammt, bleibt ohne Schulabschluss. Bundesweit können 40 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund keinerlei berufliche Qualifizierung vorweisen. Des Weiteren weisen ethnische Minderheiten eine um 80 % höhere Arbeitslosenquote und eine dreifach höhere relative Armutsquote als Deutsche auf (Geissler 2002: 294 ff).
Da die BRD durch eine anhaltende ökonomische Stagnation und eine negative demographische Entwicklung, sowie eine zunehmende soziale Desintegration, die ohnehin eine Verschärfung der innergesellschaftlichen Konkurrenzen bewirkt, gekennzeichnet ist, sind (ethnische) Unterschichtungstendenzen verstärkt festzustellen. In der BRD ist auch zunehmend eine räumliche Segregation zu beobachten. Es sind Stadtviertel entstanden in denen eine räumliche Konzentration von ethnischen Minderheiten, Arbeitslosigkeit und Armut aufeinander treffen[71]. Die Situation von Ausländischen Jugendlichen in den segregierten Armutsgebieten ist besonders schwierig. Zuschreibungen von außen werden übernommen und in die eigene Identität eingebaut. Diskurse in Zeitungen über die Entstehung von Ghettos haben die Jugendlichen in ihrem Selbstbild beeinflusst, sie sprechen von sich selbst als „Ghetto-Kids“. Arbeitslosigkeit, beengte Wohnverhältnisse und räumliche Isolation prägen den Alltag (Häußermann 2000: 216).Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit wächst das ethnische Gewerbe. Der Versuch, durch Selbstständigkeit der wachsenden Arbeitslosigkeit zu entgehen, ist allerdings für die meisten nur durch geringe Gewinne und die Mithilfe von Familienangehörigen möglich (Häußermann 200:217).
Folgen ethnischer Schichtung auf die Integration
Die ethnische Schichtung kann sich in ihren Folgen auf die Integration vor allem in zwei Bereichen aus. Zum einen hat es eine direkte Wirkung auf die die ethnische Minderheit und auf das Konfliktpotential zwischen Minderheit und Mehrheit
Die ethnische Schichtung fördert die Konzentration bestimmter ethnischer Gruppen in bestimmten Arbeitsbereichen, Wohnviertel etc. Durch die Verbindung von ethnischer Zugehörigkeit und Klassenzugehörigkeit werden Tendenzen zur Schließung und zur Stabilisierung der Binnenstruktur verstärkt. Folgen können räumlich und kulturelle Segmentation sein. Sowohl räumliche und kulturelle Segmentation erschweren die kulturelle, strukturelle, soziale, und letztlich auch identifikative Assimilation (Steinbach 2004: 85).
In einer Gesellschaft, in der die politischen und ökonomischen Partizipationsmöglichkeiten für Minderheiten stark eingeschränkt sind, bekommt die ethnische und kulturelle Identität eine größere Rolle. Mit der zunehmenden räumlichen Segregation, dem Ausschluss vom Arbeitsmarkt (strukturelle Assimilation) und steigender Arbeitslosigkeit werden interethnische Kontaktmöglichkeiten (soziale Assimilation) verringert. Die eigene ethnische Identität und das Wohnquatier werden und bleiben die Hauptbezugspunkt für die Identifikation (kulturelle und identifikative Assimilation). Es entstehen Stadt- Räume der „Isolation und Benachteiligung“ (Häußermann 200: 119)
Eine zweite Wirkung ethnischer Schichtung bezieht sich auf das Konfliktpotential zwischen Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft. Wenn Angehörige der Minderheitengruppe realisieren, dass sie im System der ethnischen Schichtung benachteiligt werden, kann das dazu führen, dass versucht wird, die Wirkungsmechanismen der Schichtung zu bekämpfen. Da die auf selbst und Fremdzuschreibung basierende ethnische Zugehörigkeit (siehe unten) allerdings nicht verändert werden kann, ist es für die betroffenen Personen nicht möglich die Benachteiligungen durch eigene Anstrengungen zu überwinden. Da das ungleiche Machtverhältnis bestehen bleibt, bleibt der ethnischen Minderheit oftmals, trotz assimilativer Handlungsabsichten eine Teilhabe an Ressourcen der Mehrheitsgesellschaft verwehrt (Esser 1980:204). Dies führt dann zu einer anomischen Situation[72], die abweichendes Verhalten begünstigen kann. Orientiert man sich hier an Merton[73] kann dieses die Formen Ritualismus, Rückzug, Innovation oder Rebellion annehmen (Heckmann 1992: 95).
[...]
[1] In der Türkei besteht bereits seit 1923 eine Trennung zwischen Staat und Religion.
[2] Vgl. Gestring, Norbert (2006): Prozesse der Integration und Ausgrenzung, Wiesbaden, S.11.
[3] Ich beziehe mich der Einfachheit halber auf die deutsche Gesellschaft.
[4] Vgl. Gestring, Norbert (2006): Prozesse der Integration und Ausgrenzung, Wiesbaden, S.12.
[5] Vgl. Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung / Nr. 40. Mannheim, S.8ff.
[6] Vgl. Ekin Deligöz (1999): Ausländer zwischen Integration und Segregation, Konstanz, S.25.
[7] Vgl. Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Nr. 40, Mannheim, S. 40.
[8] Vgl. Ekin Deligöz, (1999): Ausländer zwischen Integration und Segregation, Konstanz, S.25.
[9] Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Nr. 40, Mannheim, S.10.
[10] Vgl. Koller, Barbara (1997): Aussiedler der großen Zuwanderungswellen – was ist aus ihnen geworden? * die Eingliederungssituation von Aussiedlerinnen und Aussiedlern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Jg. 30, H. 4. S. 766-789; S 770.
[11] Vgl. Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Nr. 40, Mannheim, S.12-15.
[12] Ekin Deligöz, (1999): Ausländer zwischen Integration und Segregation, Konstanz, S.25.
[13] Vgl. Gestring, Norbert (2006): Prozesse der Integration und Ausgrenzung, Wiesbaden, S.13.
[14] Vgl. Gestring, Norbert (2006): Prozesse der Integration und Ausgrenzung, Wiesbaden, S.15.
[15] Vgl. Bundesministerium des Innern(Hrsg.)(2005), Referat Öffentlichkeitsarbeit : Zuwanderungsrecht und Zuwanderungspolitik, Berlin, S11.
[16] Ahmet Fuat Boztepe (2006): Türken in Deutschland, in: Integration und Islam, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.), S86.
[17] Vgl. Irmgard Pinn (2002): “Gastarbeiter“ kamen – Muslime sind geblieben. Migranten und Migrantinnen aus muslimischen Ländern in den deutschen Medien, Köln, S. 6.
[18] Vgl. Martin Sökefeld, Das Paradigma kultureller Differenzen: Zur Forschung und Disskusion über Migranten aus der Türkeiin (2004), in: Martin Sökefeld (Hrsg.): Jenseits des Paradigmas kultureller Differenz, Bielefeld, S 11.
[19] Vgl. Ahmet Fuat Boztepe (2006): Türken in Deutschland, in: Integration und Islam, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.), S86 ff.
[20] Vgl. Martin Sökefeld, Das Paradigma kultureller Differenzen: Zur Forschung und Disskusion über Migranten aus der Türkeiin (2004), in: Martin Sökefeld (Hrsg.): Jenseits des Paradigmas kultureller Differenz, Bielefeld, S 12 ff.
[21] Vgl. Maria Papamichou (2005): Massenmedien und ethnische Minderheiten in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung griechischer Bevölkerungsteile. Partizipationsmöglichkeiten, Probleme und Perspektiven unter sozialpädagogischem Aspekt, Athen/Köln, S. 28.
[22] Vgl. Martin Sökefeld, Das Paradigma kultureller Differenzen: Zur Forschung und Disskusion über Migranten aus der Türkei (2004), in: Martin Sökefeld (Hrsg.): Jenseits des Paradigmas kultureller Differenz, Bielefeld, S 12.
[23] Christoph Butterwegge ist Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft am Seminar für Sozialwissenschaften der Universität Köln.
[24] Christoph Butterwegge (2003): Das mediale Bild der Migrant(inn)en und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland, in: Forum 2003: Social cohesion or public security: How should Europe respond to collective feelings of insecurity? S.2.
[25] Vgl. Hamid Reza Yousefi/Ina Braun (2005): Interkulturelles Denken oder Achse des Bösen. Das Islambild im christlichen Abendland, Bausteine zur Mensching-Forschung Bd. 8, Nordhausen, S 147
[26] Vgl. Christoph Butterwegge (2003): Das mediale Bild der Migrant(inn)en und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschlan, in: Forum 2003: Social cohesion or public security: How should Europe respond to collective feelings of insecurity? S.2.
[27] ebd.
[28] Christoph Butterwegge (2003): Das mediale Bild der Migrant(inn)en und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschlan, in: Forum 2003: Social cohesion or public security: How should Europe respond to collective feelings of insecurity? S.3.
[29] Vgl. Christoph Butterwegge (2003): Das mediale Bild der Migrant(inn)en und sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland, in: Forum 2003: Social cohesion or public security: How should Europe respond to collective feelings of insecurity? S.4.
[30] Edmund Stoiber, Bayrischer Ministerpräsident in der Bild-Zeitung vom 7. September 2006. Vgl.: "Herr Stoiber, das Maß ist voll!" : http://zentralrat.de/6725.php.
[31] Vgl. Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen, S 22.
[32] Vgl. Jürgen Leibol/Steffen Kühnel/Wilhelm Heitmeyer (2006): Abschottung von Muslimen durch generalisierte Islamkritik? In: Parallelgesellschaften? Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 1-2/2006), S.3.
[33] Vgl. Heitmeyer Wilhelm Heitmeyer (2005): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und empirische Ergebnisse aus 2002, 2003 und 2004. Leicht gekürzte Fassung aus: Heitmeyer; W. (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 3, Frankfurt, , S. 13-34; S.6 und Jürgen Leibol/Steffen Kühnel/Wilhelm Heitmeyer (2006): Abschottung von Muslimen durch generalisierte Islamkritik? In: Parallelgesellschaften? Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 1-2/2006), S. 3-10.
[34] Heitmeyer Wilhelm Heitmeyer (2005): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Die theoretische Konzeption und empirische Ergebnisse aus 2002, 2003 und 2004. Leicht gekürzte Fassung aus: Heitmeyer; W. (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 3, Frankfurt, , S. 13-34; S.6.
[35] Vgl. Die Ergebnisse Beziehen sich auf eine Studie aus dem Jahr 2005.
[36] Jürgen Leibol/Steffen Kühnel/Wilhelm Heitmeyer (2006): Abschottung von Muslimen durch generalisierte Islamkritik? In: Parallelgesellschaften? Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 1-2/2006),S.4.
[37] ebd.
[38] Vgl. Jürgen Leibol/Steffen Kühnel/Wilhelm Heitmeyer (2006): Abschottung von Muslimen durch generalisierte Islamkritik? In: Parallelgesellschaften? Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 1-2/2006), S.8.
[39] Vgl. Elisabeth Noelle/Thomas Petersen(2006): Eine fremde, bedrohliche Welt. Die Einstellungen der Deutschen zum Islam, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.05.2006, Nr. 114, S. 5.
[40] Ebd.
[41] Ebd.
[42] Vgl. Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen.
[43] Vgl. Abb. 1.
[44] Vgl. Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen S 37.
[45] Vgl. Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen S 39.
[46] Vgl. Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen S 39; Vgl. auch: Abb. 2.
[47] Ebd.; vergleiche auch Abb. 3.
[48] Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen, S.9
[49] Karim Aga Khan IV in: Der Spiegel 9. Oktober 2006 S. 168 Heft 41/2006., „Nachfahre des Propheten und geistliches Oberhaupt von 20 Millionen Ismailiten“.
[50] Frank Meng, (2004): Islam(ist)ische Orientierungen und gesellschaftlich Integration in der zweiten Migrantengeneration. Eine Transparenzstudie, in: Bremer Beiträge zur politischen Bildung 1/2004, Bremen, S 24.
[51] Hans-Ludwig Frese(2004) „Moderne Muslime”, in: Luchesi, Brigitte & Kocku von Stuckrad (Hrsg.), Religion im kulturellen Diskurs. Festschrift für Hans G. Kippenberg zu seinem 65. Geburtstag (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, vol. 52), Berlin & New York, S. 439-454.. 439.
[52] Diesen Wertekonservatismus, als eine Eigenschaft des Islam zu sehen ist allerdings prekär, da auch das Christentum familiäre Werte schätzt und außerehelichen Geschlechtsverkehr ablehnt.
[53] Hans-Ludwig Frese (2004): Moderne Muslime, in: Brigitte Luchesi und Kocku von Stuckrad (Hrsg.): Religion im kulturellen Diskurs. Festschrift für Hans G. Kippenberg zu seinem 65. Geburtstag (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, vol. 52), Berlin und New York, S.439-454, S.441
[54] Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen, S. 27
[55] Die schleichende Machtübernahme. Die Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali warnt davor, sich von muslimischen Friedensbeteuerungen einlullen zu lassen Frankfurter Allgemeine Zeitung, 04.10.2006, Nr. 230, S. 39.
[56] Vgl. Frank Meng, (2004): Islam(ist)ische Orientierungen und gesellschaftlich Integration in der zweiten Migrantengeneration. Eine Transparenzstudie, in: Bremer Beiträge zur politischen Bildung 1/2004, Bremen, S.30.
[57] Wolfgang Günter Lerch (2005): Vom "wilden" Islam. Am Terrorismus ist auch mangelndes religiöses Wissen schuld, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.07.2005, Nr. 165, S. 10
[58] Ebd.
[59] http://zentralrat.de/2594.php; Allerdings erhebt auch der „Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland“ diesen Anspruch für sich.
[60] http://zentralrat.de/3035.php.
[61] http://islam.de/1641.php#deutsch/Muslime_in_nichtisl_Laendern.html.
[62] Frank Meng, (2004): Islam(ist)ische Orientierungen und gesellschaftlich Integration in der zweiten Migrantengeneration. Eine Transparenzstudie, in: Bremer Beiträge zur politischen Bildung 1/2004, Bremen, S 25.
[63] Ebd.
[64] Ebd.
[65] Frank Meng, (2004): Islam(ist)ische Orientierungen und gesellschaftlich Integration in der zweiten Migrantengeneration. Eine Transparenzstudie, in: Bremer Beiträge zur politischen Bildung 1/2004, Bremen, S 24.
[66] Faruk Sen et al.(2004) : Euro-Islam. Eine Religion etabliert sich in Europa, in: ZFT-Aktuell 102, Stiftung Zentrum für Türkeistudien, Essen, S. 37
[67] Zur Geschichte der Arbeitsmigration siehe zum Beispiel Tuna (1990)
[68] Siehe hierzu Esser (1980)
[69] Heckmann geht von einer gesamtgesellschaftlich integrierenden Wirkung ethnischer Kolonien aus (Heckmann 1992: 38 ff)
[70] Siehe hierzu auch das Konzept des „marginal man“ von Robert Park 1950
[71] Z.B Neukölln (Berlin)
[72] Hier „Situation, in der Ziele und Mittel, diese Ziele zu erreichen, auseinanderklafffen“
[73] Vgl. hierzu Merton
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Assimilation?
Assimilation beschreibt einen einseitigen Anpassungsprozess der Migranten an die Mehrheitsgesellschaft, während Integration die Teilhabe und Chancengleichheit bei fortbestehender kultureller Differenz meint.
Welche Rolle spielen die Medien beim Islambild in Deutschland?
Medien tragen oft zur Exklusion bei, indem sie den Islam einseitig mit Fundamentalismus verknüpfen, insbesondere verstärkt seit den Anschlägen vom 11. September 2001.
Was versteht man unter sozialräumlicher Segregation?
Segregation bezeichnet die räumliche Trennung verschiedener Bevölkerungsgruppen in einer Stadt, was den Kontakt zwischen Minderheit und Mehrheit erschwert und die Integration hemmen kann.
Warum ist die Sprache eine zentrale Determinante der Integration?
Spracherwerb ist die Voraussetzung für Bildungserfolg und die Platzierung auf dem Arbeitsmarkt, was nach Hartmut Esser wesentliche Dimensionen der Sozialintegration sind.
Wie definiert Hartmut Esser die vier Dimensionen der Integration?
Er unterscheidet Kulturation (Wissen/Kompetenzen), Plazierung (Positionen in der Gesellschaft), Interaktion (soziale Beziehungen) und Identifikation (emotionales Zugehörigkeitsgefühl).
- Quote paper
- Ch. Mauch (Author), R. Leemhuis (Author), T.-B. Fehringer (Author), F. Mesecke (Author), J. Barth (Author), 2013, Integration statt Exklusion: Von der Gesellschaft zur Gemeinschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264224