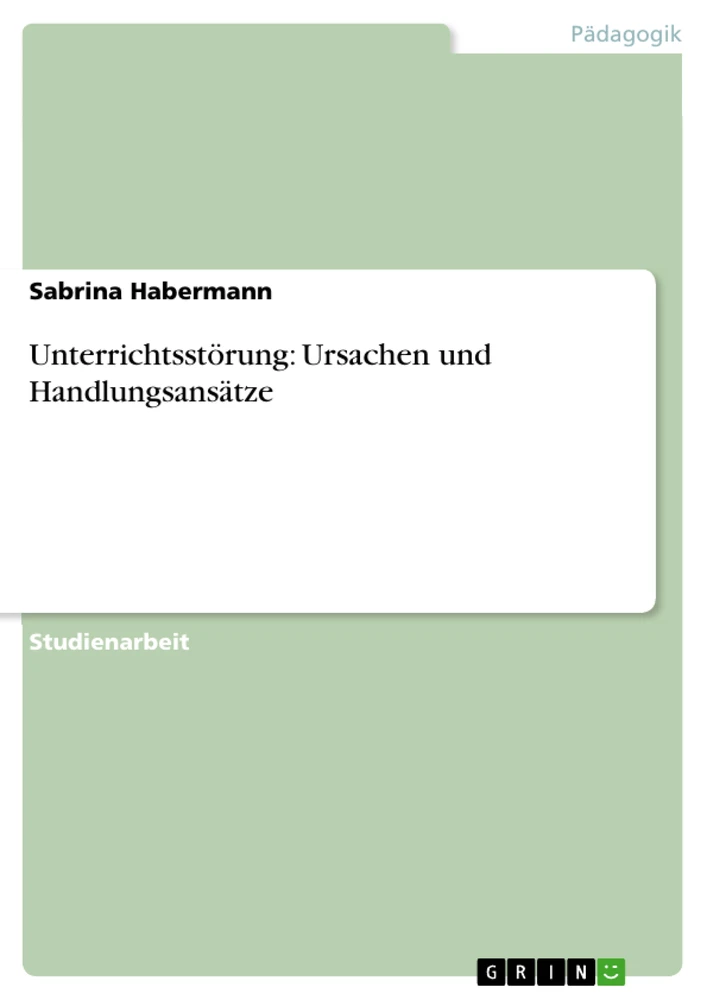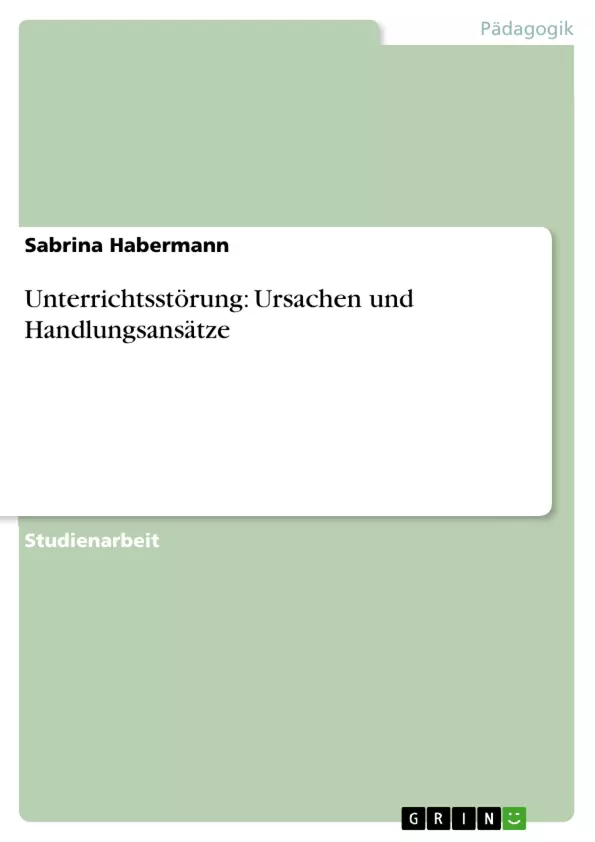Wer kennt sie nicht? Ob aus Erfahrungen in der eigenen Schullaufbahn oder aus einem Schulpraktikum im Rahmen des Lehramtsstudiums – Unterrichtsstörungen sind allgegenwärtig und waren noch nie gefürchteter als heute.
In vielen Diskussionen wird der Ruf danach laut, Lehrern, wie in früheren Zeiten, wieder mehr Kontroll- und Disziplinierungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls durch das Einsetzen von Gewalt in ihre Schranken zu weisen und somit die Kontrolle über die Klasse zurückzugewinnen.
Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob es sinnvoll ist, in einer Gesellschaft, deren Werte und Normen sich im Bezug auf den schulischen, aber auch familiären Umgang miteinander stark verändert haben, auf althergebrachte Disziplinierungsmaßnahmen zurückzugreifen, wo doch gerade heutzutage der Institution „Schule“ weitaus mehr Aufgaben zugerechnet werden, als die bloße Vermittlung von Lerninhalten.
Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule vor allem auch bei der Persönlichkeitsbildung unterstützt werden, um ihnen die Orientierung in der Gesellschaft zu erleichtern. Hierzu gehören laut BRÜNDEL und SIMON Kompetenzen wie „Verantwortungsbewusstsein, die Anerkennung von Regeln im Umgang miteinander, Entscheidungs- und Antizipationsfähigkeit, Problemlösekompetenzen sowie Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft“ (2003, S. 9). Somit sollten Unterrichtsstörungen nicht durch übertriebene Disziplinierungsmaßnahmen unterdrückt werden, sondern der Lehrperson vor allem als Feedback für die eigene Unterrichtsgestaltung dienen.
Der Lehrer ist also dazu angehalten, mit jeder Art von Unterrichtsstörung reflexiv umzugehen. Einerseits ist es ihm somit möglich herauszufinden, inwieweit die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, wie Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft, schon ausgebildet sind, andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, sich selbst, als Lehrperson, zum Gegenstand der Reflexion zu machen. Lehrerinnen und Lehrer sind mit ihrem Verhalten in gewisser Weise immer Vorbild für die Schüler und sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich dieses positiv, aber auch negativ auf das Verhalten der Schüler auswirken kann.
Dies bedeutet, dass auch Faktoren wie Lehrerverhalten, Klassenmanagement oder Unterrichtsführung zu Unterrichtsstörungen führen können und die Ursachen nicht grundsätzlich bei den Schülern zu suchen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Gründe für Unterrichtsstörungen
- Störfaktor 1 - Schule als Institution
- Störfaktor 2 – Lehrerverhalten
- Fallbeispiel: fehlende Präsenz
- Subjektivität
- Inkonsequenz/ ineffektive Ermahnungen
- Vermittlung des Unterrichtsstoffes
- Störfaktoren 3 - Schülerverhalten
- Warum stören Schüler?
- Warum stören sich für Klassenclowns lohnt
- Prävention durch Reflexion
- Intervention
- Die Trainingsraummethode
- Grundlagen
- Praxis
- Rechte und Pflichten
- Vorgehen bei einer Unterrichtsstörung
- Im Trainingsraum
- Fallbeispiel
- Kritik
- Chancen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Unterrichtsstörungen – Ursachen und Handlungsansätze“ beschäftigt sich mit dem allgegenwärtigen Phänomen von Unterrichtsstörungen und analysiert deren Ursachen und mögliche Lösungsansätze. Dabei werden sowohl die Institution Schule als auch das Lehrerverhalten sowie das Schülerverhalten als potentielle Störfaktoren beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Analyse verschiedener Theorien und Methoden zur Prävention und Intervention bei Unterrichtsstörungen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Komplexität des Themas zu schaffen und Lehrkräften praktische Handlungsoptionen aufzuzeigen.
- Ursachen von Unterrichtsstörungen
- Bedeutung von Lehrerverhalten und Klassenmanagement
- Schülerperspektive und Motivation im Unterricht
- Prävention durch Reflexion und professionelle Unterrichtsgestaltung
- Intervention durch die Trainingsraummethode
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Relevanz von Unterrichtsstörungen und der Notwendigkeit, diese nicht nur als Schülerproblem zu betrachten, sondern auch als Feedback für die eigene Unterrichtsgestaltung zu nutzen. Das zweite Kapitel analysiert verschiedene Definitionen des Begriffs „Unterrichtsstörung“ und beleuchtet die subjektiven Aspekte, die mit diesem Phänomen verbunden sind. Anschließend widmet sich Kapitel 3 den Ursachen von Unterrichtsstörungen und untersucht die Rolle der Schule als Institution, das Lehrerverhalten und das Schülerverhalten. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Prävention von Unterrichtsstörungen durch Reflexion und Intervention durch verschiedene Maßnahmen. Kapitel 6 stellt die Trainingsraummethode als ein umfassendes Konzept für den Umgang mit Unterrichtsstörungen vor. Die Arbeit endet mit einem Resümee, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Unterrichtsstörungen, Lehrerverhalten, Schülerverhalten, Prävention, Intervention, Trainingsraummethode, Wahrnehmungskontrolltheorie, Rechte und Pflichten, Klassenmanagement, Unterrichtsgestaltung, Motivation, Reflexion, Selbstverantwortung, Erziehungsstil.
- Arbeit zitieren
- Sabrina Habermann (Autor:in), 2011, Unterrichtsstörung: Ursachen und Handlungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263615