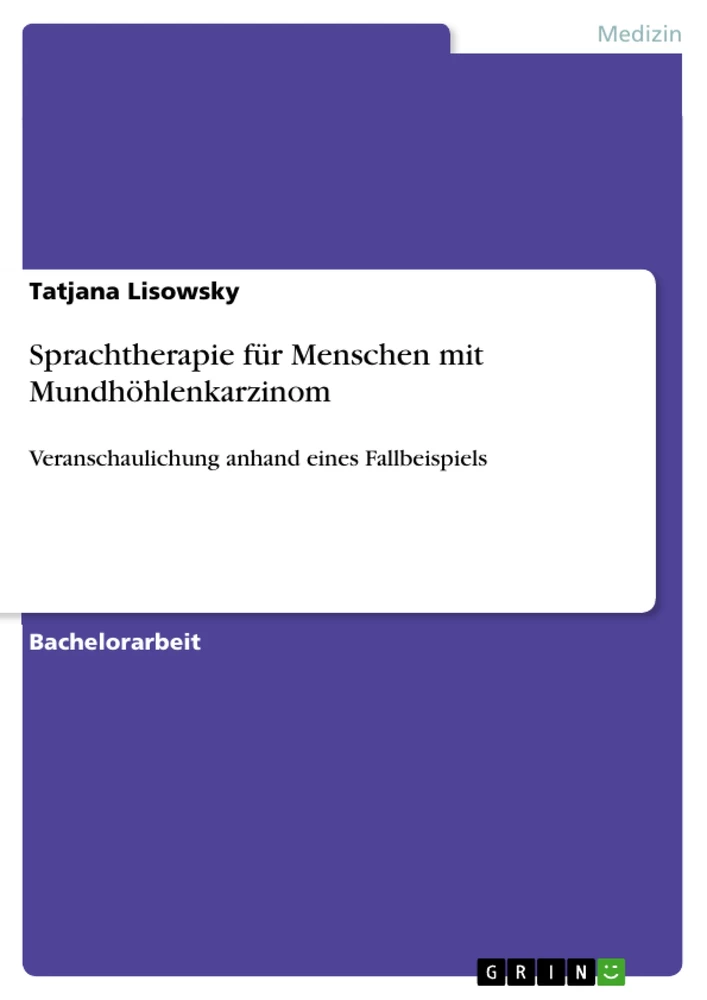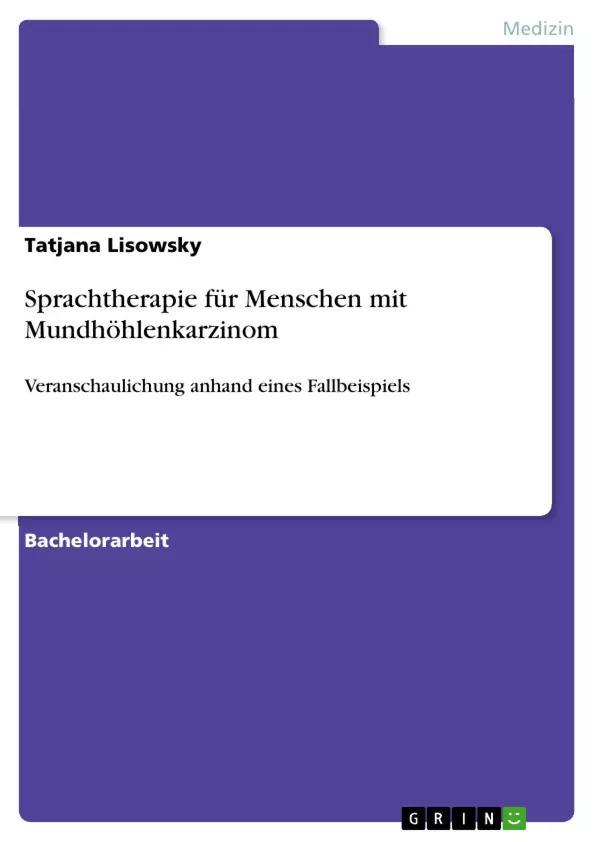Jährlich gibt es in Deutschland bis zu 11.400 neu diagnostizierte Krebserkrankungen der Mundhöhle und des Rachens - 8.360 Männer und 3.040 Frauen sind davon betroffen. Allein in den letzten Jahren lässt sich ein Anstieg des Tumorvorkommens im Kopf-Hals-Bereich von 25% feststellen. Insbesondere bei Frauen wächst die Anzahl der Erkrankungen im oropharyngealen Bereich. Hierbei handelt es sich nicht um die häufigste Tumorerkrankung, jedoch gehen damit sehr große Einschränkungen an der Teilhabe des sozialen Lebens einher (Beckmann, 2011). Hinzu kommen weitere Beeinträchtigungen, die sich auf das Schlucken und das Sprechen auswirken. Daraus resultiert, dass sprachtherapeutische Interventionen von steigender Relevanz für Menschen mit Kopf-Hals-Tumoren sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problembereich und Relevanz
- 1.1.1. Beeinträchtigungen nach entfernten Mundhöhlenkarzinomen
- 1.1.2. Einschränkungen der Teilhabe und Lebensqualität
- 1.2. Einführung eines Fallbeispiels
- 1.3. Forschungsstand und Fragestellung
- 2. Methode
- 3. Ergebnisse
- 3.1. Notwendige Kompetenzen der SprachtherapeutInnen
- 3.2. Möglichkeiten sprachtherapeutischer Interventionen
- 3.3. Grenzen sprachtherapeutischer Interventionen
- 3.4. Die wichtigsten Rechercheergebnisse
- 3.5. Anwendung auf das Fallbeispiel
- 4. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen sprachtherapeutischer Interventionen für Menschen mit Mundhöhlenkarzinom. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Krebserkrankung auf die Sprech- und Schluckfunktionen sowie die Teilhabe am sozialen Leben zu untersuchen und die Rolle der Sprachtherapie in der Rehabilitation dieser Patientengruppe zu beleuchten.
- Beeinträchtigungen im oropharyngealen Bereich nach entfernten Mundhöhlenkarzinomen
- Notwendige Kompetenzen der SprachtherapeutInnen im Umgang mit Menschen mit Mundhöhlenkarzinom
- Möglichkeiten und Grenzen sprachtherapeutischer Interventionen
- Interdisziplinäre Therapiekonzepte und ihre Bedeutung für die Rehabilitation
- Anwendung der Forschungsergebnisse auf ein Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Mundhöhlenkarzinoms ein und beleuchtet die Relevanz sprachtherapeutischer Interventionen. Sie beschreibt die Auswirkungen der Erkrankung auf die Sprech- und Schluckfunktionen sowie die Teilhabe am sozialen Leben. Außerdem wird ein Fallbeispiel vorgestellt, das im weiteren Verlauf der Arbeit detailliert analysiert wird.
2. Methode
Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die Forschungsmethoden und die Datenerhebung detailliert dargestellt.
3. Ergebnisse
Das dritte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die notwendigen Kompetenzen der SprachtherapeutInnen, die Möglichkeiten und Grenzen sprachtherapeutischer Interventionen sowie die wichtigsten Rechercheergebnisse beleuchtet.
4. Diskussion
Die Diskussion analysiert die Ergebnisse der Arbeit und setzt sie in den Kontext der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie befasst sich mit den Limitationen der Studie und gibt Ausblicke auf zukünftige Forschungsarbeiten.
Schlüsselwörter
Mundhöhlenkarzinom, Sprachtherapie, Sprechstörungen, Schluckstörungen, Rehabilitation, interdisziplinäre Therapie, Fallbeispiel, Kompetenzen, Möglichkeiten, Grenzen, Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen
Wie häufig treten Mundhöhlenkarzinome in Deutschland auf?
Jährlich werden bis zu 11.400 Neuerkrankungen diagnostiziert, wobei Männer mit rund 8.360 Fällen deutlich häufiger betroffen sind als Frauen.
Welche Einschränkungen haben Patienten nach einer Tumor-Operation?
Häufig treten massive Beeinträchtigungen beim Schlucken und Sprechen auf, was zu einer starken Einschränkung der sozialen Teilhabe und Lebensqualität führt.
Welche Aufgaben übernimmt die Sprachtherapie bei Mundhöhlenkrebs?
Sprachtherapeuten arbeiten an der Wiederherstellung oder Verbesserung der Sprech- und Schluckfunktionen durch gezielte therapeutische Interventionen.
Warum ist interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Rehabilitation wichtig?
Da die Erkrankung komplexe physische und soziale Folgen hat, ist eine enge Abstimmung zwischen Chirurgen, Onkologen und Sprachtherapeuten für den Heilungserfolg entscheidend.
Gibt es Grenzen für die sprachtherapeutische Behandlung?
Ja, die Arbeit untersucht sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der Therapie, die oft durch den Umfang der chirurgischen Resektion und die Heilungsprozesse bedingt sind.
- Citar trabajo
- Tatjana Lisowsky (Autor), 2013, Sprachtherapie für Menschen mit Mundhöhlenkarzinom, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263412