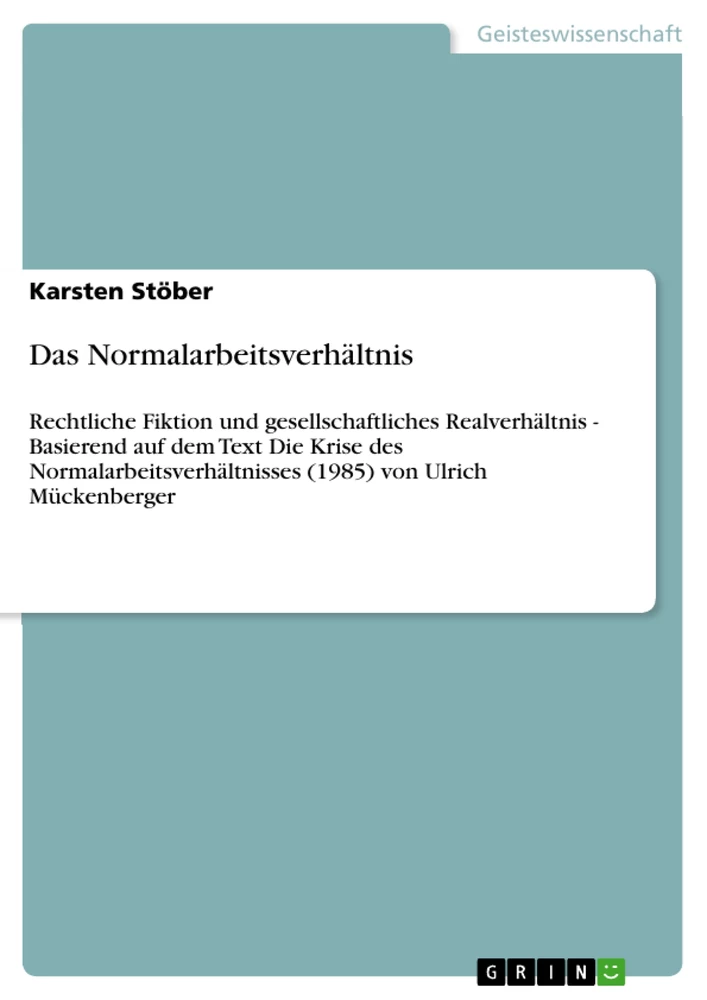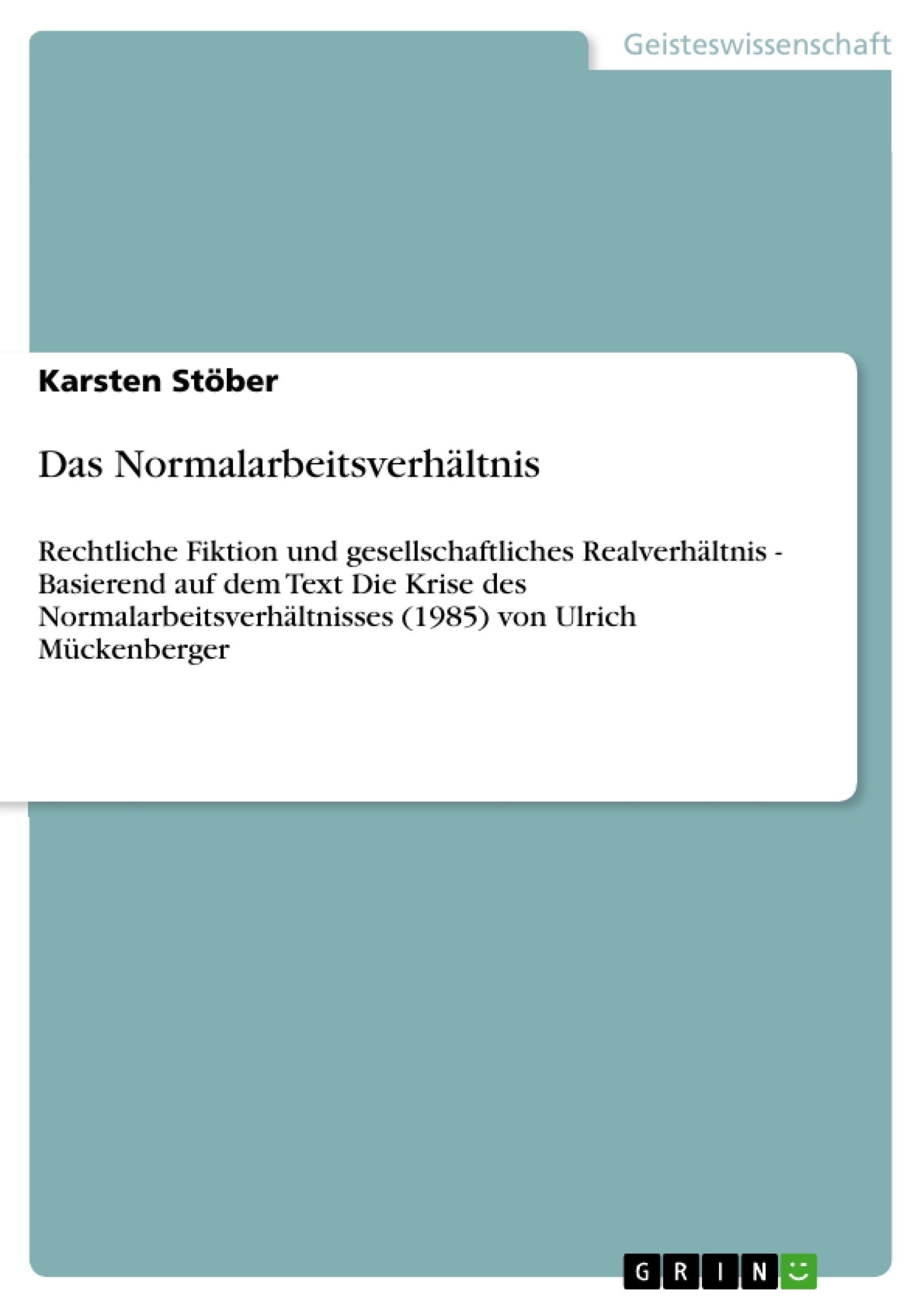Die Arbeitspolitik unterliegt dem Marktprinzip und basiert folglich auf der ökonomischen Logik des Warentausches. Sie reglementiert den Arbeitsmarkt, indem sie vereinheitlichte und allgemein anerkannte Austauschbedingungen festlegt und standardisiert, wie etwa der Festschreibung von Löhnen – also dem Tauschprinzip „Arbeitskraft gegen monetäre Entlohnung“ - oder Arbeitszeiten, die eine Reproduktion der Arbeitskraft ermöglichen. Durch individuelle oder kollektive Verträge wie Arbeits- und Tarifverträge oder Betriebs- und Dienstvereinbarungen wird ein Minimum an sozialem Schutz gewährleistet, ohne das die Vergesellschaftung der Arbeitskraft auf Basis der Lohnabhängigkeit nicht von Statten gehen könnte und die Gesetze des Marktes den sozialen Frieden gefährden würden. Ebenfalls zum Bereich der Arbeitspolitik gehört das Versicherungsprinzip, obgleich es als ein bedeutsames Instrument der Armutsbekämpfung auf dem ersten Blick vielleicht eher der Sozialpolitik zugerechnet werden könnte. Im Unterkapitel 1.3 werde ich auf darauf noch näher eingehen.
Die Arbeitspolitik gewährleistet darüber hinaus durch ein breites Spektrum an Regelungselementen wie der Arbeitskraftqualifizierungspolitik, der Allokationspolitik oder der Innovationsförderung- und Humanisierungspolitik, dass die Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes gefördert und verbessert wird, wodurch der Bestand und die Kontinuität eines auf Lohnabhängigkeit basierendes Beschäftigungsverhältnisses gesichert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Die drei Stufen der Sozialpolitik
- Arbeitspolitik
- Sozialpolitik
- Das Verhältnis von Arbeitspolitik und dem Versicherungsprinzip und Sozialpolitik und der Sozialhilfe
- „Normalarbeitsverhältnis“ – Definition
- Das Normalarbeitsverhältnis als kodifiziertes Senioritätsprinzip im bürgerlichen Rechtssystem
- Dauer der Betriebszugehörigkeit
- Dauer der Beschäftigungszeit
- Lebensalter
- Vollzeitarbeit
- Betriebliche Arbeit
- Betriebsgröße
- Einstufung der Arbeit
- Das Normalarbeitsverhältnis in der Krise
- Aktuelle Beispiele aus Niedersachsen
- Kritik des Normalarbeitsverhältnisses
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text von Mückenberger analysiert das Normalarbeitsverhältnis in seiner rechtlichen Konstruktion und im gesellschaftlichen Realverhältnis. Er beleuchtet die Krise des Normalarbeitsverhältnisses und seine Folgen für die Arbeitsgesellschaft.
- Die drei Stufen der Sozialpolitik: Arbeitspolitik, Sozialpolitik und Sozialhilfe
- Die Definition des Normalarbeitsverhältnisses und seine Merkmale
- Die Krise des Normalarbeitsverhältnisses und ihre Ursachen
- Die Kritik am Normalarbeitsverhältnis
- Die Auswirkungen der Krise des Normalarbeitsverhältnisses auf die Arbeitsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der dreistufigen Segmentierung der Sozialpolitik. Es wird die Funktionslogik von Arbeitspolitik und Sozialpolitik sowie deren Verhältnis zum Versicherungsprinzip und zur Sozialhilfe beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Normalarbeitsverhältnisses und seinen zentralen Merkmalen. Der dritte Teil analysiert die Krise des Normalarbeitsverhältnisses, wobei der Fokus auf aktuellen Beispielen aus Niedersachsen liegt. Im vierten Kapitel wird die Kritik am Normalarbeitsverhältnis dargestellt.
Schlüsselwörter
Normalarbeitsverhältnis, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Versicherungsprinzip, Sozialhilfe, Krise, Arbeitsgesellschaft, Prekarisierung, Rechtssystem, Senioritätsprinzip, Arbeitsmarkt, Betriebszugehörigkeit, Beschäftigungszeit, Lebensalter, Vollzeitarbeit, Betriebliche Arbeit, Betriebsgröße, Einstufung der Arbeit
- Quote paper
- B.A. Karsten Stöber (Author), 2012, Das Normalarbeitsverhältnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263264