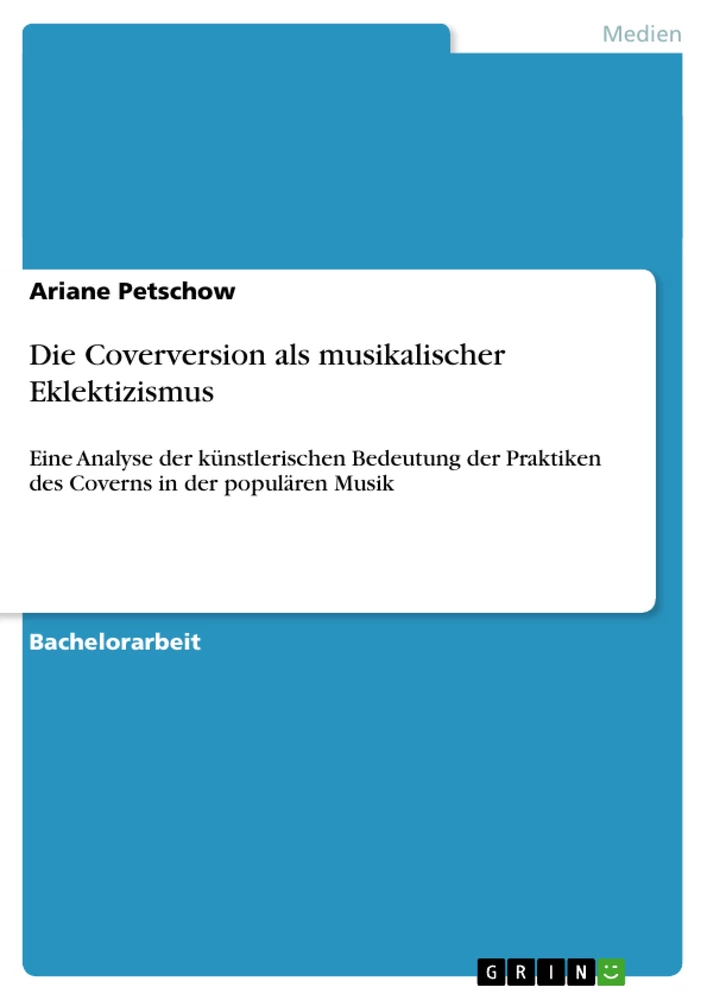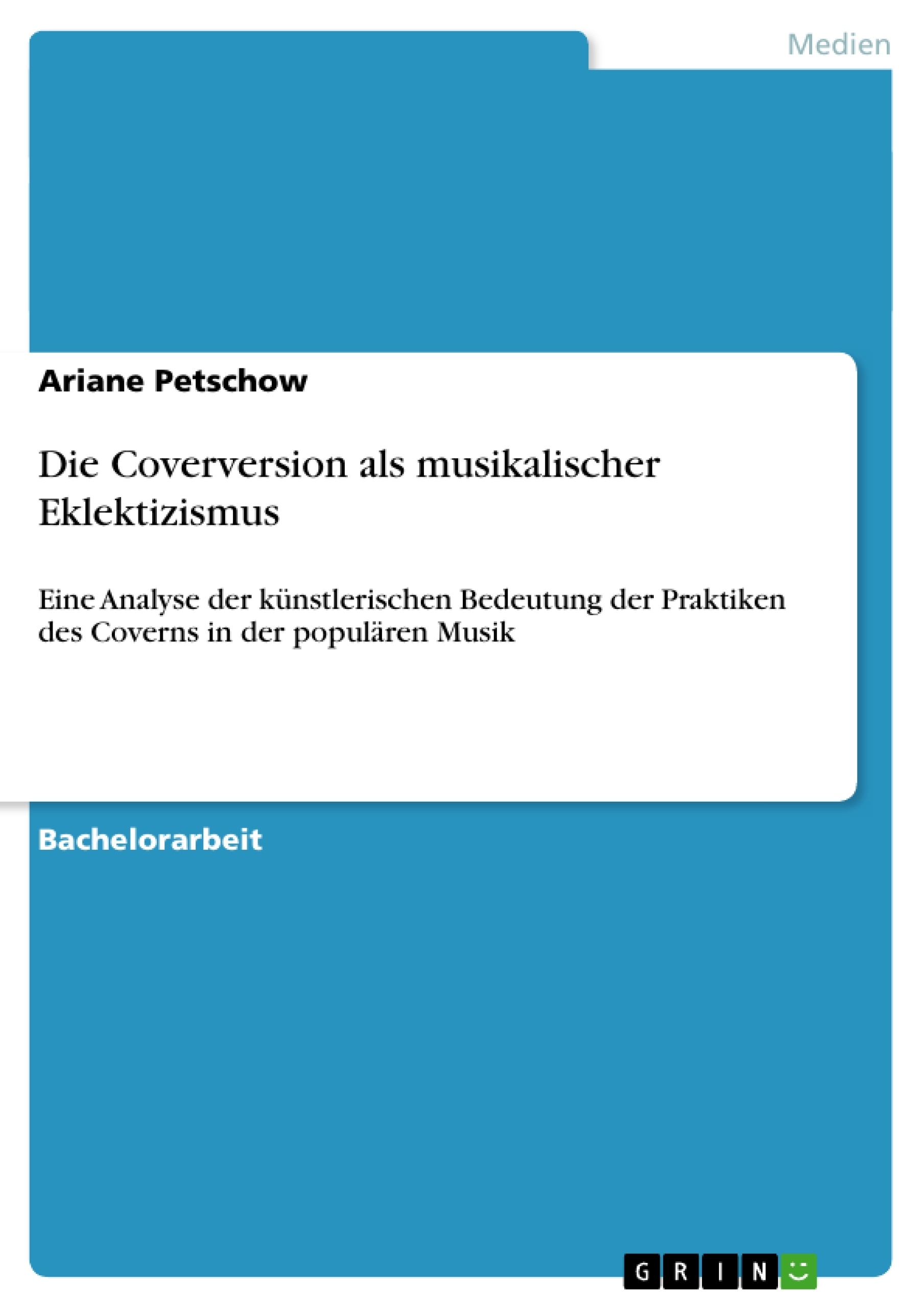Die Coverversion als Oberbegriff für alle Praktiken des Verwendens, Aufgreifens und Aufbereitens fremden musikalischen Materials ist ein heutzutage häufig genutzter Terminus. Wenn auch meist als Synonym für eine Neuaufnahme eines Werkes mit leichter Uminterpretation durch einen anderen Musiker verwendet, umfasst sie weit mehr als das. Scheinbar mit ihr fest verwobene Begriffe wie ‚Original‘ und ‚Kopie‘, ‚Kommerzialität‘ und ‚Einfallslosigkeit‘, aber auch ‚Hommage‘, ‚Huldigung‘ und ‚kulturelle Erinnerung‘ deuten auf eine komplexe Bedeutung dieses kulturellen Phänomens hin und lassen eine gewisse Ambivalenz erahnen. Die Grundidee der musikalischen Coverversion ist das Aufgreifen fremder Ideen oder ganzer Werke, mit der Bestrebung der Einbettung dieser in einen neuen Kontext oder deren Aufbereitung für einen anderen Zweck. Dies korrespondiert mit dem Eklektizismus, welcher, wertfrei betrachtet, ebenso die Übernahme fremder Ideen zum Zwecke der Kombination zu bzw. Erschaffung von etwas Neuem meint (Vgl. enzyklo.de). Die Intention und das Ergebnis dieser Nutzung fremder Ideen mögen dabei sowohl positiv als auch negativ ausfallen. Oft haftet jedoch sowohl der Coverversion als auch dem Eklektizismus eine negative Konnotation an:
Eklektizismus meint zumeist abwertend eine „unoriginelle, unschöpferische geistige oder künstlerische Arbeitsweise […], bei der Ideen anderer übernommen [werden]“ (Duden online)
„Coverversionen sind […] zumindest in der Masse und als marktbeherrschende Erscheinung im kulturellen Interesse nicht wünschenswert: Letztlich behindern sie andere förderungswerte Künstler, von denen musikalisch Neues und Kreatives zu erwarten wäre, in ihrem Fortkommen und ihrem Erfolg.“ (Pendzich 2004: 439)
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Cover als allgegenwärtiges Moment in der Musikhistorie
- 2.1 Coverversionen im Wandel der Zeit
- 2.2 Cover als universeller Begriff verschiedener Kulturpraktiken
- 3. Praktiken des Coverns
- 3.1 Die Polarität der kulturellen Praktiken der Änderung, Bearbeitung und freien Benutzung
- 3.1.1 Die Änderung - Coverversion im allgemeinen Sprachgebrauch
- 3.1.2 Die Bearbeitung
- 3.1.3 Die freie Benutzung
- 3.2 Cover im digitalen Zeitalter
- 3.2.1 Remix und Sampling
- 3.2.2 Mash-Up
- 4. Die Coverversion als treibende Kraft künstlerischer Weiterentwicklung
- 4.1 Möglichkeiten wahrnehmbarer musikalischer Veränderungen
- 4.2 Auswirkungen auf das Werk, den Künstler und die populäre Musik
- 5. Neuer Künstler - neue Ästhetik? Eine Analyse anhand von zwei aktuellen Beispielen
- 5.1 Das Cover als musikalische Weiterentwicklung - am Beispiel Callejons
- 5.2 Das Cover als musikalischer Affront - am Beispiel Heinos
- 5.3 Abschließender Vergleich
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die künstlerische Bedeutung von Coverversionen in der populären Musik. Sie hinterfragt die oft negative Konnotation des Begriffs "Coverversion" und beleuchtet dessen vielschichtige Aspekte. Das Ziel ist aufzuzeigen, wie Coverversionen zur kulturellen und musikalischen Weiterentwicklung beitragen und nicht nur eine Wiederholung, sondern auch eine kreative Neuinterpretation darstellen können.
- Historische Entwicklung des Coverns in der Musik
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Coverversion"
- Künstlerische Praktiken des Coverns (Änderung, Bearbeitung, freie Benutzung)
- Auswirkungen von Coverversionen auf Künstler, Musik und Kultur
- Analyse von Beispielen genreübergreifender Coverversionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Coverversion als ein komplexes kulturelles Phänomen ein. Sie thematisiert die Ambivalenz des Begriffs, der sowohl negative Konnotationen (unoriginell, kommerziell) als auch positive (Hommage, kulturelle Erinnerung) impliziert. Die Arbeit zielt darauf ab, die positive Bedeutung von Coverversionen für die musikalische und kulturelle Weiterentwicklung herauszustellen und zu zeigen, dass eklektizistische Praktiken nicht zwangsläufig mit Mangel an Kreativität verbunden sein müssen.
2. Cover als allgegenwärtiges Moment in der Musikhistorie: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Verwendung von fremdem musikalischem Material. Es zeigt auf, dass die Adaption bestehender Werke ein zentrales künstlerisches Mittel ist, das bereits lange vor dem Aufkommen der populären Musik existiert hat. Das Kapitel legt den Grundstein für eine differenziertere Betrachtung des Begriffs "Coverversion" und bereitet den Weg für eine umfassendere Definition.
Schlüsselwörter
Coverversion, Eklektizismus, populäre Musik, Musikhistorie, künstlerische Weiterentwicklung, kultureller Fortschritt, Remix, Sampling, Mash-up, Genreübergreifung, musikalische Bearbeitung, Ästhetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Coverversionen in der Populären Musik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die künstlerische Bedeutung von Coverversionen in der populären Musik. Sie untersucht die vielschichtigen Aspekte des Begriffs "Coverversion" und widerlegt die oft negative Konnotation. Im Fokus steht der Beitrag von Coverversionen zur kulturellen und musikalischen Weiterentwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Coverns, die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Coverversion", verschiedene künstlerische Praktiken des Coverns (Änderung, Bearbeitung, freie Benutzung), die Auswirkungen von Coverversionen auf Künstler, Musik und Kultur sowie eine Analyse von Beispielen genreübergreifender Coverversionen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Remix, Sampling und Mash-up im digitalen Zeitalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Cover als allgegenwärtiges Moment in der Musikhistorie (mit Unterkapiteln zu Coverversionen im Wandel der Zeit und Cover als universeller Begriff), Praktiken des Coverns (inkl. digitaler Praktiken wie Remix und Mash-up), Die Coverversion als treibende Kraft künstlerischer Weiterentwicklung, Neuer Künstler - neue Ästhetik? (Analyse anhand von Beispielen), und Resümee.
Wie wird der Begriff "Coverversion" definiert?
Die Arbeit bietet eine differenzierte Betrachtung des Begriffs "Coverversion", die über die gängige, oft negative Konnotation hinausgeht. Sie beleuchtet die verschiedenen Praktiken des Coverns (Änderung, Bearbeitung, freie Benutzung) und zeigt, dass Coverversionen nicht nur Wiederholungen, sondern auch kreative Neuinterpretationen sein können.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei aktuelle Beispiele genreübergreifender Coverversionen, um den Einfluss des Covers auf die musikalische Weiterentwicklung und Ästhetik zu beleuchten. Genannt werden Callejon und Heino als Beispiele für unterschiedliche Herangehensweisen an das Cover.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Coverversion, Eklektizismus, populäre Musik, Musikhistorie, künstlerische Weiterentwicklung, kultureller Fortschritt, Remix, Sampling, Mash-up, Genreübergreifung, musikalische Bearbeitung, Ästhetik.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die positive Bedeutung von Coverversionen für die musikalische und kulturelle Weiterentwicklung herauszustellen. Sie will zeigen, dass eklektizistische Praktiken nicht zwangsläufig mit Mangel an Kreativität verbunden sind, und die oft negative Konnotation des Begriffs "Coverversion" widerlegen.
Welche historischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit bietet einen historischen Überblick über die Verwendung von fremdem musikalischem Material, der zeigt, dass die Adaption bestehender Werke ein lange bestehendes künstlerisches Mittel ist. Dies schafft ein besseres Verständnis der Bedeutung von Coverversionen im Kontext der Musikgeschichte.
- Quote paper
- Ariane Petschow (Author), 2013, Die Coverversion als musikalischer Eklektizismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262920