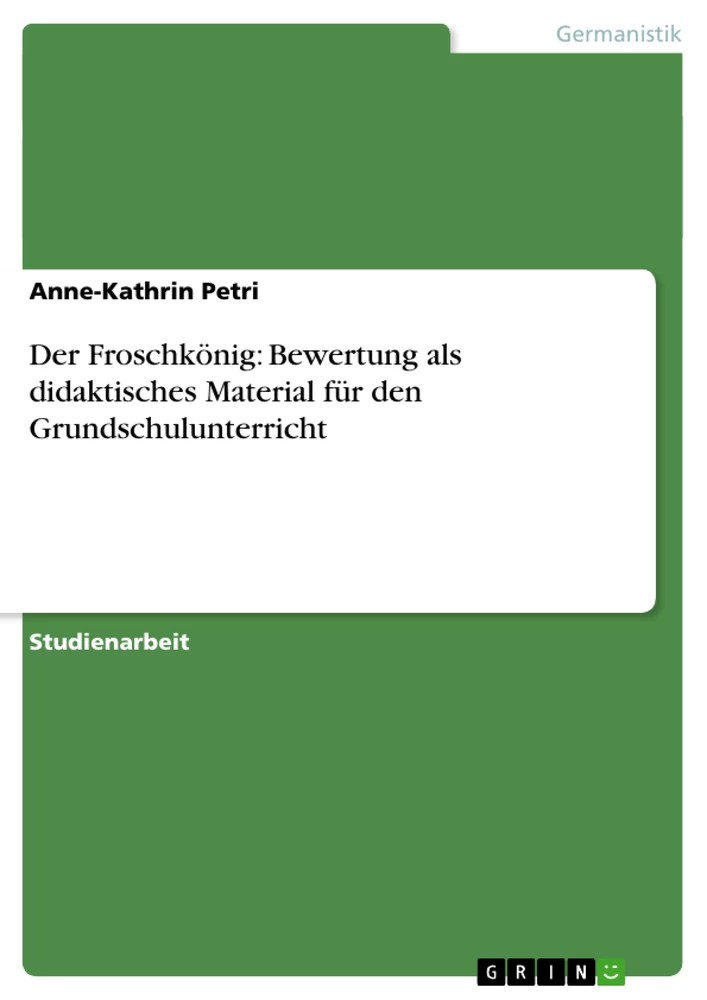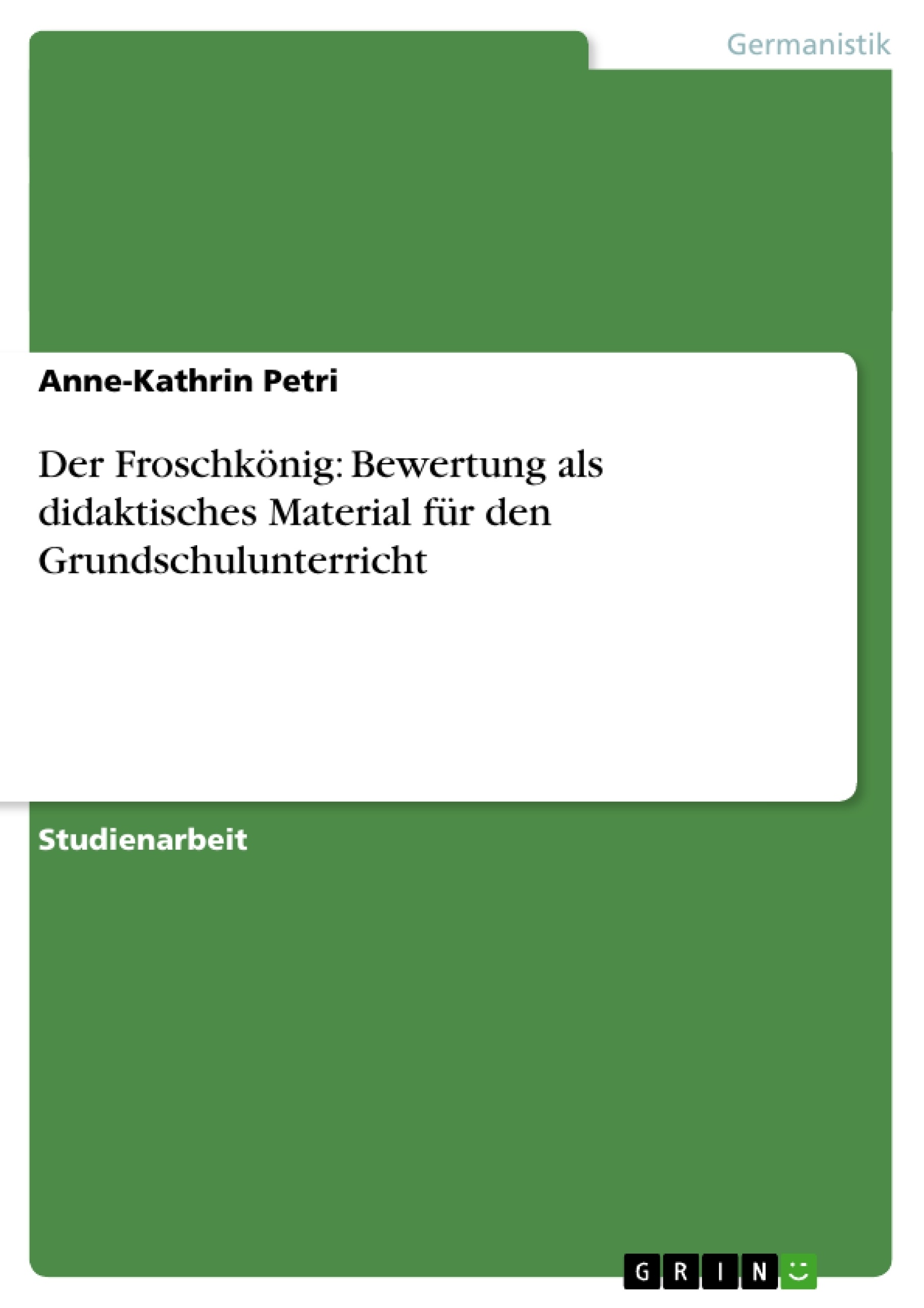Märchen sind seit ihrem Bestehen, aber auch noch heutzutage, ein elementares Kulturgut. Sie zählen zu einem der beliebtesten Genre der Kinderliteratur und werden häufig von Eltern
vor-, oder aber von den Kindern selbst gelesen. Diese sind begeistert von den Helden, die vor unlösbar erscheinende Aufgaben gestellt werden und es irgendwie doch schaffen, sie zu bewältigen. Es ist festzustellen, dass von diesem Genre gerade für jüngere Kinder ein regelrechter Zauber ausgeht .
Fragt man Kinder nach den berühmtesten Märchen, so fällt sofort der Begriff Gebrüder Grimm. Diese begannen sich bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts für Märchen zu interessieren. Die im Jahre 1812 erschienene Sammlung ihrer „Kinder- und Hausmärchen“ ist wohl eine der bekanntesten Märchenschöpfungen weltweit. Die obersten Prioritäten der Gebrüder Grimm bei der Erschaffung dieses Märchenbuches lagen dabei auf der Erhaltung des Volksgutes aber auch darauf, die Ängste der Kinder zu benennen und sie dadurch zu bekämpfen. Diese „Erfahrungen existenzieller menschlicher Grundsituationen“ sind es auch, die laut Karin Richter den „eigentlichen Reiz“ des Märchens ausmachen und dafür sorgen, dass es bis heute „lebendig“ ist .
Die Märchen der Gebrüder Grimm gehören genauer betrachtet zur Gattung der Volksmärchen. Sie wurden in den unteren sozialen Schichten zunächst mündlich weitergegeben, was dazu führte, dass sich verschiedene Varianten gebildet haben und die Geschichten über die Jahre immer weiter ausgeschmückt wurden. Die Gebrüder Grimm setzen dem ein Ende, als sie sich dazu entschlossen sie niederzuschreiben. Desweiteren sind Volksmärchen stilistisch „geprägt durch einen praktischen Satzbau, formelhafte Wendungen, direkte Rede, Verse, durch Typisierung der Personen und Schwarzweißmalerei, durch Kontrastierung und Polarisierung, durch Symbolik und schließlich durch das Happy-End“ . Das bedeutet, Volksmärchen sind einfach gestaltet um sicherzugehen, dass sie auch für jeden verständlich und nachvollziehbar sind.
All diese Merkmale finden sich auch im Grimmschen Märchen „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ wieder. Im Folgenden soll analysiert und beurteilt werden, in wie weit sich dieses Märchen in den Grundschulunterricht integrieren lässt und ob anhand des dargereichten didaktischen Materials ein tieferer Zugang zum Inhalt des Textes möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt des Märchens sowie Analyse des Sach- und Sinnpotentials
- Analyse und Beurteilung der didaktischen Materialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das didaktische Material zum Märchen „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ von Hans-Dieter Bunk und untersucht dessen Eignung für den Grundschulunterricht. Es wird geprüft, inwiefern das Material einen tieferen Zugang zum Inhalt des Märchens ermöglicht.
- Analyse der Merkmale des Volksmärchens „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ nach Max Lüthi.
- Bewertung des didaktischen Potentials des Märchens für den Grundschulunterricht.
- Untersuchung der didaktischen Materialien hinsichtlich ihrer Eignung zur Förderung von Kreativität und Sprachkompetenz.
- Analyse der sprachlichen Gestaltung des Märchens und seiner Verständlichkeit für Kinder.
- Beurteilung der didaktischen Aufgaben im Hinblick auf ihre Lernziele und methodische Umsetzung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Märchen im Kontext der Kinderliteratur ein und hebt deren Bedeutung als Kulturgut hervor. Sie nennt die Gebrüder Grimm als bedeutende Märchensammler und erwähnt die Bedeutung von Märchen für die kindliche Entwicklung und die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen. Die Arbeit kündigt die Analyse des Märchens „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ und des dazugehörigen didaktischen Materials an.
Inhalt des Märchens sowie Analyse des Sach- und Sinnpotentials: Dieses Kapitel fasst den Inhalt des Märchens „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ zusammen. Es analysiert das Märchen anhand der von Max Lüthi festgelegten Merkmale von Volksmärchen: Eindimensionalität, Flächenhaftigkeit, abstrakter Stil, Isolation und Allverbundenheit, Sublimation und Welthaltigkeit. Die Analyse beleuchtet die Figuren, ihre Eigenschaften und Handlungen, den Sprachstil und die didaktischen Möglichkeiten, die sich aus der Thematik des Märchens ergeben. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der Prinzessin und des Frosches, dem Konflikt zwischen dem Wunsch nach Selbstbestimmung und dem Gehorsam gegenüber dem Vater sowie der Thematik der gesellschaftlichen Erwartungen.
Analyse und Beurteilung der didaktischen Materialien: Dieses Kapitel analysiert das didaktische Material von Hans-Dieter Bunk. Es beschreibt die Gestaltung des Materials, bestehend aus dem vollständigen Märchentext, Illustrationen und vier Aufgaben für Schüler. Die Aufgaben werden im Detail beschrieben und in ihrer Eignung zur Förderung von Kreativität, Fantasie, Sprachkompetenz und Erzählfähigkeit bewertet. Die Analyse untersucht, wie die Aufgaben die Schüler zum tieferen Verständnis des Märchens anregen und welche methodischen Ansätze verfolgt werden.
Schlüsselwörter
Märchen, Kinderliteratur, Didaktik, Grundschule, „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“, Gebrüder Grimm, Volksmärchen, Max Lüthi, sprachliche Analyse, didaktisches Material, Unterrichtsmaterial, Kreativität, Fantasie, Erzählen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des didaktischen Materials zu "Der Froschkönig und der eiserne Heinrich"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das didaktische Material von Hans-Dieter Bunk zum Märchen „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ und untersucht dessen Eignung für den Grundschulunterricht. Im Fokus steht die Frage, inwieweit das Material einen tieferen Zugang zum Inhalt des Märchens ermöglicht.
Welche Aspekte des Märchens werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Merkmale des Volksmärchens nach Max Lüthi (Eindimensionalität, Flächenhaftigkeit etc.), das didaktische Potential des Märchens für die Grundschule, die Förderung von Kreativität und Sprachkompetenz durch das Material, die sprachliche Gestaltung und Verständlichkeit des Märchens für Kinder sowie die didaktischen Aufgaben hinsichtlich Lernziele und methodischer Umsetzung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Inhalt des Märchens und dessen Analyse des Sach- und Sinnpotentials sowie ein Kapitel zur Analyse und Beurteilung des didaktischen Materials. Die Einleitung führt in die Thematik der Märchen im Kontext der Kinderliteratur ein und nennt die Gebrüder Grimm als bedeutende Märchensammler. Das zweite Kapitel fasst den Inhalt des Märchens zusammen und analysiert es anhand der Merkmale von Volksmärchen nach Max Lüthi. Das dritte Kapitel analysiert das didaktische Material von Hans-Dieter Bunk, beschreibt dessen Gestaltung und bewertet die didaktischen Aufgaben.
Wie wird das didaktische Material analysiert?
Das didaktische Material wird hinsichtlich seiner Gestaltung (vollständiger Märchentext, Illustrationen, Aufgaben) und der Eignung der Aufgaben zur Förderung von Kreativität, Fantasie, Sprachkompetenz und Erzählfähigkeit analysiert. Es wird untersucht, wie die Aufgaben zum Verständnis des Märchens anregen und welche methodischen Ansätze verfolgt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Märchen, Kinderliteratur, Didaktik, Grundschule, „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“, Gebrüder Grimm, Volksmärchen, Max Lüthi, sprachliche Analyse, didaktisches Material, Unterrichtsmaterial, Kreativität, Fantasie, Erzählen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das didaktische Material zum Märchen „Der Froschkönig und der eiserne Heinrich“ zu bewerten und dessen Eignung für den Grundschulunterricht zu beurteilen. Es soll untersucht werden, ob und wie das Material einen tieferen Zugang zum Inhalt und zur Thematik des Märchens ermöglicht und die sprachliche und kreative Entwicklung der Schüler fördert.
- Quote paper
- Anne-Kathrin Petri (Author), 2013, Der Froschkönig: Bewertung als didaktisches Material für den Grundschulunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262304