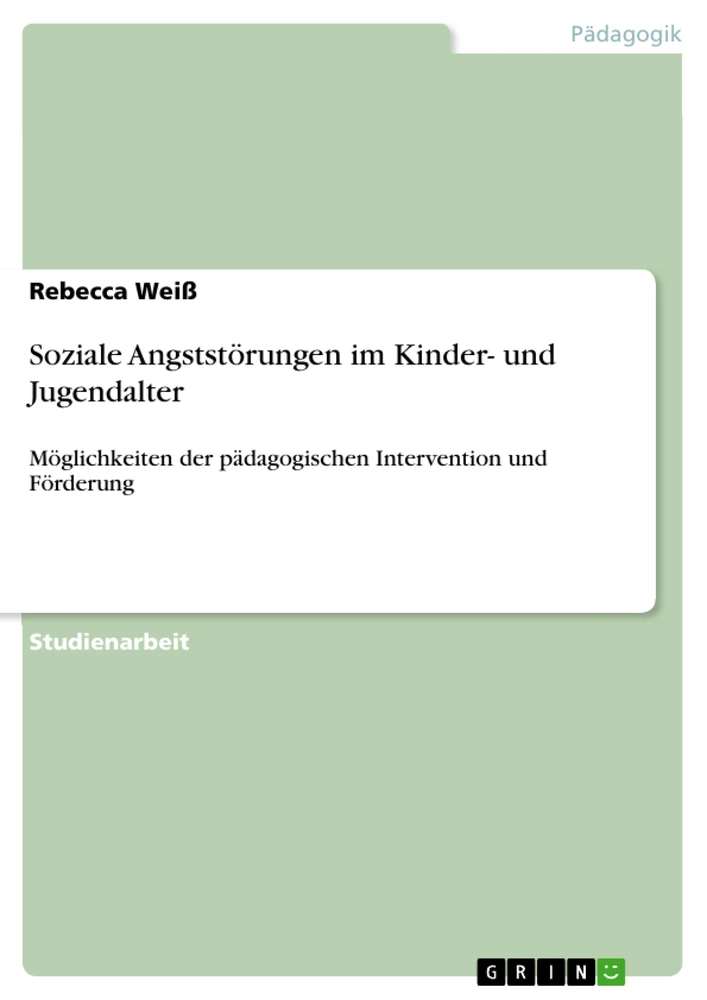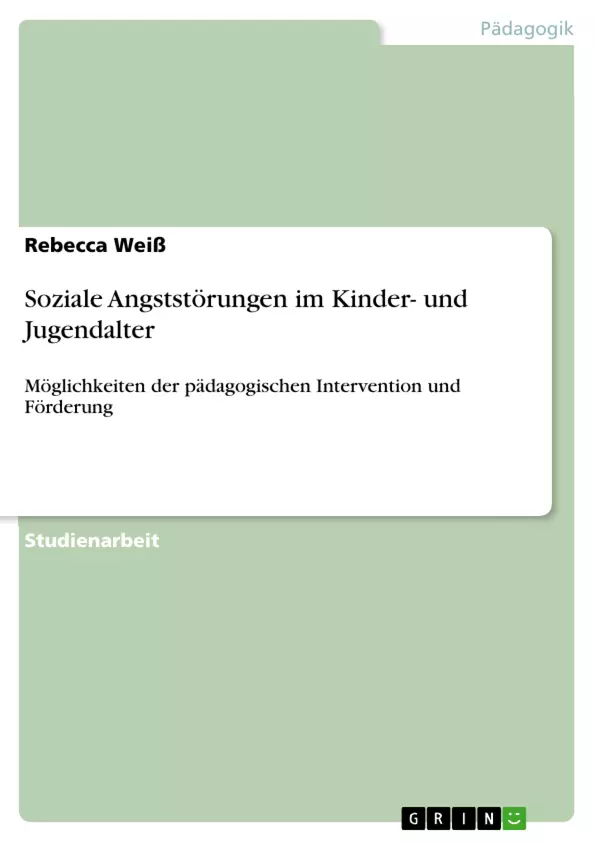„Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage: wovor?“ (Frank Thieß)
Der Begriff „Angst“ leitet sich aus dem lateinischen Wort „angustiae“ ab, was Enge bedeutet. Sie beschreibt ein Gefühl, welches nicht durch den eigenen Willen steuerbar ist und als „das unangenehme Erleben angesichts von unklaren Situationen und Befürchtungen“ (Stein (2012), S.20) auftritt. Zudem ist sie abzugrenzen von der Phobie, welche sich im Gegensatz zur Angst in einer übertriebenen Angst vor ganz bestimmten Dingen oder Situationen äußert.
An sich ist die Angst ein menschliches Grundgefühl, ein lebensnotwendiger Faktor, welcher sowohl psychische wie auch physische Auswirkungen beinhaltet. Sie ist Antrieb des menschlichen Lebens, trägt durch ihren herausfordernden Charakter zur Entwicklung der menschlichen Kultur bei und steuert einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der menschlichen Spezies hinzu.
[...]
Diese Arbeit behandelt die Thematik der Angststörungen, speziell der sozialen Angststörung. Im Kindes und Jugendalter ist die Angststörung eine der häufigsten Störungen. Deshalb ist es besonders für Personen die im pädagogischen Bereich arbeiten wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich ein Grundwissen im Umgang mit dieser Art der Störung anzueignen. Da im Bereich der Verhaltensauffälligkeiten immer noch externalisierende Störungen stärker thematisiert werden und der Bereich der internalisierenden Störungen dabei in den Hintergrund rückt, habe ich mich dafür entschieden diese Thematik näher zu betrachten.
Im Folgenden werde ich auf den Begriff der sozialen Angststörungen und möglicher Ursachen ihrer Entstehung eingehen. Danach werde ich verschiedene Methoden der therapeutisch-pädagogischen Prävention und Intervention erläutern und den Blick auf Möglichkeiten im Unterrichtsverlauf lenken um daraufhin mein abschließendes Fazit zu ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Angststörungen
- Klassifikation
- Epidemiologie
- Entstehung und Entwicklung der sozialen Angststörung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren
- Klassische Konditionierung
- Operante Konditionierung
- Modelllernen
- Kognitive Lernformen
- Andere Faktoren bezogen auf soziale Ängste
- Möglichkeiten der Herangehensweise
- Erste Schritte
- Das kleine 1×1 im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit sozialen Ängsten
- Spezielle therapeutische und pädagogische Methoden
- Bezug auf die Pädagogik im Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der sozialen Angststörung im Kindes- und Jugendalter. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung dieser Störung sowie die Möglichkeiten der pädagogischen Intervention und Förderung. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Einordnung der sozialen Angststörung in die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV gelegt.
- Definition und Klassifikation der sozialen Angststörung
- Epidemiologie und Prävalenz der sozialen Angststörung im Kindes- und Jugendalter
- Entstehungsmechanismen der sozialen Angststörung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren
- Möglichkeiten der pädagogischen Intervention und Förderung bei sozialen Angststörungen
- Bedeutung und Umsetzung der pädagogischen Intervention im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Angst ein und grenzt die Angst von der Phobie ab. Sie beleuchtet die Bedeutung der Angst als menschliches Grundgefühl und die Herausforderungen, die sich aus der Entwicklung einer Angststörung ergeben können.
Soziale Angststörungen
Das Kapitel beschreibt die Klassifikation der sozialen Angststörung im ICD-10 und DSM-IV. Es werden die wichtigsten Kriterien für die Diagnose dieser Störung erläutert. Der Abschnitt behandelt zudem die Epidemiologie und Prävalenz der sozialen Angststörung im Kindes- und Jugendalter.
Entstehung und Entwicklung der sozialen Angststörung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren
Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene Faktoren, die zur Entstehung und Entwicklung der sozialen Angststörung beitragen können. Dabei werden die klassischen und operanten Konditionierung, das Modelllernen und kognitive Lernformen sowie weitere Faktoren wie familiäre und soziale Umgebungen betrachtet.
Möglichkeiten der Herangehensweise
Das Kapitel widmet sich verschiedenen Herangehensweisen im Umgang mit sozialen Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Es werden erste Schritte, pädagogische Methoden und die Integration der pädagogischen Intervention in den Unterrichtsalltag beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Angststörung, Phobie, Angst, ICD-10, DSM-IV, Klassifikation, Epidemiologie, Entstehung, Entwicklung, Faktoren, Konditionierung, Modelllernen, Kognitive Lernformen, Pädagogische Intervention, Förderung, Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine soziale Angststörung?
Es ist eine Störung, bei der Betroffene eine übermäßige Angst vor sozialen Situationen haben, in denen sie im Mittelpunkt stehen oder von anderen bewertet werden könnten.
Wie häufig sind Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen?
Angststörungen gehören im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten psychischen Störungen, wobei soziale Ängste oft erst im Jugendalter voll ausgeprägt sind.
Welche Faktoren tragen zur Entstehung sozialer Ängste bei?
Dazu zählen klassische und operante Konditionierung (negative Erfahrungen), Modelllernen (ängstliche Vorbilder), kognitive Faktoren sowie familiäre Einflüsse.
Wie können Lehrer Schülern mit sozialen Ängsten helfen?
Lehrer können durch eine unterstützende Lernatmosphäre, schrittweise Heranführung an angstbesetzte Aufgaben (z. B. Referate) und spezielle pädagogische Interventionen im Unterricht helfen.
Wo werden soziale Angststörungen medizinisch klassifiziert?
Die Klassifikation erfolgt nach international anerkannten Systemen wie dem ICD-10 oder dem DSM-IV.
- Citar trabajo
- Rebecca Weiß (Autor), 2013, Soziale Angststörungen im Kinder- und Jugendalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262129