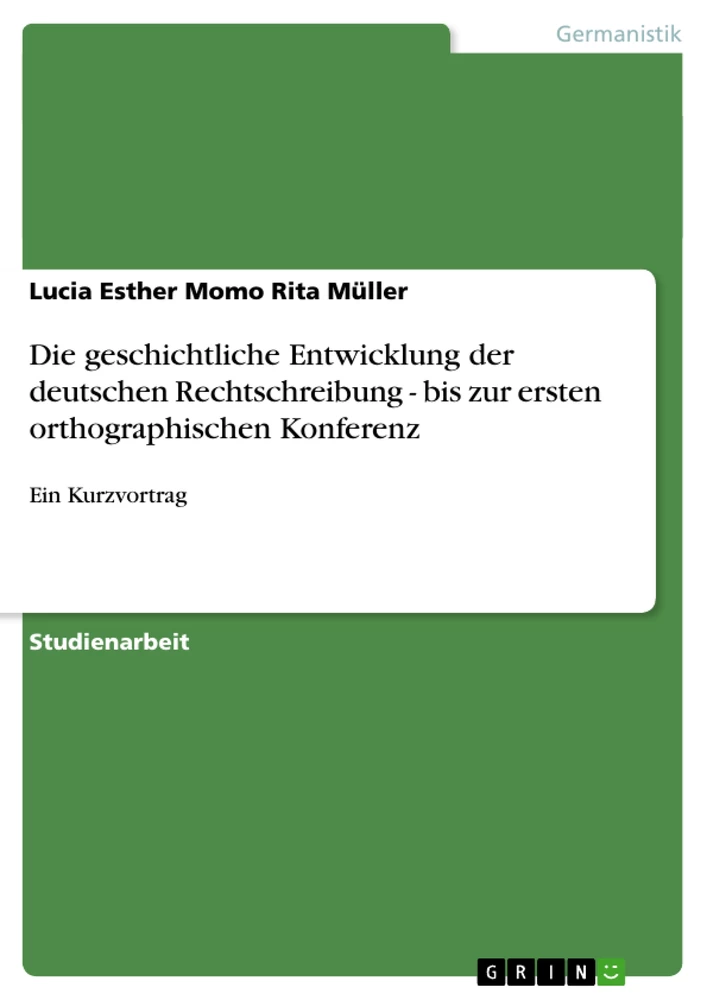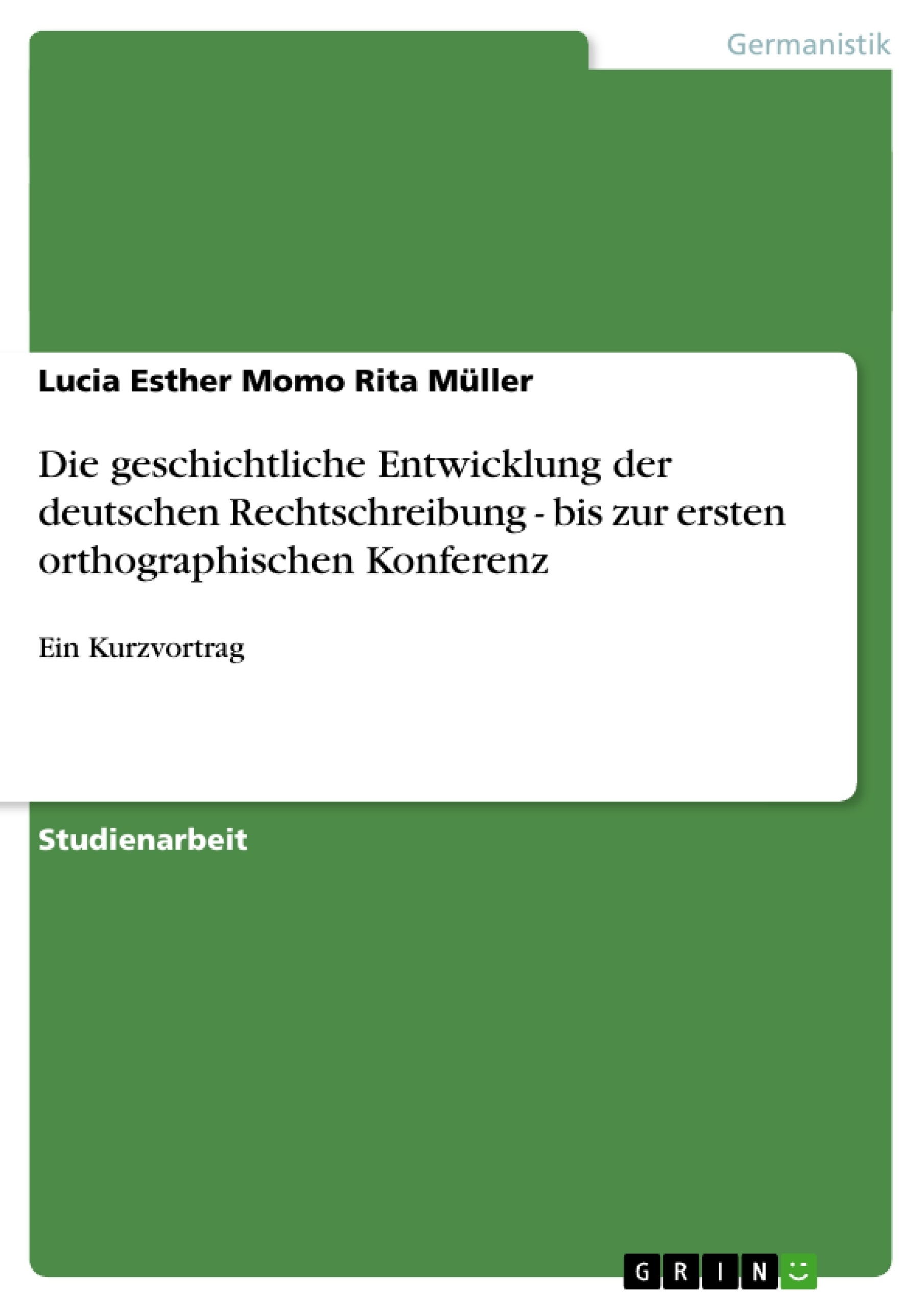Das Deutsche ist die einzige Sprache der Welt, in der Substantive in der Satzmitte groß
geschrieben werden, es gibt verwirrende Regelungen bezüglich der Dehnung - man
schreibt „Teer“, „schwer“, und „lehr“, und jedesmal ist der Vokal langes „e“. Wie
kam es zu all diesen Entwicklungen?
In der althochdeutschen Sprachperiode (etwa 750-1050) galt als Schreibgrundsatz das
Prinzip der Lauttreue, also die Regel „Schreibe wie du sprichst“. Zwar war auch damals
schon ein Phonem (also ein Laut) durch mehrere Grapheme (also Buchstaben) darstellbar,
aber zumeist wurden die Wörter in „stiller Übereinkunft“ gleich geschrieben. Auch
in der mittelhochdeutschen Sprachperiode (etwa 1100-1500) schrieb man auf diese Art
und Weise.
Warum also haben sich die Schreibweisen bis heute so stark verändert, wenn es doch
damals scheinbar keine Rechtschreibprobleme gab? Warum hat man sich diese denn
erst erschaffen, und warum kehren wir heute nicht einfach wieder zu diesem Grundsatz
zurück, wenn damit alle Probleme gelöst scheinen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Die geschichtliche Entwicklung der deutschen Rechtschreibung (bis I. Orthographische Konferenz)
- Die althochdeutsche Sprachperiode (etwa 750-1050)
- Die mittelhochdeutsche Sprachperiode (etwa 1100-1500)
- Die Entstehung der neuhochdeutschen Sprache
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 16. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 17. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 18. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 19. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der historischen Entwicklung der deutschen Rechtschreibung von ihren Anfängen in der althochdeutschen Sprachperiode bis hin zur ersten Orthographischen Konferenz. Er analysiert die Ursachen und Folgen der verschiedenen Entwicklungsstufen der Rechtschreibung, die von der Lauttreue bis hin zu ästhetischen und drucktechnischen Gesichtspunkten reichten.
- Die Entstehung der neuhochdeutschen Sprache
- Der Einfluss von Buchdruck und Martin Luther auf die Rechtschreibung
- Die Herausforderungen der Rechtschreibreform im 17. Jahrhundert
- Die Bedeutung der phonetischen und inhaltlichen Überlegungen der Rechtschreibreformer im 18. Jahrhundert
- Die Dominanz des Sprachgebrauchs und der Lauttreue in der Rechtschreibung des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Die althochdeutsche Sprachperiode (etwa 750-1050): In dieser Periode galt das Prinzip der Lauttreue. Die Wörter wurden meist in „stiller Übereinkunft“ geschrieben, wobei ein Phonem durch mehrere Grapheme dargestellt werden konnte.
- Die mittelhochdeutsche Sprachperiode (etwa 1100-1500): Die Schreibweise blieb im Wesentlichen der althochdeutschen Periode ähnlich.
- Die Entstehung der neuhochdeutschen Sprache: Die Sprachmischungen durch den wachsenden Handel und die Bedeutung der Kanzleisprache führten zur Entwicklung einer überregionalen deutschen Sprache. Der Buchdruck und die Bibelübersetzung von Martin Luther trugen zur Verbreitung der neuhochdeutschen Sprache bei.
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 16. Jahrhundert: Die zunehmende Verbreitung der Schriftsprache führte zu einer „Verrohung“ der Schrift. Es entstand eine Vielzahl neuer Wortbildungen und verschiedene Schreibweisen für ein und denselben Laut. Auch Martin Luther schrieb ein und dasselbe Wort in verschiedenen Varianten.
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 17. Jahrhundert: Die Konsonantenhäufung wurde zur Modeerscheinung und führte zu einer weiteren Verkomplizierung der Rechtschreibung. Ästhetische Gesichtspunkte und die Bezahlung der Buchdrucker nach Buchstaben spielten eine wichtige Rolle.
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 18. Jahrhundert: Die Schrift entfernte sich immer weiter von der Lauttreue. Es gab verschiedene Ansätze zur Reform der Rechtschreibung. Johann Christoph Gottsched führte die Großschreibung der Substantive ein.
- Die Entwicklung der Rechtschreibung im 19. Jahrhundert: Die Rechtschreibung wurde weiter geprägt durch den überlieferten Sprachgebrauch und das Prinzip „schreibe wie du sprichst“. Johann Christoph Adelung spielte eine wichtige Rolle in der Reform der Rechtschreibung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete des Textes sind: deutsche Rechtschreibung, Lauttreue, neuhochdeutsche Sprache, Buchdruck, Martin Luther, Konsonantenhäufung, ästhetische Aspekte, phonetische Überlegungen, Sprachgebrauch, Rechtschreibreform.
- Quote paper
- Lucia Esther Momo Rita Müller (Author), 2003, Die geschichtliche Entwicklung der deutschen Rechtschreibung - bis zur ersten orthographischen Konferenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25489