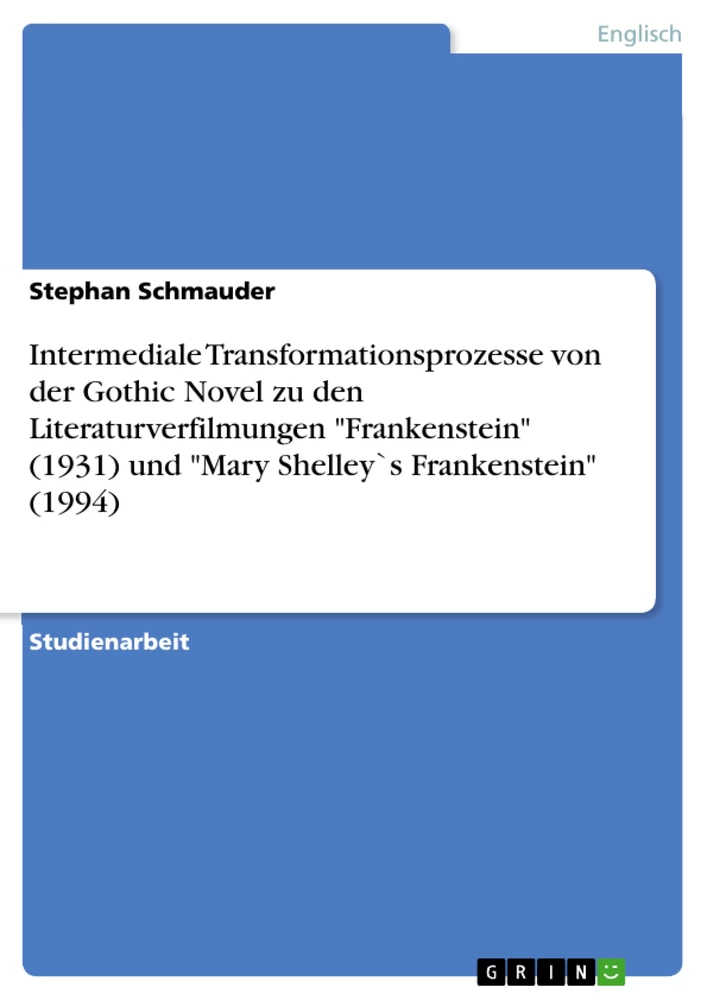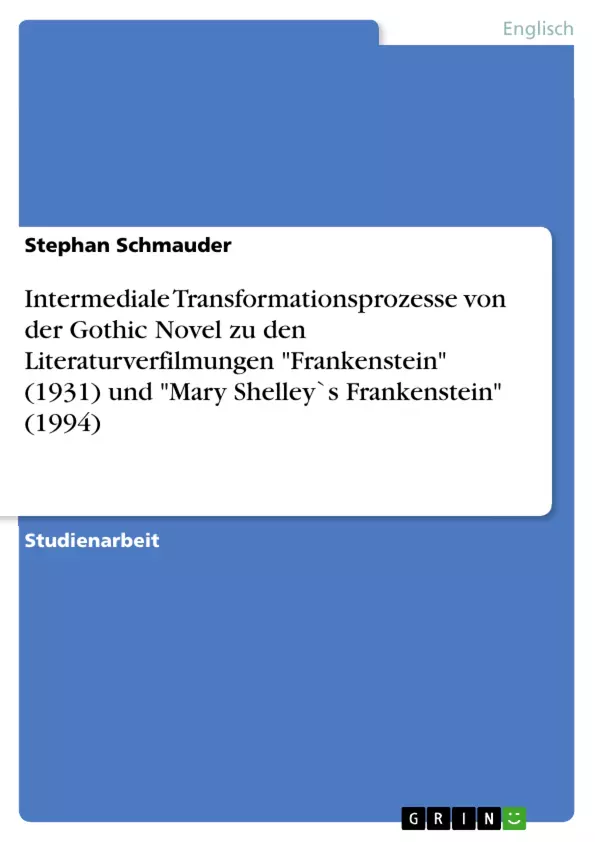Literaturverfilmungen gibt es als Genre vieleicht schon fast so lange, wie die Erfindung des Kinematographen es zulässt. Zwei Jahre nachdem die Gebrüder Lumière 1895 auf einem Pariser Boulevard ihre Projektionsapparatur für das Zeigen bewegter Bilder vorstellen, versuchen sie über die bloße Lust an der technischen Wiedergabe fotografisch aufgenommener Bewegungsabläufe hinausweisend, per filmischer mise en scène einer kurzen Passage aus dem "Faust" so etwas wie literarische Assoziationen bei ihren Zuschauern zu wecken. Seitdem ist ein nicht als zu gering einzuschätzender Teil der Filmproduktion durch den Rückgriff auf literarische Stoffe beeinflusst, geprägt und bereichert worden. Die Filmkategorie Literaturverfilmung besetzt seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Position an den Schnittstellen von Literatur- und Filminstitutionen. Besonders Klassiker- und Bestsellerverfilmungen haben immer Konjunktur, weil sie in einer mehr oder weniger vorausgesetzten Beziehung zu einer literarischen Vorlage stehen, die als bekannt angenommen werden kann. Hier setzt fast zwangsläufig ein gradatimer Marketing-Effekt ein. Literaturverfilmungen treten zunächst primär als solche auf, erst in zweiter Linie als Filme an sich, "[...] weil die Bekanntheit und das Prestige des Originalwerks nicht zuletzt aus kommerziellen und public-relation-Gründen als ein unterliegendes Referenz-System miteinbezogen wird." Die Rolle des Films als Warenprodukt, als Erzeugnis einer auf Gewinnoptimierung zielenden Warenkonsum-ankurbelnden Industrie kommt in diesem Aspekt deutlich zum Vorschein (vgl. Kap. 2.4.2.2.). Die Seminararbeit ist jedoch primär an der Untersuchung der ästhetischen Seite des intermedialen Vorgangs des Zeichentransfers von Literatur zu Film interessiert.
Ziel dieser Arbeit ist es, den Roman Frankenstein or The Modern Prometheus (1818) von Marry W. shelley mit der ersten populären sowie der bislang jüngsten Verfilmung im Rahmen der Gestaltungskonzeption der jeweiligen medialen Umsetzung des literarischen Stoffes zu vergleichen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Erzählformen sollen deutlich gemacht werden. Axiom dieser Vorgehensweise ist, die wesentlichen Differenzen zwischen einem literarischen Text des frühen neunzehnten Jahrhunderts und seinen modernen Verfilmungen darzustellen, die womöglich darin bestehen, dass die unterschiedlichen Erzählformen - Literatur und Film - in verschiedenen Medien zuhause sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Komparatistische Analyse der drei vorliegenden Texturen
- Vergleich der Texturen auf der Plot-Ebene
- Abweichungen im Handlungsverlauf zwischen shelley's Novel und whale's Frankensteinfilm
- Abweichungen wischen shelley's Novel und branagh's Literaturverfilmung Mary Shelley's Frankenstein
- Vergleich der Texturen auf der Ebene der Figurenzeichnung am Beispiel des Monsters
- Abweichungen zwischen shelley's und whale's Monster
- Abweichungen zwischen shelley's und branagh's Monster
- Vergleich der Texturen auf der Ebene des erzählerischen Point of View
- shelley vs. whale
- shelley vs. branagh
- Vergleich der Texturen auf der szenischen Ebene am Beispiel der Analyse zweier Schlüsselsequenzen
- Die Creation Scene
- Die Creation Scene bei shelley
- Die Creation Scene bei whale
- Die Creation Scene bei branagh
- The End of the Story: Death of a Hero
- Das Roman-Ende bei shelley
- Das Film-Ende bei whale
- Das Film-Ende bei branagh
- Die Creation Scene
- Vergleich der Texturen auf der Plot-Ebene
- Einordnung der beiden Verfilmungen in die gängigen Beurteilungskriterien
- Bipolare Analysekriterien
- Vier Untertypen des Genres Literaturverfilmung
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich von Mary Shelley's Roman "Frankenstein or The Modern Prometheus" mit seinen beiden Verfilmungen, "Frankenstein" (1931) von James Whale und "Mary Shelley's Frankenstein" (1994) von Kenneth Branagh. Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Erzählformen im Hinblick auf die Gestaltungskonzeption der jeweiligen medialen Umsetzung des literarischen Stoffes zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die narrative Ebene und untersucht die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Roman und seinen filmischen Adaptionen in Bezug auf Plot, Figurenzeichnung, Erzählperspektive und Schlüsselszenen.
- Intermedialer Transfer des Erzählstoffes
- Komparatistische Analyse von Roman und Verfilmung
- Untersuchung der narrativen Ebene in den drei Texturen
- Analyse der Figurenzeichnung und des Point of View
- Einordnung der Verfilmungen in die Forschungsliteratur der Intermedialität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz von Literaturverfilmungen als Genre vor und verweist auf die frühe Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung literarischer Stoffe. Sie verdeutlicht die besondere Stellung von Klassiker- und Bestsellerverfilmungen in der Filmproduktion und diskutiert den Marketing-Effekt, der mit der Bekanntheit des Originalwerks verbunden ist. Die Arbeit konzentriert sich jedoch primär auf die ästhetische Seite des Zeichentransfers von Literatur zu Film. Als Ziel wird der Vergleich von Mary Shelley's Roman "Frankenstein" mit zwei Verfilmungen im Hinblick auf die Gestaltungskonzeption der medialen Umsetzung des literarischen Stoffes formuliert. Die Arbeit soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Erzählformen aufzeigen und die wesentlichen Differenzen zwischen einem literarischen Text des frühen 19. Jahrhunderts und seinen modernen Verfilmungen darlegen. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf den Ebenen des Plots, der Figurenzeichnung, des Point of View und der szenischen Gestaltung.
Komparatistische Analyse der drei vorliegenden Texturen
Das Kapitel analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Romanvorlage und den beiden Verfilmungen auf verschiedenen Ebenen. Es behandelt die Abweichungen im Handlungsverlauf zwischen Shelley's Roman und Whale's Frankensteinfilm, insbesondere die Reduktion des komplexen Erzählgeflechts des Romans auf den Handlungskern der Binnenerzählung. Es werden die Unterschiede im Plot, in der Figurenzeichnung, im Point of View und in der szenischen Gestaltung der beiden Filme im Vergleich zum Roman dargestellt.
Einordnung der beiden Verfilmungen in die gängigen Beurteilungskriterien
Das Kapitel widmet sich der Einordnung der beiden Verfilmungen in die Forschungsliteratur der Intermedialität. Es befasst sich mit bipolaren Analysekriterien und den vier Untertypen des Genres Literaturverfilmung, um die beiden Verfilmungen im Kontext der aktuellen Forschung zu positionieren.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Literaturverfilmung, Intermedialität, Gothic Novel, Frankenstein, Mary Shelley, James Whale, Kenneth Branagh, Plotanalyse, Figurenzeichnung, Point of View, Szenenanalyse, Beurteilungskriterien, Vergleichende Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Frankenstein-Verfilmungen werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden die klassische Verfilmung von James Whale aus dem Jahr 1931 und Kenneth Branaghs "Mary Shelley's Frankenstein" von 1994 mit der Romanvorlage von 1818.
Was ist das Hauptziel dieser komparatistischen Analyse?
Ziel ist es, die ästhetischen Unterschiede im Zeichentransfer von der Literatur zum Film auf den Ebenen von Plot, Figurenzeichnung und Erzählperspektive aufzuzeigen.
Wie unterscheidet sich die Darstellung des Monsters in den Filmen?
Die Arbeit analysiert die Abweichungen zwischen Shelleys ursprünglicher Figur und den filmischen Interpretationen durch Whale und Branagh hinsichtlich Charaktertiefe und Erscheinung.
Welche Rolle spielt die "Creation Scene" im Vergleich?
Die Erschaffungsszene dient als Schlüsselsequenz, um die unterschiedliche mediale Umsetzung und die atmosphärische Gestaltung in Roman und Filmen zu verdeutlichen.
Warum werden Literaturverfilmungen oft aus kommerziellen Gründen produziert?
Die Bekanntheit und das Prestige des Originalwerks (Klassiker- oder Bestseller-Status) dienen als Marketing-Effekt, um den Konsum des Films anzukurbeln.
- Quote paper
- Stephan Schmauder (Author), 1998, Intermediale Transformationsprozesse von der Gothic Novel zu den Literaturverfilmungen "Frankenstein" (1931) und "Mary Shelley`s Frankenstein" (1994), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2488