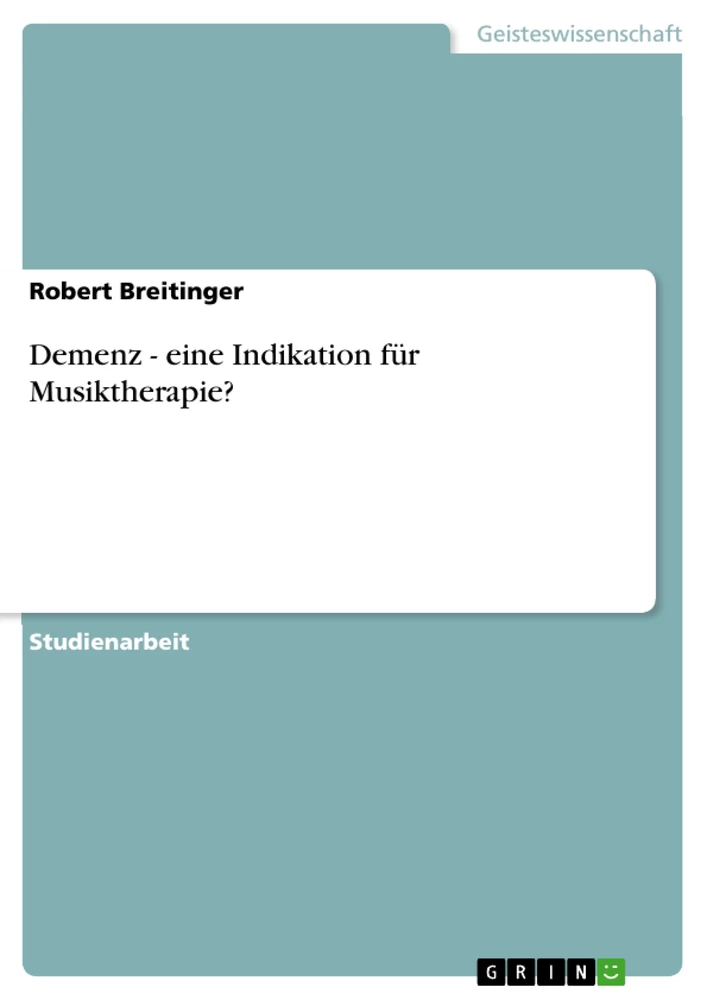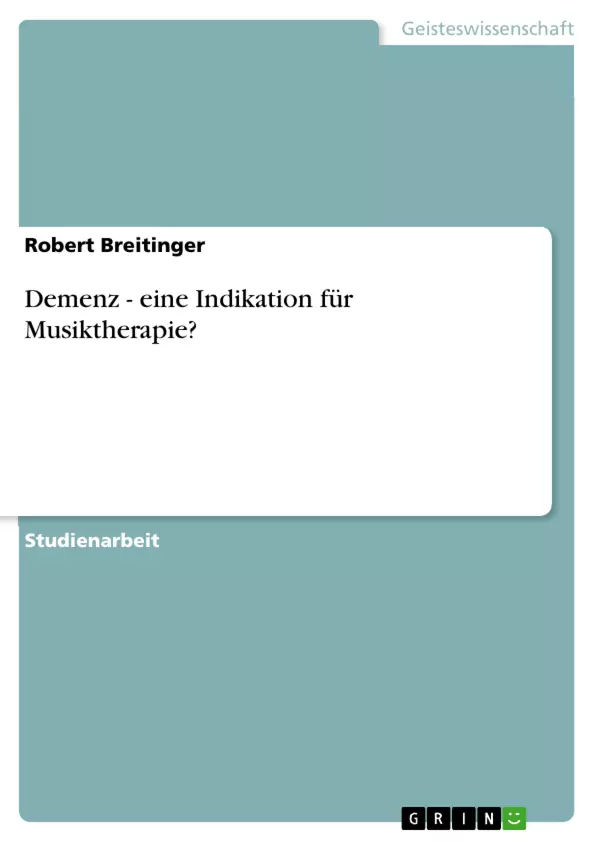Einleitung: Zur thematischen Relevanz
In der deutschen Gesellschaft vollzieht sich gegenwärtig wie in allen anderen Industriestaaten eine erhebliche Verschiebung im zahlenmäßigen Verhältnis von Jung und Alt. Waren im Jahre 1880 von hundert Einwohnern gerade fünf älter als 60 Jahre, so sind es heute 23. Um 2030 werden 35 v.H. älter als 60 Jahre sein. Gleichzeitig ist eine erhebliche Zunahme im Bereich der Hochbetagten zu verzeichnen, denn ein heute 60jähriger Mann kann mit 22, eine 60jährige Frau mit 26 weiteren Lebensjahren rechnen (vgl. MUTHESIUS 1997a; SCHEUMANN 1999). Auf die Gründe und Hintergründe für diesen demographischen Wandel (wie Zunahme der Lebenserwartung und Rückgang der Geburtenrate) soll hier nicht näher eingegangen werden. Es ist jedoch klar, daß solche Veränderungen bedeutende politische, wirtschaftliche, soziale und individuelle Folgen mit sich bringen. Beispielsweise haben sie dazu geführt, "daß in der Gesellschaft dem alten Menschen und seinen Bedürfnissen mehr als je zuvor Aufmerksamkeit geschenkt wird" (HIRSCH 1997, 1). Das bislang vorherrschende negative Bild vom Alter weicht einem optimistischeren, hoffnungsvolleren Bild - und Vorbild . Nachdem es dem medizinischen Fortschritt gelungen ist, dem Leben Jahre zu geben, ist die Gesellschaft gefordert, den Jahren Leben zu geben (vgl. SCHEUMANN 1999; LINDEN 1997). Der Blick richtet sich also auf die Qualität, nicht mehr vorrangig die Quantität der gewonnenen Jahre, die oft genug um den Preis unheilbaren, chronifizierten Leidens erkauft werden. Da mit höherem Alter auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt, eine zu Demenz führende Krankheit zu bekommen, wächst bei der geschilderten Bevölkerungsentwicklung auch der relative Anteil Betroffener an der Gesamtbevölkerung. Findet man statistisch bei 60jährigen unter hundert Einwohnern nur einen an einer Demenz Erkrankten, so sind es bei den über 80jährigen bereits 20 (vgl. BUIJSSEN 1997, 262f.). Es ist daher im Bereich der Altenarbeit von einem wachsenden pflegerischen und psychosozialen Versorgungsbedarf auszugehen.
[...]
_____
1 BAUMANN-HÖLZLE (1997) hat auf die ethische Problematik und die doppelte Botschaft dieses Wechsels vom Defizit- zum Kompetenzmodell aufmerksam gemacht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG: ZUR THEMATISCHEN RELEVANZ...
- 2 DAS DEMENTIELLE SYNDROM.
- 2.1 Begriff..
- 2.2 Formen und Ursachen .
- 2.3 Symptome.
- 2.4 Verlauf.
- 2.5 Therapeutische Ansätze.
- 2.5.1 Realitätsorientierungstraining (ROT).
- 2.5.2 Biographisches Arbeiten.
- 2.5.3 Validation.
- 2.5.4 Milieutherapie.
- 3 MUSIKTHERAPIE BEI DEMENTIELL ERKRANKTEN.
- 3.1 Das Modell für Musiktherapie nach SMEIJSTERS (1999)
- 3.2 Pathologisch-musikalische Prozesse der Demenz.
- 3.2.1 Praxisberichte...
- 3.2.2 Zusammenfassung...
- 3.2.3 Ansätze musiktherapeutischer Diagnostik .
- 3.3 Problem, maßgeschneiderte Behandlung und Förderung.
- 3.4 Therapeutisch-musikalische Prozesse bei der Demenz.
- 3.4.1 In der Praxis angewandte musikalische Handlungsformen .
- 3.4.2 Eigene Überlegungen.
- 3.5 Substitution.
- 3.5.1 An der Versorgung dementiell Erkrankter beteiligte Berufsgruppen.
- 3.5.2 Musiktherapeutische Effektivitätsstudien.
- 3.5.3 Der spezifische Beitrag der Musiktherapie
- 3.6 Transparenz.
- 3.6.1 Erinnerungsinseln und Emotionalität als therapeutische Ressourcen
- 3.6.2 Musik als nonverbales Zugangs- und Ausdrucksmedium.
- 3.6.3 Musik als Orientierung vergegenwärtigendes Medium.
- 3.6.4 Musik als handlungsförderndes Medium...
- 3.6.5 Musik als Gemeinschaftserlebnis .
- 3.6.6 Musik als identitätsstärkendes Medium..
- 3.6.7 Musik als bewegungsförderndes Medium..
- 3.6.8 Musik als individuell anpassungsfähiges Medium.
- 4 ZUSAMMENFASSUNG.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz von Musiktherapie bei Demenz. Sie beleuchtet die Ursachen, Symptome und den Verlauf des dementiellen Syndroms und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Musiktherapie in der Behandlung von Demenzpatienten.
- Die steigende Anzahl demenziell erkrankter Menschen in der Gesellschaft
- Die Rolle der Musiktherapie in der Behandlung und Begleitung von Demenzpatienten
- Das Potential der Musiktherapie zur Verbesserung der Lebensqualität von Demenzpatienten
- Die Anwendung musiktherapeutischer Methoden und deren Auswirkungen auf Demenzpatienten
- Die Integration der Musiktherapie in bestehende Versorgungsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Zur thematischen Relevanz: Das Kapitel beleuchtet den demographischen Wandel und die wachsende Bedeutung der Versorgung von Demenzpatienten. Es wird die Rolle der Musiktherapie in der Behandlung von Demenz und deren Potenzial zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen hervorgehoben.
- Kapitel 2: Das dementielle Syndrom: Dieses Kapitel definiert den Begriff Demenz, beschreibt verschiedene Formen und Ursachen des dementiellen Syndroms sowie die typischen Symptome und den Verlauf der Krankheit. Außerdem werden verschiedene therapeutische Ansätze vorgestellt, die im Kontext der Demenzbehandlung eingesetzt werden.
- Kapitel 3: Musiktherapie bei dementiell Erkrankten: In diesem Kapitel wird das Modell für Musiktherapie nach Smeijsters vorgestellt. Es werden die pathologisch-musikalischen Prozesse der Demenz sowie die Ansätze musiktherapeutischer Diagnostik beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Problematik, maßgeschneiderte Behandlung und Förderung sowie den therapeutisch-musikalischen Prozessen bei der Demenz.
Schlüsselwörter
Demenz, Musiktherapie, Alzheimer-Krankheit, Demenzformen, Symptome, Verlauf, therapeutische Ansätze, Validation, Realitätsorientierungstraining, Biographisches Arbeiten, Milieutherapie, musiktherapeutische Diagnostik, Effektivitätsstudien, Lebensqualität, Versorgung, Integration
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Musiktherapie bei Demenz so effektiv?
Musik dient als nonverbales Ausdrucksmedium, das tief liegende Emotionen und Erinnerungen („Erinnerungsinseln“) erreichen kann, selbst wenn die verbale Kommunikation bereits stark eingeschränkt ist.
Kann Musiktherapie die Lebensqualität von Demenzpatienten verbessern?
Ja, sie fördert die Identität, wirkt gemeinschaftsbildend, verbessert die Orientierung und kann Bewegungsabläufe sowie das allgemeine Wohlbefinden positiv beeinflussen.
Was versteht man unter „Validation“ im Umgang mit Demenz?
Validation ist eine Kommunikationsmethode, die die Gefühle und die innere Erlebenswelt des Demenzkranken als gültig akzeptiert, anstatt ihn ständig korrigieren zu wollen.
Welche Formen der Demenz gibt es?
Die bekannteste Form ist die Alzheimer-Krankheit, es gibt jedoch auch vaskuläre Demenzen, die Lewy-Körper-Demenz und andere Formen mit unterschiedlichen Ursachen.
Wie sieht die demografische Entwicklung bei Demenzerkrankungen aus?
Aufgrund der steigenden Lebenserwartung nimmt der Anteil hochbetagter Menschen und damit auch die Zahl der Demenzfälle stetig zu. Man rechnet damit, dass bis 2030 etwa 35 % der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein werden.
- Citar trabajo
- Robert Breitinger (Autor), 2000, Demenz - eine Indikation für Musiktherapie?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2481