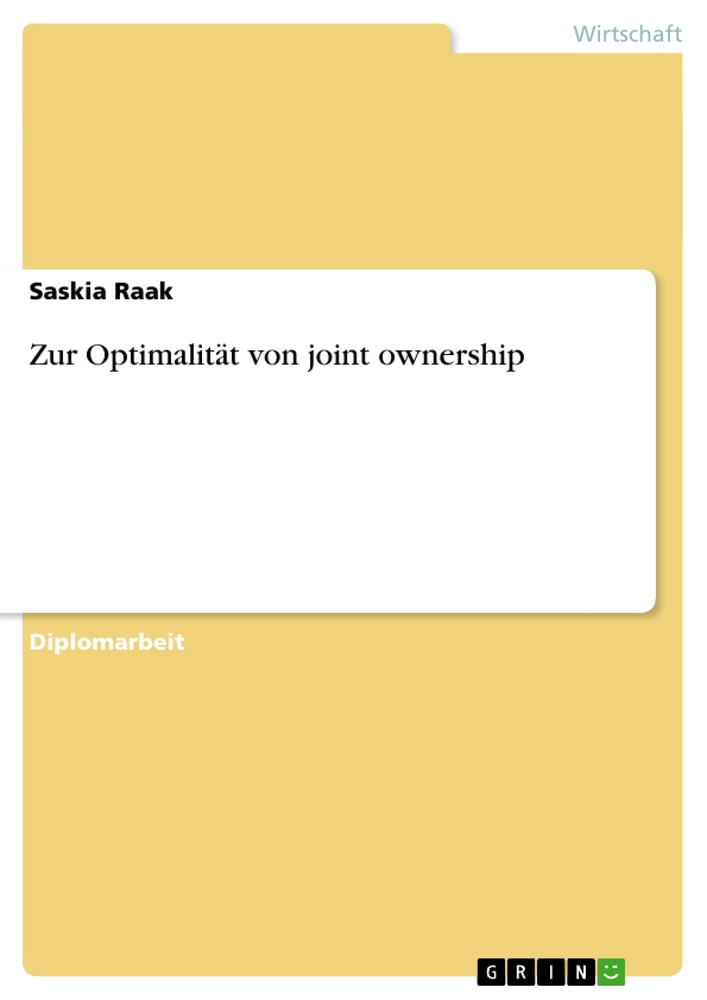Eine Unternehmung lässt sich im Sinne von Grossman und Hart als ein Bündel von Vermögensteilen interpretieren1, im einfachsten Falle kann man sich einen einzelnen Vermögensgegenstand vorstellen. Der jeweilige Eigentümer eines Vermögensteils übt die damit verbundenen Kontrollrechte aus, das heißt, er kann andere Parteien vom Zugang zu dem betreffenden Gegenstand ausschließen. Eigentumsrechte verleihen dem Inhaber eine verbesserte Position in Verhandlungen, da sich mit dem Eigentum im Regelfall der Drohpunkt der Partei erhöht und sie einen größeren Anteil eines gemeinschaftlich erwirtschafteten Überschusses für sich beanspruchen kann. Dadurch steigen gleichzeitig ihre Investitionsanreize.2 Welche Eigentumsstruktur aber garantiert im Kontext der so genannten Hold-up-Problematik und unter unvollständigen Verträgen die bestmöglichen Investitionsanreize und einen maximalen Gesamtüberschuss? Die Theorie der Eigentumsrechte der Unternehmung liefert hierbei aufschlussreiche Erkenntnisse: Gemäß eines bekannten Resultats von Hart, führt jegliche Eigentumsstruktur zu Unterinvestition gemessen an der Referenzlösung. Joint ownership stellt sich bei dieser Analyse als besonders unvorteilhaft heraus: Das Hold-up-Problem3 und die daraus resultierende Unterinvestition sind unter dieser Eigentumsstruktur am schwerwiegendsten. Dieses Resultat bewahrheitet sich, solange die Investitionen unabhängig oder strategische Komplemente sind und ausschließlich Humankapital betreffen.4 Für den Fall der Investition in physisches Kapital kann joint ownership die bestmögliche Eigentumsstruktur darstellen, sofern die jeweiligen Drohpunkte von den Investitionen beider Parteien abhängen.5 Trotz allem wird aber auch hier die Referenzlösung verfehlt. Obige Ergebnisse beziehen sich alle auf die Analyse statischer Spiele, in wiederholten Beziehungen allerdings werden diese Resultate in Frage gestellt. [...] 1 Vgl. Schweizer (1999) S. 240 2 Ein anderer Ansatz wird von Rajan/Zingales (1998) gewählt: Nicht allein die Allokation von Eigentum von Eigentum hat einen Einfluss auf das Investitionsverhalten der Parteien, sondern vielmehr die Regulation des Zugangs zu den fraglichen Vermögensteilen (oder der kritischen Ressource) veranlasst die Parteien, beziehungsspezifisch zu investieren. Durch Spezialisierung machen die Agenten, die Zugang erhalten, sich selbst zu einer kritischen Ressource und somit wertvoll. 3 siehe auch Schweizer (1999) S. 186 4 Vgl. Hart (1995) S. 44-49 5 Vgl. Hart (1995) S. 68
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Modelle beziehungsspezifischer Investition im Kontext unvollständiger Verträge
- Grundmodell mit Investition in Humankapital nach Halonen
- Grundmodell mit Investition in physisches Kapital nach Rosenkranz/Schmitz
- Analyse des Stufenspiels
- Ein Beispiel
- Analyse des Stufenspiels nach Halonen
- Analyse des Stufenspiels nach Rosenkranz/Schmitz
- Dynamisches Spiel
- Fortführung des Beispiels von Halonen
- Unendlich oft wiederholtes Spiel
- Zweifach wiederholtes Spiel
- Nachverhandlungen
- Ausweitung des Beispiels auf Nachverhandlungen
- Modell nach Rosenkranz/Schmitz mit Nachverhandlungen
- Ein Beispiel zu Rosenkranz/Schmitz
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage der optimalen Allokation von Eigentumsrechten im Kontext von beziehungsspezifischen Investitionen. Im Vordergrund steht dabei die Analyse von wiederholten Beziehungen und die Untersuchung, ob joint ownership unter diesen Bedingungen die bestmögliche Eigentumsstruktur darstellen kann. Die Arbeit setzt sich kritisch mit bestehenden Ansätzen auseinander, die joint ownership in statischen Spielen als suboptimal bewerten. Dabei werden insbesondere die Arbeiten von Halonen und Rosenkranz/Schmitz, die sich mit wiederholten Spielen befassen, analysiert.
- Hold-up-Problematik und Unterinvestition unter unvollständigen Verträgen
- Optimale Eigentumsstruktur in wiederholten Beziehungen
- Analyse von joint ownership in dynamischen Spielmodellen
- Untersuchung von Reputationseffekten und ihrer Auswirkungen auf das Investitionsverhalten
- Bewertung von joint ownership im Vergleich zu anderen Eigentumsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Frage nach der optimalen Allokation von Eigentumsrechten. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage, die im Laufe der Arbeit behandelt werden soll, und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Modelle beziehungsspezifischer Investitionen im Kontext unvollständiger Verträge: In diesem Kapitel werden zwei verschiedene Modelle vorgestellt, die den Rahmen für die anschließende Analyse bilden. Das Modell von Halonen untersucht beziehungsspezifische Investitionen in Humankapital, während das Modell von Rosenkranz/Schmitz sich mit Investitionen in physisches Kapital befasst.
- Analyse des Stufenspiels: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der statischen Spiele, die in den beiden vorgestellten Modellen verwendet werden. Es wird ein Zahlenbeispiel zur Illustration des Modells von Halonen eingeführt, das in den folgenden Abschnitten weiterverwendet wird. Die Analyse zeigt, dass in statischen Spielen joint ownership tendenziell suboptimal ist.
- Dynamisches Spiel: In diesem Kapitel wird die Analyse der beiden Modelle auf wiederholte Spiele erweitert. Zunächst wird das Modell von Halonen für ein unendlich oft wiederholtes Spiel analysiert. Dabei zeigt sich, dass unter bestimmten Bedingungen joint ownership die First-Best-Investitionen unterstützen kann. Anschließend wird das Modell von Rosenkranz/Schmitz für ein zweifach wiederholtes Spiel untersucht. Hierbei wird deutlich, dass joint ownership in der ersten Spielstufe die First-Best-Investitionen implementieren kann und sich damit als überlegene Eigentumsstruktur erweist.
- Nachverhandlungen: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Nachverhandlungen auf die Ergebnisse der Analyse. Es wird gezeigt, dass Nachverhandlungen die Effizienz der Ergebnisse verbessern können, jedoch auch neue Probleme schaffen. Das Modell von Rosenkranz/Schmitz wird auf den Fall mit Nachverhandlungen erweitert.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Themen der Eigentumsrechte, beziehungsspezifischen Investitionen, unvollständige Verträge, Hold-up-Problem, joint ownership, wiederholte Spiele, Folk-Theorem, Reputationseffekte, und Investitionsanreize. Die Analyse bezieht sich auf Modelle von Halonen und Rosenkranz/Schmitz, die sich mit der optimalen Allokation von Eigentumsrechten in wiederholten Beziehungen befassen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Joint Ownership (Gemeinschaftseigentum)?
Es ist eine Eigentumsstruktur, bei der zwei oder mehr Parteien gemeinsam über einen Vermögensgegenstand verfügen und Entscheidungen nur im Konsens treffen können.
Was ist das Hold-up-Problem?
Das Hold-up-Problem beschreibt das Risiko, dass eine Partei nach einer beziehungsspezifischen Investition von der anderen Partei bei Nachverhandlungen ausgebeutet wird.
Wann kann Joint Ownership optimal sein?
In wiederholten Beziehungen (dynamischen Spielen) kann Joint Ownership optimale Investitionsanreize bieten, da Drohpotentiale besser ausbalanciert werden als in statischen Modellen.
Warum führt Eigentum zu höheren Investitionsanreizen?
Eigentumsrechte verbessern die Verhandlungsposition (Drohpunkt) einer Partei, wodurch sie einen größeren Anteil am erwirtschafteten Überschuss beanspruchen kann.
Was ist der Unterschied zwischen Humankapital- und Sachkapitalinvestitionen?
Bei Humankapital ist Joint Ownership oft unvorteilhaft, während es bei physischem Kapital (Sachkapital) die bestmögliche Struktur sein kann, wenn Drohpunkte von beiden Parteien abhängen.
- Citar trabajo
- Saskia Raak (Autor), 2003, Zur Optimalität von joint ownership, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24789